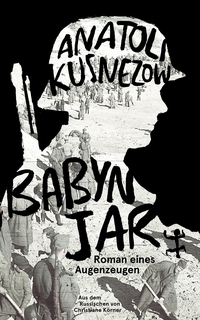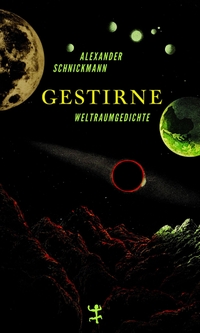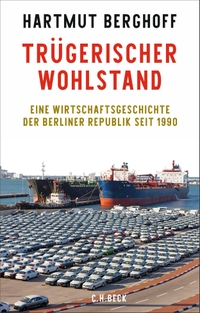Magazinrundschau
Die Magazinrundschau
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
29.11.2005. Im New Yorker stellt Seymour Hersh die amerikanische Spezialeinheit in Syrien vor. Im Merkur spottet Wolfgang Kemp über die Unesco. Die Weltwoche besucht Ilse Aichinger. Der Spiegel besucht Giuliano Ferrara, Chef der spannendsten Zeitung Italiens. Der Economist wundert sich über die Männlichkeitskriterien amerikanischer Eliteuniversitäten. Der Spectator will für die Pressefreiheit ins Gefängnis. Outlook India untersucht die Mama-Industrie. Monotheismus ist in Wahrheit Atheismus, verkündet Jean-Luc Nancy in Literaturen. Le Point staunt über die neuen Ikonoklasten in Frankreich. Paul Berman in The New Republic auch: Er sieht in Frankreich das neue Zentrum des Anti-Antiamerikanismus. Das ungarische ES-Magazin warnt vor Berliner Schulen. In der New York Times besteht Harold Bloom auf dem Unterschied zwischen Jesus und Jesus Christus.
New Yorker | London Review of Books | Outlook India | Literaturen | Elet es Irodalom | Espresso | Nouvel Observateur | Al Ahram Weekly | HVG | New York Times | Merkur | Weltwoche | Economist | Spiegel | Spectator | Point | New Republic
New Yorker (USA), 05.12.2005
Seymour Hersh hat wieder seine Verbindungen spielen lassen und macht in Sachen Irakkrieg mindestens drei neue Fässer auf: Zum einen gibt es Anzeichen, dass George W. Bush die Sache persönlich nimmt und sich erst dann zurückziehen will, wenn der Aufstand ganz zerschlagen ist, also nie. Zweitens plant das Pentagon angeblich, falls es doch einen graduellen Rückzug gibt, den Irakern die amerikanische Luftwaffe an die Hand zu geben. Keiner kann dann mehr kontrollieren, meint Hersh, ob wirklich Terroristen, interne Rivalen oder sogar Gegner von Al Qaida angegriffen werden. Und drittens sind die Amerikaner offenbar schon seit einigen Monaten in Syrien. "Ein zusammengesetztes Special Forces Team, eine 'Special Mission Unit' (S.M.U.), wurde unter strenger Geheimhaltung damit beauftragt, mutmaßliche Unterstützer des irakischen Aufstands jenseits der Grenze zu attackieren. (Vom Pentagon gibt es dazu kein Kommentar.)"
Peter Schjeldah besucht eine Ausstellung mit jüngeren Arbeiten Gerhard Richters in der Marian Goodman Gallery und ist ganz angetan von soviel europäischer Melancholie und Gedankenschwere. "Man muss nicht mit seinem Pessimismus übereinstimmen. (Als Amerikaner ist man sogar in furchtbaren Zeiten wohl immun gegen eine solche Einstellung.) Aber Richters Authentizität ist unbestreitbar. Sie verleiht der sachte angedeuteten Warnung Nachdruck, die in dem Foto der 'Mustangs' steckt (er fotografierte dieses Bild ab, das er 1963 wiederum auf der Grundlage einer alten Aufnahme schuf). Menschen und Dinge - Traditionen, Nationen - vergehen im Lauf der Geschichte wirklich, und nicht immer unvermeidlich."
Lesen dürfen wir schließlich noch die Erzählung "Wenlock Edge" von Alice Munro. Alex Ross stellt den neuen Musikdirektor des St. Louis Symphony Orchestra vor, David Robertson. Besprochen werden die neue Wordsworth-Biografie von Juliet Barker und Stephen Gaghans Filmthriller "Syriana" (mehr) über Öl, die CIA und den Nahen Osten - mit George Clooney in der Hauptrolle.
Peter Schjeldah besucht eine Ausstellung mit jüngeren Arbeiten Gerhard Richters in der Marian Goodman Gallery und ist ganz angetan von soviel europäischer Melancholie und Gedankenschwere. "Man muss nicht mit seinem Pessimismus übereinstimmen. (Als Amerikaner ist man sogar in furchtbaren Zeiten wohl immun gegen eine solche Einstellung.) Aber Richters Authentizität ist unbestreitbar. Sie verleiht der sachte angedeuteten Warnung Nachdruck, die in dem Foto der 'Mustangs' steckt (er fotografierte dieses Bild ab, das er 1963 wiederum auf der Grundlage einer alten Aufnahme schuf). Menschen und Dinge - Traditionen, Nationen - vergehen im Lauf der Geschichte wirklich, und nicht immer unvermeidlich."
Lesen dürfen wir schließlich noch die Erzählung "Wenlock Edge" von Alice Munro. Alex Ross stellt den neuen Musikdirektor des St. Louis Symphony Orchestra vor, David Robertson. Besprochen werden die neue Wordsworth-Biografie von Juliet Barker und Stephen Gaghans Filmthriller "Syriana" (mehr) über Öl, die CIA und den Nahen Osten - mit George Clooney in der Hauptrolle.
Merkur (Deutschland), 01.12.2005
Was macht eigentlich die Unesco? Malhefte in die Dritte Welt schicken, Gedenktage proklamieren, unlesbare Konventionen verabschieden? Wolfgang Kemp liefert einen recht boshaften "unverlangten Tätigkeitsbericht" über die Organisation, die ihm - mit Gerald Vouga gesprochen - "as natural as death and taxes" scheint. Vor allem auf das Erfolgsprogramm des Weltkulturerbes zielt sein Spott. Zuletzt hat die Unesco die Überreste des Limes zum Welterbe erklärt und die Grenzanlage zu einem "Vermittler menschlicher Werte durch die Entwicklung römischer Militärarchitektur". Kemp schwant: "Bald erkennt Helmut Kohl seinen 'Freizeitpark Deutschland' nicht wieder. Dann werden wir uns in einem Geschichtspark als Hüter und Staffage zugleich bewegen. Dann lesen wir täglich Warnungen wie: 'Die Höherlegung der B 42 vor Erpel könnte schwerwiegende Folgen für die Anerkennung des Mittelrheins als Weltkulturerbe haben.'"
Der Schriftsteller Gerhard Henschel richtet seinen Bannstrahl gegen "Europas größte und übelste Sexualklatschkloake" - die Bild-Zeitung: "Wer in dieses Abflussrohr hinabsteigt, der hat seinen Geist aufgegeben. Wer Bild als Kolumnist oder als Interviewpartner dient, der ist ethisch gerichtet und hat seinen intellektuellen und moralischen Bankrott erklärt. Und wer, wie Gerhard Schröder es getan hat, einen ausländischen Staatsgast zum gemeinsamen Bild-Interview willkommen heißt, der sollte sich die Frage vorlegen, ob es nicht anständiger gewesen wäre, den Gast in einem gutgeführten Bordell zu begrüßen als in Kai Diekmanns dreckiger Sexualnachrichtenkaschemme."
Weiteres: Dirk Knipphals versucht zu ergründen, warum "wir" eigentlich nicht mit Arnold Schwarzenegger warm werden. "Offenbar haben wir immer noch ein Problem damit, Intellektualität und Muskeln in einem Männerkörper zusammen zu denken." Julian Hanich preist Amerikas besten Filmkritiker: Anthony Lane vom New Yorker, den bereits andere mit dem Muhammad-Ali-Zitat belegten: "Er schwebt wie ein Schmetterling, er sticht wie eine Biene" (Hier der Beweis). Andreas Krause Landt konstatiert bei den Deutschen angesichts des Holocausts "Schuldstolz". Karl Heinz Bohrer beklagt die Entwertung des Pathos. Und Karl Otto Hondrich hat bei seinen Besuchen im Schwimmbad festgestellt, dass Frauen wieder "ihren Busen verhüllen".
Der Schriftsteller Gerhard Henschel richtet seinen Bannstrahl gegen "Europas größte und übelste Sexualklatschkloake" - die Bild-Zeitung: "Wer in dieses Abflussrohr hinabsteigt, der hat seinen Geist aufgegeben. Wer Bild als Kolumnist oder als Interviewpartner dient, der ist ethisch gerichtet und hat seinen intellektuellen und moralischen Bankrott erklärt. Und wer, wie Gerhard Schröder es getan hat, einen ausländischen Staatsgast zum gemeinsamen Bild-Interview willkommen heißt, der sollte sich die Frage vorlegen, ob es nicht anständiger gewesen wäre, den Gast in einem gutgeführten Bordell zu begrüßen als in Kai Diekmanns dreckiger Sexualnachrichtenkaschemme."
Weiteres: Dirk Knipphals versucht zu ergründen, warum "wir" eigentlich nicht mit Arnold Schwarzenegger warm werden. "Offenbar haben wir immer noch ein Problem damit, Intellektualität und Muskeln in einem Männerkörper zusammen zu denken." Julian Hanich preist Amerikas besten Filmkritiker: Anthony Lane vom New Yorker, den bereits andere mit dem Muhammad-Ali-Zitat belegten: "Er schwebt wie ein Schmetterling, er sticht wie eine Biene" (Hier der Beweis). Andreas Krause Landt konstatiert bei den Deutschen angesichts des Holocausts "Schuldstolz". Karl Heinz Bohrer beklagt die Entwertung des Pathos. Und Karl Otto Hondrich hat bei seinen Besuchen im Schwimmbad festgestellt, dass Frauen wieder "ihren Busen verhüllen".
Weltwoche (Schweiz), 24.11.2005
 In einem Wiener Sanatorium besucht David Signer die Schriftstellerin Ilse Aichinger, die sich dort wegen einer Schilddrüsenerkrankung aufhält, und führt ein langes Gespräch über die Vergeblichkeit des Reisens und die literarische Aufarbeitung einer recht gespenstischen Vergangenheit. "Etwa der Vater, der Büchernarr, der die Familie 'durch den Erwerb der fünften identischen Jean-Paul-Ausgabe' ruinierte, der überall, wo er war, Gläubiger zurückließ und schließlich 'vorsichtshalber, wegen seiner Bücherschulden, in die Nervenklinik gebracht' wurde. Eines Tages sagte ihm die Mutter in der Wohnung, in der man sich vor lauter Büchergestellen kaum mehr bewegen konnte: 'Entweder wir oder die Bücher'; und er entschied sich 'rasch, wenn auch nicht ohne Schmerz', für die Bücher."
In einem Wiener Sanatorium besucht David Signer die Schriftstellerin Ilse Aichinger, die sich dort wegen einer Schilddrüsenerkrankung aufhält, und führt ein langes Gespräch über die Vergeblichkeit des Reisens und die literarische Aufarbeitung einer recht gespenstischen Vergangenheit. "Etwa der Vater, der Büchernarr, der die Familie 'durch den Erwerb der fünften identischen Jean-Paul-Ausgabe' ruinierte, der überall, wo er war, Gläubiger zurückließ und schließlich 'vorsichtshalber, wegen seiner Bücherschulden, in die Nervenklinik gebracht' wurde. Eines Tages sagte ihm die Mutter in der Wohnung, in der man sich vor lauter Büchergestellen kaum mehr bewegen konnte: 'Entweder wir oder die Bücher'; und er entschied sich 'rasch, wenn auch nicht ohne Schmerz', für die Bücher."In einem aus dem Express übernommenen Interview verteidigt der französische Innenminister Nicolas Sarkozy seine Politik der Härte in den Banlieues und schwört die Bürger auf eine lange Auseinandersetzung ein. "Die Polizei wird bleiben und den Drogenhandel ausrotten. Ein Drittel der mobilen Kräfte wird künftig nicht mehr zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung verwendet, sondern auf Dauer in den Problemquartieren stationiert, um die Sicherheit zu garantieren. Die Polizei wird Verhaftungen vornehmen, Schutz bieten und strafen. Sie wird um 17 Uhr anrücken und um 4 Uhr morgens wieder in die Kasernen gehen, denn in dieser Zeit sind die Ganoven aktiv, die dealen und Autos stehlen. So sieht Prävention aus."
Weitere Artikel: Andreas Furler taucht ganz tief ein in ein 13-pfündiges Werkbilderbuch über Stanley Kubrick. Und der Biologe Frans de Waal empfiehlt uns - leider nur im Print - von den Affen zu lernen, wenn wir in der modernen Welt überleben wollen.
Economist (UK), 25.11.2005
 Mit einiger Erleichterung stellt der Economist fest, dass sich al Qaida allmählich um die Sympathie der arabischen Bevölkerung bringt, nicht zuletzt mit dem jüngsten Attentat in Amman: "Es ist vielleicht mehr als nur zufällige Ironie, dass sich unter den sechzig Opfern auch Mustafa Akkad befand, jener in Syrien geborene Regisseur, dem der Film "Löwe der Wüste" zu verdanken ist. Nun trifft es sich aber, dass besagter Film, der den Mut von muslimischen Widerstandskämpfern verherrlicht, eine der wenigen Produktionen ist, die auf islamistischen Webseiten ausdrücklich gutgeheißen werden, wenn auch in einer Version, in der die Filmmusik durch religiöse Gesänge ersetzt und alle Szenen, in denen Frauen vorkommen, herausgeschnitten wurden."
Mit einiger Erleichterung stellt der Economist fest, dass sich al Qaida allmählich um die Sympathie der arabischen Bevölkerung bringt, nicht zuletzt mit dem jüngsten Attentat in Amman: "Es ist vielleicht mehr als nur zufällige Ironie, dass sich unter den sechzig Opfern auch Mustafa Akkad befand, jener in Syrien geborene Regisseur, dem der Film "Löwe der Wüste" zu verdanken ist. Nun trifft es sich aber, dass besagter Film, der den Mut von muslimischen Widerstandskämpfern verherrlicht, eine der wenigen Produktionen ist, die auf islamistischen Webseiten ausdrücklich gutgeheißen werden, wenn auch in einer Version, in der die Filmmusik durch religiöse Gesänge ersetzt und alle Szenen, in denen Frauen vorkommen, herausgeschnitten wurden."Spannend findet der Economist "The Chosen", Jerome Karabels Studie über die Aufnahmeverfahren der drei Elite-Universitäten Harvard, Yale und Princeton, die ihre Aufnahmekriterien über die Jahre immer so zurechtgeschustert haben, dass sie genau jene Studenten aufnehmen konnten, die sie am liebsten wollten (etwa mehr wohlhabende Protestanten und weniger Juden), ohne allzu offensichtlich gegen das Diktum der Meritokratie zu verstoßen. Etwa, indem sie die Charaktereigenschaft der "Männlichkeit" zum Aufnahmekriterium machten, und sich weigerten, in Bewerbern, die nicht wohlhabend und protestantisch waren (beispielsweise Juden), besagte Männlichkeit zu entdecken.
Weitere Artikel: In mehrere Artikeln überlegt der Economist, ob ein Abzug der amerikanischen Truppen aus dem Irak Sinn machen würde (nur einer ist online). Und schließlich fragt der Economist im Dossier, ob es das Schicksal Italiens ist, ein großes Venedig zu werden, nämlich kaum mehr als eine - zugegebenermaßen verführerische - Touristenattraktion.
Spiegel (Deutschland), 28.11.2005
 Alexander Smoltczyk war mit Giuliano Ferrara (Bild) essen. Der frühere Kommunist ist heute der intellektuelle Kopf der römischen Neokonservativen. Und er gibt die "spannendste Zeitung Italiens" heraus, meint Smoltczyk. "Il Foglio ist ein Journal des journalistischen Luxus und der intellektuellen Moden. Eine anregende Mischung aus taz, FAZ-Feuilleton und Osservatore Romano, wo ebenso zwei engbedruckte Seiten über das fußballerische Genie des Stürmerstars Roberto Mancini stehen können wie das Lehrschreiben 'Dominus Jesus' der Glaubenskongregation. Es gibt eine Knastseite und die beste Kriminalchronik des Landes." Verheiratet ist der Abtreibungsgegner Ferrara mit einer italo-amerikanischen Feministin. Zu den USA hat er schon lange gute Beziehungen. In den Achtzigern "begann er, der CIA regelmäßig politische Analysen zuzuspielen. 'Geld hat es nicht viel gebracht. Aber mir gefiel das Unmoralische daran. Und es war gut für meinen Narzissmus.'"
Alexander Smoltczyk war mit Giuliano Ferrara (Bild) essen. Der frühere Kommunist ist heute der intellektuelle Kopf der römischen Neokonservativen. Und er gibt die "spannendste Zeitung Italiens" heraus, meint Smoltczyk. "Il Foglio ist ein Journal des journalistischen Luxus und der intellektuellen Moden. Eine anregende Mischung aus taz, FAZ-Feuilleton und Osservatore Romano, wo ebenso zwei engbedruckte Seiten über das fußballerische Genie des Stürmerstars Roberto Mancini stehen können wie das Lehrschreiben 'Dominus Jesus' der Glaubenskongregation. Es gibt eine Knastseite und die beste Kriminalchronik des Landes." Verheiratet ist der Abtreibungsgegner Ferrara mit einer italo-amerikanischen Feministin. Zu den USA hat er schon lange gute Beziehungen. In den Achtzigern "begann er, der CIA regelmäßig politische Analysen zuzuspielen. 'Geld hat es nicht viel gebracht. Aber mir gefiel das Unmoralische daran. Und es war gut für meinen Narzissmus.'" Spectator (UK), 26.11.2005
 "Jedesmal wenn wir neue Hoffnung schöpfen, wirft uns wieder eine schlechte Nachricht auf den Boden", beschreibt Boris Johnson seine Beziehung zum Irakkrieg, die ihn selbst an ein Missbrauchsverhältnis erinnert. Jetzt hat ihn die Meldung niedergestreckt, dass George Bush offenbar in einem vertraulichen Gespräch mit Tony Blair vorgeschlagen hat, al-Dschasira in die Luft zu jagen. "Wenn seine Bemerkung nur unschuldiger Kretinismus war, warum, zum Teufel, hat der britische Staat dann dekretiert, dass, jeder, der ebendiese Äußerungen druckt, ins Gefängnis gesteckt wird", fragt Johson und verkündet: "Wenn mir jemand in den nächsten Tagen die Dokumente zukommen lässt, werde ich sie mit Freuden im Spectator veröffentlichen und die Gefängisstrafe riskieren. Die Öffentlichkeit muss selbst urteilen können." Wir warten gespannt auf die nächste Ausgabe!
"Jedesmal wenn wir neue Hoffnung schöpfen, wirft uns wieder eine schlechte Nachricht auf den Boden", beschreibt Boris Johnson seine Beziehung zum Irakkrieg, die ihn selbst an ein Missbrauchsverhältnis erinnert. Jetzt hat ihn die Meldung niedergestreckt, dass George Bush offenbar in einem vertraulichen Gespräch mit Tony Blair vorgeschlagen hat, al-Dschasira in die Luft zu jagen. "Wenn seine Bemerkung nur unschuldiger Kretinismus war, warum, zum Teufel, hat der britische Staat dann dekretiert, dass, jeder, der ebendiese Äußerungen druckt, ins Gefängnis gesteckt wird", fragt Johson und verkündet: "Wenn mir jemand in den nächsten Tagen die Dokumente zukommen lässt, werde ich sie mit Freuden im Spectator veröffentlichen und die Gefängisstrafe riskieren. Die Öffentlichkeit muss selbst urteilen können." Wir warten gespannt auf die nächste Ausgabe!Point (Frankreich), 24.11.2005
 Le Point widmet seine Titelgeschichte in dieser Woche einem Phänomen, welches das Magazin "ikonoklastische Welle" getauft hat: Intellektuelle wie Alain Finkielkraut, Marcel Gauchet, Luc Ferry, Politiker und Aktivistengruppen bringen angesichts der gegenwärtigen innenpolitischen Probleme Frankreichs die Spaltung zwischen Rechts und Links "endlich" zum Kippen. In seinem Editorial mit der Überschrift "Der Friedhof der Überzeugungen", das sich auch mit dem Parteitag der Sozialisten beschäftigt, beschreibt Claude Imbert den Hintergrund: "Immer mehr Franzosen sehen den Zustand Frankreichs in seiner grausamen Wahrheit: den wirtschaftlichen Niedergang, das Scheitern der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in den Vorstädten, die Isoliertheit in einem durch das Nein zum Referendum niedergeknüppelten Europa. Gegen dieses Chaos gibt es nur eine einzige taugliche Hoffnung: die der Reform."
Le Point widmet seine Titelgeschichte in dieser Woche einem Phänomen, welches das Magazin "ikonoklastische Welle" getauft hat: Intellektuelle wie Alain Finkielkraut, Marcel Gauchet, Luc Ferry, Politiker und Aktivistengruppen bringen angesichts der gegenwärtigen innenpolitischen Probleme Frankreichs die Spaltung zwischen Rechts und Links "endlich" zum Kippen. In seinem Editorial mit der Überschrift "Der Friedhof der Überzeugungen", das sich auch mit dem Parteitag der Sozialisten beschäftigt, beschreibt Claude Imbert den Hintergrund: "Immer mehr Franzosen sehen den Zustand Frankreichs in seiner grausamen Wahrheit: den wirtschaftlichen Niedergang, das Scheitern der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in den Vorstädten, die Isoliertheit in einem durch das Nein zum Referendum niedergeknüppelten Europa. Gegen dieses Chaos gibt es nur eine einzige taugliche Hoffnung: die der Reform."In einem weiteren Beitrag benennt Francois Dufay das "Vergehen" dieser "Ikonoklasten": Dass sie es "wagen, die Dinge beim Namen zu nennen" und "Tabus brechen", indem sie etwa das "berühmte französische Sozialsystem" in Frage stellen oder sich weigern zu glauben, dass sich die "Unterdrückten" niemals "wie Barbaren aufführen" könnten. Noch sei unklar, ob diese "Welle" eine "nationale Neubestimmung" einläutet oder einen "naturgegebenen Pessimismus" markiert. Aber: "Es wird dieses Mal schwer fallen, diese Ikonoklasten mundtot zu machen, in dem man sie in die Nähe von Le Pen rückt. Weder fremdenfeindlich noch rechtsradikal rekrutiert sich ein Großteil dieser 'neuen Reaktionäre', die letztlich zum Realismus Bekehrte sind, aus den Reihen der Linken." Die Krawalle, aber auch die Selbstmordattentate und das Nein zur Europäischen Verfassung markierten eine "katastrophale Abfolge", welche nun "die Zungen löst, Ansichten zurechtrückt und jeden dazu zwingt, seine intellektuelle Bequemlichkeit aufzugeben."
Zwei Interviews mit dem sozialistischen Politiker und Mitgründer von Ärzte ohne Grenzen Bernard Kouchner und dem Schriftsteller und Essayisten Philippe Muray ("Moderne contre moderne") zum Thema sind leider nur gegen Bezahlung zu lesen.
New Republic (USA), 29.11.2005
 Paul Berman veröffentlicht im New Republic einen riesigen Essay über den französischen Antiamerikanismus und kommt nach der Lektüre einiger Bücher unter anderem von Pierre Rigoulot und Philippe Roger zu einem überraschenden Schluss: "Frankreichs Grandeur", schreibt Berman, "ist nicht ganz eine Illusion. Es könnte sogar ein Zeichen französischer Grandeur sein, dass ausgerechnet hier - in einem Moment, wo Antiamerikanismus sich von links bis rechts in der ganzen Welt verbreitet hat - in aller Stille eine neue Literatur des Anti-Antiamerikanismus entstanden ist, eine neue, radikale und brillante Literatur, die noch keine große Wirkung auf die Welt oder gar die öffentliche Meinung in Frankreich gezeitigt hat und gewiss auch keinen plötzlichen Ruck bringen wird, und die doch in den nächsten Jahren als ein Hauptereignis in der Ideengeschichte gelten könnte." Von Paul Berman selbst gibt es übrigens auch ein neues Buch über die Entwicklung der europäischen Linken "Power and the Idealists" (hier eine viel versprechende Rezension von Peter Ross Range, der das Buch nahezu zur Pflichtlektüre für "liberale Internationalisten" erklärt).
Paul Berman veröffentlicht im New Republic einen riesigen Essay über den französischen Antiamerikanismus und kommt nach der Lektüre einiger Bücher unter anderem von Pierre Rigoulot und Philippe Roger zu einem überraschenden Schluss: "Frankreichs Grandeur", schreibt Berman, "ist nicht ganz eine Illusion. Es könnte sogar ein Zeichen französischer Grandeur sein, dass ausgerechnet hier - in einem Moment, wo Antiamerikanismus sich von links bis rechts in der ganzen Welt verbreitet hat - in aller Stille eine neue Literatur des Anti-Antiamerikanismus entstanden ist, eine neue, radikale und brillante Literatur, die noch keine große Wirkung auf die Welt oder gar die öffentliche Meinung in Frankreich gezeitigt hat und gewiss auch keinen plötzlichen Ruck bringen wird, und die doch in den nächsten Jahren als ein Hauptereignis in der Ideengeschichte gelten könnte." Von Paul Berman selbst gibt es übrigens auch ein neues Buch über die Entwicklung der europäischen Linken "Power and the Idealists" (hier eine viel versprechende Rezension von Peter Ross Range, der das Buch nahezu zur Pflichtlektüre für "liberale Internationalisten" erklärt).London Review of Books (UK), 01.12.2005
 In einem Tagebuch aus Paris schreibt Jeremy Harding über die Revolte in den Vorstädten: "Wir sollten nicht immer erwarten, dass ein Krawall etwas zu bedeuten hat. Tatsächlich wehte ein Hauch von Karneval über der Zerstörung in Frankreich ... Die Frage schien jedoch vor allem zu sein: Ist irgendjemand da draußen? Würde irgendjemand, der nicht von maghrebinischen oder subsaharischen Immigranten abstammt und in erbärmlichen Umständen lebt, die Existenz dieser Umstände und der Menschen, die unter ihnen zu leiden haben, anerkennen? Doch damit ging eine bedrohliche Botschaft über missverstandene oder falsch zugewiesene Identität einher, die kurz die Städte erleuchtete wie ein Flutlicht auf einer Baustelle: 'Wir werden genau so werden, wir ihr glaubt, dass wir sind - ihr werdet schon sehen.' Das ist die defensiv-aggressive Strategie, die Sartre in Genets zur Schau gestellter Kriminalität erkannte."
In einem Tagebuch aus Paris schreibt Jeremy Harding über die Revolte in den Vorstädten: "Wir sollten nicht immer erwarten, dass ein Krawall etwas zu bedeuten hat. Tatsächlich wehte ein Hauch von Karneval über der Zerstörung in Frankreich ... Die Frage schien jedoch vor allem zu sein: Ist irgendjemand da draußen? Würde irgendjemand, der nicht von maghrebinischen oder subsaharischen Immigranten abstammt und in erbärmlichen Umständen lebt, die Existenz dieser Umstände und der Menschen, die unter ihnen zu leiden haben, anerkennen? Doch damit ging eine bedrohliche Botschaft über missverstandene oder falsch zugewiesene Identität einher, die kurz die Städte erleuchtete wie ein Flutlicht auf einer Baustelle: 'Wir werden genau so werden, wir ihr glaubt, dass wir sind - ihr werdet schon sehen.' Das ist die defensiv-aggressive Strategie, die Sartre in Genets zur Schau gestellter Kriminalität erkannte." Weitere Artikel: Wie konnte es in der irischen Diözese Ferns zu so zahlreichen Fällen von sexuellem Missbrauch durch Priester kommen? Der "Ferns Report" versucht dies zu klären. Colm Toibin befällt bei der Lektüre blankes Entsetzten. Denn der Bericht offenbare viel mehr als nur die Schwäche des Fleisches: die uneingeschränkte und selbstherrliche Macht der katholischen Kirche in Irland. Adam Philips liest Bret Easton Ellis' autobiografisch geprägten und bestrickenden neuen Roman "Lunar Park" als die Geschichte einer erlernten Vorliebe für Unwirklichkeit. Jenny Turner hält Jeff Brittings Biografie der Philosophin Ayn Rand für zu treuherzig. Und schließlich wehrt sich Craig Clunas gegen den allzu offensichtlichen Versuch der Ausstellung "The Three Emperors", den Nimbus der Vergangenheit dem modernen chinesischen Staat zunutze zu machen.
Outlook India (Indien), 05.12.2005
 Diese Ausgabe ist ganz den indischen Frauen gewidmet, die auf dem Subkontinent immer einflussreicher werden. So schaffen arbeitende Mütter eine Mama-Industrie, weiß Saumya Roy, weil sie ihr Geld vor allem in ihre Kinder investieren, von vedischen Mathekursen (Wikipedia) bis zu riesigen Geburtstagsfeiern. "In Delhi bieten Partyunternehmen eine ganze Reihe an Attraktionen an, von einem Riesenrad für 6.000 Rupien (111 Euro) bis zu einem Darsteller, der für 3.500 Rupien Hindi-Filmschauspieler nachmacht. Der Geburtstagspartymarkt ist groß genug, dass Cartoon Network, der größte Kinderkanal, einsteigen will. Ab nächstem Jahr wird der Sender Power Puff Girls und Dexter Cartoon Partys anbieten, mit Comicfiguren, Deko, Geschirr, und Geschenken für alle, mit Preisen ab 13.000 Rupien für eine Feier mit 30 Kindern." Da gibt es noch genug kleine Kunden.
Diese Ausgabe ist ganz den indischen Frauen gewidmet, die auf dem Subkontinent immer einflussreicher werden. So schaffen arbeitende Mütter eine Mama-Industrie, weiß Saumya Roy, weil sie ihr Geld vor allem in ihre Kinder investieren, von vedischen Mathekursen (Wikipedia) bis zu riesigen Geburtstagsfeiern. "In Delhi bieten Partyunternehmen eine ganze Reihe an Attraktionen an, von einem Riesenrad für 6.000 Rupien (111 Euro) bis zu einem Darsteller, der für 3.500 Rupien Hindi-Filmschauspieler nachmacht. Der Geburtstagspartymarkt ist groß genug, dass Cartoon Network, der größte Kinderkanal, einsteigen will. Ab nächstem Jahr wird der Sender Power Puff Girls und Dexter Cartoon Partys anbieten, mit Comicfiguren, Deko, Geschirr, und Geschenken für alle, mit Preisen ab 13.000 Rupien für eine Feier mit 30 Kindern." Da gibt es noch genug kleine Kunden.In die Riege der 12 beliebtesten Frauen wurden eine Tennisspielerin, zwei Schauspielerinnen und ansonsten nur ernstzunehmende Unternehmerinnen, Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen gewählt. Bei den Männern dominiert die Oberfläche: die öde Vorherrschaft der Schauspieler wird durch einen Fernsehjournalisten, drei Kricketspieler und einen Sänger nicht wirklich in Gefahr gebracht.
Langsam werden auch Künstlerinnen akzeptabel, meldet Pramila N. Phatarphekar, die deren Sinn für Details als Wettbewerbsvorteil ausmacht. Namrata Joshi stellt Unternehmerinnen vor, die mit sicherem Geschäftssinn und wenig Respekt vor Geschlechtergrenzen Sicherheitsfirmen und Flugschulen gegründet haben. Und Shobita Dhar beobachtet, dass reiche Frauen richtig viel Geld nicht mehr nur für Kosmetik ausgeben.
Literaturen (Deutschland), 01.12.2005
 Das nahende Weihnachten veranlasst Literaturen, sich dem Christentum zuzuwenden. Rene Aguigah ist dem französischen Philosophen Jean-Luc Nancy begegnet und hat auf seine Frage, ob Christentum und Philosophie miteinander vereinbar sind, einen ganzen Fächer an Antworten bekommen. "Wenn christlich sein - oder jüdisch oder muslimisch oder buddhistisch - die Unterwerfung des Denkens unter eine bestimmte Wahrheitsordnung bezeichnet, wenn christlich sein heißt: glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat und so weiter, dann muss ich sagen: Nein, man kann nicht sowohl gläubiger Christ als auch Philosoph sein. Das ist absolut unmöglich. Das Denken beginnt damit, jede Unterwerfung unter eine derartige Gegebenheit zu verweigern." Andererseits: "Es gibt keine Philosophie, die nicht zuvor auch eine Theologie gewesen ist, selbst wenn es Theologie im Zeitalter von Gottes Tod sein mag." Was aber lässt sich aus alledem schließen, wenn, wie Nancy behauptet, "Monotheismus in Wahrheit Atheismus" ist?
Das nahende Weihnachten veranlasst Literaturen, sich dem Christentum zuzuwenden. Rene Aguigah ist dem französischen Philosophen Jean-Luc Nancy begegnet und hat auf seine Frage, ob Christentum und Philosophie miteinander vereinbar sind, einen ganzen Fächer an Antworten bekommen. "Wenn christlich sein - oder jüdisch oder muslimisch oder buddhistisch - die Unterwerfung des Denkens unter eine bestimmte Wahrheitsordnung bezeichnet, wenn christlich sein heißt: glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat und so weiter, dann muss ich sagen: Nein, man kann nicht sowohl gläubiger Christ als auch Philosoph sein. Das ist absolut unmöglich. Das Denken beginnt damit, jede Unterwerfung unter eine derartige Gegebenheit zu verweigern." Andererseits: "Es gibt keine Philosophie, die nicht zuvor auch eine Theologie gewesen ist, selbst wenn es Theologie im Zeitalter von Gottes Tod sein mag." Was aber lässt sich aus alledem schließen, wenn, wie Nancy behauptet, "Monotheismus in Wahrheit Atheismus" ist?Weitere Artikel: Im Kriminal erklärt Franz Schuh, dass es Kjell Erikssons meisterhaft trübseligem Krimi "Die grausamen Sterne der Nacht" zu verdanken ist, dass "das Gefühl, von schwedischer Kriminalliteratur bloß belästigt zu werden, ein wenig gewichen ist". In der Netzkarte stellt ein skeptischer Aram Lintzel die Webseite www.gott-ist-tot.de vor, die mit der Bibel (und gleichzeitig mit dem Glauben) abzurechnen glaubt, indem sie ihr all ihre Widersprüche und sonstige Fehler nachweist. Aus London rekapituliert David Flusfeder die zwei Überraschungen der diesjährigen Preisverleiher-Saison: John Banville - der für seinen bewunderns- aber nicht liebenswerten Roman "The Sea" den Man-Booker-Preis erhielt - und Harold Pinter, dem der Nobelpreis für Literatur zuteil wurde. In Literatur im Kino findet Joseph Vilsmaiers nutzlos modernisierte Verfilmung von Adalbert Stifters Erzählung "Bergkristall" in Daniel Kothenschulte ihren Henker. Und schließlich gibt die Literaturen-Redaktion Empfehlungen zum weihnachtlichen Lesen und Schenken.
Elet es Irodalom (Ungarn), 25.11.2005
 "Hinter der Darstellung der Einwanderer als homogene Masse verbirgt sich die Betonung der symbolischen Überlegenheit der Europäer", meint der Kulturanthropologe Peter Niedermüller. "Auch unter den Einwanderern gibt es religiöse Fanatiker, allgemeingefährliche Kriminelle, Männer und Frauen, deren Leben auf die schiefe Bahn geraten ist und Familien, in denen Frauen nur Erniedrigung, Unterdrückung und Gewalt zuteil wird. Aber es ist doch unverkennbar, dass die gleichen Probleme leider auch in den europäischen Mehrheitsgesellschaften vorhanden sind. Die unsere modernen Gesellschaften durchdringende häusliche Gewalt identifizieren wir auch nicht mit dem europäischen Christentum, auch jene Männer nicht, die ihre Kinder und Frauen regelmäßig schlagen oder minderjährige Mädchen und Jungen belästigen, vergewaltigen. Genauso wenig identifizieren wir pädophile Priester mit der katholischen Kirche, und so dürfen wir einzelne Formen des radikalen sozialen Verhaltens auf keinen Fall mit den Einwanderern und dem Islam identifizieren."
"Hinter der Darstellung der Einwanderer als homogene Masse verbirgt sich die Betonung der symbolischen Überlegenheit der Europäer", meint der Kulturanthropologe Peter Niedermüller. "Auch unter den Einwanderern gibt es religiöse Fanatiker, allgemeingefährliche Kriminelle, Männer und Frauen, deren Leben auf die schiefe Bahn geraten ist und Familien, in denen Frauen nur Erniedrigung, Unterdrückung und Gewalt zuteil wird. Aber es ist doch unverkennbar, dass die gleichen Probleme leider auch in den europäischen Mehrheitsgesellschaften vorhanden sind. Die unsere modernen Gesellschaften durchdringende häusliche Gewalt identifizieren wir auch nicht mit dem europäischen Christentum, auch jene Männer nicht, die ihre Kinder und Frauen regelmäßig schlagen oder minderjährige Mädchen und Jungen belästigen, vergewaltigen. Genauso wenig identifizieren wir pädophile Priester mit der katholischen Kirche, und so dürfen wir einzelne Formen des radikalen sozialen Verhaltens auf keinen Fall mit den Einwanderern und dem Islam identifizieren."Die ungarische Psychologin und Wahlberlinerin Eszter Fischer berichtet über den Alltag in Berliner Schulen, in die fast nur die Kinder der Einwanderer gehen: "In Deutschland - wie in Ungarn - bestimmt der familiäre Hintergrund die Chancen der Kinder in der Schule extrem, die sozialen Faktoren entscheiden darüber, welche Ausbildung und Qualifikation sie später erwerben. ... Die Schule in Deutschland ist wie ein Laufband: wer nur einmal heruntergetreten oder -gefallen ist, der wird nie wieder aus eigener Kraft zurückklettern können."
Espresso (Italien), 01.12.2005
 Umberto Eco vermittelt im Streit um das intelligente Design, das die USA und nun auch Italien beschäftigt. Schöpfung und Evolution sind miteinander vereinbar, es kann Plan und Zufall gleichzeitig geben, meint Eco und verweist auf die Kunst der Renaissance. "Denken wir an die edelste Idee, die wir von einem intelligenten Design haben, denken wir an ein Werk der Kunst. Es ist Michelangelo, der uns in einem seiner berühmten Sonette sagt, dass der Künstler, wenn er vor einem Marmorblock steht, nicht von Anfang an die Statue vor sich sieht, die daraus hervorgehen wird. Vielmehr unternimmt er Versuche, erprobt die Widerstände im Material, versucht das 'Überflüssige' wegzunehmen, um nach und nach die Staue von dem Material freizulegen, das sie gefangengehalten hat."
Umberto Eco vermittelt im Streit um das intelligente Design, das die USA und nun auch Italien beschäftigt. Schöpfung und Evolution sind miteinander vereinbar, es kann Plan und Zufall gleichzeitig geben, meint Eco und verweist auf die Kunst der Renaissance. "Denken wir an die edelste Idee, die wir von einem intelligenten Design haben, denken wir an ein Werk der Kunst. Es ist Michelangelo, der uns in einem seiner berühmten Sonette sagt, dass der Künstler, wenn er vor einem Marmorblock steht, nicht von Anfang an die Statue vor sich sieht, die daraus hervorgehen wird. Vielmehr unternimmt er Versuche, erprobt die Widerstände im Material, versucht das 'Überflüssige' wegzunehmen, um nach und nach die Staue von dem Material freizulegen, das sie gefangengehalten hat."Der Economist-Chefredakteur Bill Emmott liest der italienischen Politik im Nachrichtenteil die Leviten und erklärt Annalisa Piras (parallel zu einer Artikelserie im eigenen Blatt), warum Italien in Europa am langsamsten wächst, warum es so wettbewerbsfähig wie Botswana ist und warum die dritthöchste Schuldenquote der Welt bald zum Zusammenbruch führen könnte. Gianluca Di Feo erfährt aus einem Interview, das der ehemalige Luftwaffenchef Basilio Cottone einem Online-Forum gegeben hat, dass der libysche Scud-Angriff auf Lampedusa 1986, der bis dato einzige Raketenangriff auf ein westliches Land, vermutlich eine Fälschung war. Und zwar von europäischen und amerikanischen Geheimdiensten, die Italiens Offenheit gegenüber Libyen störte.
In der Titelgeschichte berichtet Riccardo Bocca über Aids in Italien, das mittlerweile vor allem im heterosexuellen Bürgertum wütet.
Nouvel Observateur (Frankreich), 28.11.2005
 In einem Debattenbeitrag kommentiert der amerikanische Ökonom Jeremy Rifkin die französischen Vorstadtkrawalle und zieht Vergleiche zu amerikanischen Getto-Aufständen. So habe man in Frankreich im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten durchaus noch Anlass zu Hoffnung, weil die benachteiligten Jugendlichen immer noch hofften, sich in die Gesellschaft integrieren zu können. "Wenn sie das eines Tages nicht mehr interessiert, muss man sich wirklich Sorgen machen. Das hat sich in den USA gezeigt." Rifkin empfiehlt Frankreich, aus den "Fehlern der USA zu lernen" und "die Gelegenheit zu nutzen, eine nationale Debatte zu führen. Man sollte ernsthaft die Bildung einer unabhängigen Kommission mit Vertretern aller gesellschaftlichen Gruppen einschließlich der benachteiligten Kommunen in Erwägung ziehen, die sich mit dem Schicksal der Jugendlichen beschäftigt. Am wichtigsten ist es, den Beschwerden der Jugendlichen endlich Aufmerksamkeit zu schenken und gemeinsam mit ihnen geeignete Reformen auf den Weg zu bringen, die ihre Situation verbessern."
In einem Debattenbeitrag kommentiert der amerikanische Ökonom Jeremy Rifkin die französischen Vorstadtkrawalle und zieht Vergleiche zu amerikanischen Getto-Aufständen. So habe man in Frankreich im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten durchaus noch Anlass zu Hoffnung, weil die benachteiligten Jugendlichen immer noch hofften, sich in die Gesellschaft integrieren zu können. "Wenn sie das eines Tages nicht mehr interessiert, muss man sich wirklich Sorgen machen. Das hat sich in den USA gezeigt." Rifkin empfiehlt Frankreich, aus den "Fehlern der USA zu lernen" und "die Gelegenheit zu nutzen, eine nationale Debatte zu führen. Man sollte ernsthaft die Bildung einer unabhängigen Kommission mit Vertretern aller gesellschaftlichen Gruppen einschließlich der benachteiligten Kommunen in Erwägung ziehen, die sich mit dem Schicksal der Jugendlichen beschäftigt. Am wichtigsten ist es, den Beschwerden der Jugendlichen endlich Aufmerksamkeit zu schenken und gemeinsam mit ihnen geeignete Reformen auf den Weg zu bringen, die ihre Situation verbessern." Al Ahram Weekly (Ägypten), 24.11.2005
 Am 29. November wird das Internationale Filmfestival von Kairo mit Zhang Yimous "House of Flying Daggers" eröffnet. Mohamed El-Assyouti stellt das Programm vor.
Am 29. November wird das Internationale Filmfestival von Kairo mit Zhang Yimous "House of Flying Daggers" eröffnet. Mohamed El-Assyouti stellt das Programm vor. Rania Gaafar unterhält sich mit dem ägyptisch-deutschen Filmemacher Samir Nasr, dessen Film "Folgeschäden" auf dem Festival gezeigt wird. Es geht um die Geschichte von Tariq, einem algerischen Wissenschaftler, der in Deutschland lebt, mit der Deutschen Maya verheiratet ist, und in der Atmosphäre nach dem 11. September von Bekannten und Polizei verdächtigt wird, ein Terrorist zu sein. "Der Zuschauer sieht die ganze Geschichte mit Mayas Augen. Sie ist die Hauptperson, die eine schmerzhafte Entwicklung durchmacht - von der liebenden Ehefrau zum Polizeispitzel - und schließlich feststellen muss, dass sie einen Fehler gemacht hat. Der Zuschauer identifiziert sich normalerweise mit der Person, die eine Entwicklung durchmacht", wird Nasr zitiert.
HVG (Ungarn), 24.11.2005
 Die Probleme der Roma in Osteuropa sind auch ein Schwerpunkt der Arbeit der Soros-Stiftung. György Soros, amerikanischer Milliardär ungarischer Abstammung, erklärt im Interview, warum: "In der Region haben es die slowakischen Roma am schwersten. Sie fliehen oft nach Tschechien und Ungarn und transportieren die Probleme über die Landesgrenzen... Aber auch in Ungarn haben sich die Vorurteile gegenüber den Roma kaum verringert. Ich hatte gerade ein schreckliches Erlebnis. 1944, während der Besatzung Ungarns durch die Nazis, hat eine sehr ehrbare, tief religiöse Frau meine Mutter und mich versteckt. Die Dame ist heute 90 Jahre alt. Bei meinem Besuch erzählte sie, dass sie - wie vor dem Krieg - die Tageszeitung Magyar Nemzet liest und den Ungarischen Rundfunk hört. Diese korrekte, anständige Frau äußerte plötzlich offen romafeindliche Meinungen. Roma lebten von Sozialhilfe und nutzen die Hilfsbereitschaft des Landes aus. Wer das anders sehe, sei ein Landesverräter."
Die Probleme der Roma in Osteuropa sind auch ein Schwerpunkt der Arbeit der Soros-Stiftung. György Soros, amerikanischer Milliardär ungarischer Abstammung, erklärt im Interview, warum: "In der Region haben es die slowakischen Roma am schwersten. Sie fliehen oft nach Tschechien und Ungarn und transportieren die Probleme über die Landesgrenzen... Aber auch in Ungarn haben sich die Vorurteile gegenüber den Roma kaum verringert. Ich hatte gerade ein schreckliches Erlebnis. 1944, während der Besatzung Ungarns durch die Nazis, hat eine sehr ehrbare, tief religiöse Frau meine Mutter und mich versteckt. Die Dame ist heute 90 Jahre alt. Bei meinem Besuch erzählte sie, dass sie - wie vor dem Krieg - die Tageszeitung Magyar Nemzet liest und den Ungarischen Rundfunk hört. Diese korrekte, anständige Frau äußerte plötzlich offen romafeindliche Meinungen. Roma lebten von Sozialhilfe und nutzen die Hilfsbereitschaft des Landes aus. Wer das anders sehe, sei ein Landesverräter." New York Times (USA), 27.11.2005
Jesus hat mit nichts mit dem Sohn Gottes zu tun, meint der Literaturkritiker Harold Bloom in "Jesus and Yahweh", das Jonathan Rosen schon allein wegen der Fülle an Ideen und Widersprüchen empfehlen möchte. "Jesus Christus ist im Gegensatz zu Jesus ein späteres theologisches Konstrukt, das sehr hellenistisch anmutet. Christus ist für Bloom ein Betrug an Jesus dem Menschen, Yeshua, der offensichtlich in einer jüdischen Welt lebte, an den Bund mit Yahweh glaubte, die Gesetze nicht für tödlich hielt und erschrocken oder zumindest verwundert gewesen wäre über die Religion, die in seinem Namen entstand."
Zwei große, schwere und vielleicht endgültige Biografien gibt es diese Woche anzuzeigen. Mit seinen fast 1.000 Seiten mutet Bob Spitz' "The Beatles" wie eine Bibel an (erstes Kapitel), die Geschichte einer Band, die zeitweise bekannter war als Jesus. Und dazu noch durchgängig mit einem Verve geschrieben, der Jean und Michael Stern ab Seite zehn nicht mehr losgelassen hat. John Simon schwärmt haltlos von Richard Schickels Biografie des Regisseurs Elia Kazan (Filme). Hier stimme alles: gesunde Distanz, ertragreiche Nähe, ausreichend viele Details, aber auch die notwendige Diskretion.
Weiteres: Terence Rafferty vermutet, dass John Banville mit "The Sea" (erstes Kapitel) eine "schlaue Parodie auf jene Art von englischen Roman geschrieben hat, die hingerissene Rezensionen im Guardian und Independent einfährt, zu einem stillen, geschmackvollen Film mit Harold Pinter-Drehbuch gemacht wird und den Man Booker Preis gewinnt". David Lipsky findet Robert Kaplans "Imperial Grunts" (erstes Kapitel), für das der Autor das militärgestützte amerikanische Imperium abreiste, ein wenig zu kriegsbegeistert geworden.
Das New York Times Magazine: So schlecht sind die Innenstadtghettos der USA doch nicht, schließt Christopher Caldwell aus den Unruhen in den Banlieues. Der Beweis ist Marseille. Ausgerechnet die Stadt mit den meisten Immigranten sei von den Unruhen verschont geblieben. "Marseille ist nicht wie die meisten französischen Städte, in denen der Stadtkern aus peinlich gepflegten architektonischen Schätzen besteht und die Unordnung an den Rand geschoben wird. Es ist von innen nach außen gestülpt, so dass die 'Innenstadt' und 'Vorstadt' ihren amerikanischen Pendants ähneln. Das könnte Marseille eine Menge Probleme erspart haben."
Ein knappes Jahr nach dem Tsunami besucht Barry Bearak die schwer getroffene indonesische Stadt Banda Aceh, in der allein 90.000 Menschen umkamen. Seine epische Reportage füllt in vier Teilen nahezu das ganze Heft. Gary Rosen kommt von Kazuo Ishiguros "Alles, was wir geben mussten" zur gegenwärtigen Debatte über das therapeutische Klonen in Washington. Und natürlich das elfte Kapitel von Elmore Leonards Fortsetzungsgeschichte "Comfort to the Enemy".
Zwei große, schwere und vielleicht endgültige Biografien gibt es diese Woche anzuzeigen. Mit seinen fast 1.000 Seiten mutet Bob Spitz' "The Beatles" wie eine Bibel an (erstes Kapitel), die Geschichte einer Band, die zeitweise bekannter war als Jesus. Und dazu noch durchgängig mit einem Verve geschrieben, der Jean und Michael Stern ab Seite zehn nicht mehr losgelassen hat. John Simon schwärmt haltlos von Richard Schickels Biografie des Regisseurs Elia Kazan (Filme). Hier stimme alles: gesunde Distanz, ertragreiche Nähe, ausreichend viele Details, aber auch die notwendige Diskretion.
Weiteres: Terence Rafferty vermutet, dass John Banville mit "The Sea" (erstes Kapitel) eine "schlaue Parodie auf jene Art von englischen Roman geschrieben hat, die hingerissene Rezensionen im Guardian und Independent einfährt, zu einem stillen, geschmackvollen Film mit Harold Pinter-Drehbuch gemacht wird und den Man Booker Preis gewinnt". David Lipsky findet Robert Kaplans "Imperial Grunts" (erstes Kapitel), für das der Autor das militärgestützte amerikanische Imperium abreiste, ein wenig zu kriegsbegeistert geworden.
Das New York Times Magazine: So schlecht sind die Innenstadtghettos der USA doch nicht, schließt Christopher Caldwell aus den Unruhen in den Banlieues. Der Beweis ist Marseille. Ausgerechnet die Stadt mit den meisten Immigranten sei von den Unruhen verschont geblieben. "Marseille ist nicht wie die meisten französischen Städte, in denen der Stadtkern aus peinlich gepflegten architektonischen Schätzen besteht und die Unordnung an den Rand geschoben wird. Es ist von innen nach außen gestülpt, so dass die 'Innenstadt' und 'Vorstadt' ihren amerikanischen Pendants ähneln. Das könnte Marseille eine Menge Probleme erspart haben."
Ein knappes Jahr nach dem Tsunami besucht Barry Bearak die schwer getroffene indonesische Stadt Banda Aceh, in der allein 90.000 Menschen umkamen. Seine epische Reportage füllt in vier Teilen nahezu das ganze Heft. Gary Rosen kommt von Kazuo Ishiguros "Alles, was wir geben mussten" zur gegenwärtigen Debatte über das therapeutische Klonen in Washington. Und natürlich das elfte Kapitel von Elmore Leonards Fortsetzungsgeschichte "Comfort to the Enemy".
New Yorker | London Review of Books | Outlook India | Literaturen | Elet es Irodalom | Espresso | Nouvel Observateur | Al Ahram Weekly | HVG | New York Times | Merkur | Weltwoche | Economist | Spiegel | Spectator | Point | New Republic