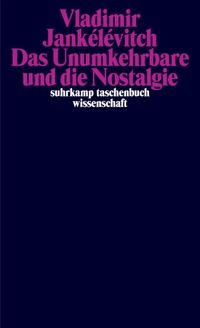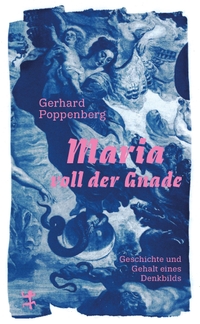Magazinrundschau
Is it possible? It's Günter Grass!
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
21.04.2015. Der Völkermord an den Armeniern war eben das: ein Völkermord, notiert die Financial Times. Auch Israel sollte das als Tatsache anerkennen, meint Tablet. Die NYRB erzählt, wie ukrainische Oligarchen die Ostukraine unterstützen. In Eurozine warnt Mykola Riabchuk vor einem neuen Totalitarismus in der Ukraine. In der LRB fragt sich Christopher Clark, wer Kaiser Wilhelm II. ganz ernst nahm. La Vie des idees fordert mehr künstlerischen Patriotismus. Pitchfork sucht den Wert der Musik. Und Aeon fragt: Warum explodieren unsere Gehirne nicht, wenn wir Filme sehen?
Financial Times (UK), 17.04.2015
 David Gardner liest für die Financial Times einige Neuerscheinungen zum Völkermord an den Armeniern und findet eben diesen Begriff des Völkermords unabweisbar. Auch "Argumente der Jungtürken, die Armenier hätten sich mit den Russen verbündet, um dem Reich in den Rücken zu fallen, halten einer näheren Untersuchung nicht stand - trotz der Hoffnungen mancher Armenier und der skrupellosen Einmischung europäischer Mächte. Die meisten Armenier fürchteten eine Russifizierung so sehr wie eine Turkifizierung und blieben loyal, so sehr, dass sie sich trotz der Pogrome von 1894 bis 96 und 1909 nicht vorstellen konnten, wie ihnen geschehen würde."
David Gardner liest für die Financial Times einige Neuerscheinungen zum Völkermord an den Armeniern und findet eben diesen Begriff des Völkermords unabweisbar. Auch "Argumente der Jungtürken, die Armenier hätten sich mit den Russen verbündet, um dem Reich in den Rücken zu fallen, halten einer näheren Untersuchung nicht stand - trotz der Hoffnungen mancher Armenier und der skrupellosen Einmischung europäischer Mächte. Die meisten Armenier fürchteten eine Russifizierung so sehr wie eine Turkifizierung und blieben loyal, so sehr, dass sie sich trotz der Pogrome von 1894 bis 96 und 1909 nicht vorstellen konnten, wie ihnen geschehen würde." Außerdem in der Financial Times: ein langes Porträt des Erfinders, Designers und Revolutionärs mancher Elektrogeräte James Dyson.
Tablet (USA), 20.04.2015
 Viele jüdische Autoren haben zur Erforschung des Völkermords an den Armeniern beigetragen, schreibt Peter Balakian im jüdischen Tablet Mag, aber Israel hat sich aus politischen Gründen bis heute geweigert, den Völkermord beim Namen zu nennen. "Könnte der hundertste Jahrestag des armenischen Genozids - der aus Ironie der Geschichte mit dem Niedergang der türkisch-israelischen Beziehungen zusammenfällt - Gelegenheit sein, die moralischen Konzessionen zu überdenken, die Israel in dieser Frage macht? Angesichts der unermüdlichen türkischen Kampagne zur Leugnung des Genozids und zur Durchsetzung seines Geschichtsbilds in den demokratischen Gesellschaften auf der ganzen Welt hätte eine israelische Anerkennung der Tatsachen einen wichtige ethische Bedeutung."
Viele jüdische Autoren haben zur Erforschung des Völkermords an den Armeniern beigetragen, schreibt Peter Balakian im jüdischen Tablet Mag, aber Israel hat sich aus politischen Gründen bis heute geweigert, den Völkermord beim Namen zu nennen. "Könnte der hundertste Jahrestag des armenischen Genozids - der aus Ironie der Geschichte mit dem Niedergang der türkisch-israelischen Beziehungen zusammenfällt - Gelegenheit sein, die moralischen Konzessionen zu überdenken, die Israel in dieser Frage macht? Angesichts der unermüdlichen türkischen Kampagne zur Leugnung des Genozids und zur Durchsetzung seines Geschichtsbilds in den demokratischen Gesellschaften auf der ganzen Welt hätte eine israelische Anerkennung der Tatsachen einen wichtige ethische Bedeutung."New York Review of Books (USA), 07.05.2015
 Tim Judah berichtet, wie sich die Ukraine auf einen langen Konflikt vorbereitet. In Kiew ist die Stimmung düster, im Osten den Landes nutzen beide Seiten den Waffenstillstand, um sich für die nächsten Kämpfe zu rüsten. Und was machen die Oligarchen in London? "Donezk ist die Heimatstadt und das geschäftliche Kernland von Rinat Achmetow, dem reichsten Oligarchen der Ukraine. Letzten Sommer drohten die Rebellen, seinen Besitz zu beschlagnahmen, die Kohleminen und die Stahlwerke, taten am Ende aber nichts dergleichen. Achmetow beschäftigt ungefähr 300.000 Menschen. Als der Krieg ausbrach, behaupteten einige, dass der Oligarch, der dem geschassten Präsidenten Viktor Janukowitsch nahestand, die Separatisten unterstützt habe, um seine Interessen zu wahren. Dafür gab es nie Beweise. Doch während das Management seiner Firmen Donezk verlassen hat, werden alle Arbeiter, die sich weiterhin im Rebellengebiet befinden, weiterbezahlt, auch wenn die meisten Minen oder Fabriken nicht weiterlaufen. Achmetow hilft auch, Zehntausende von Menschen durch humanitäre Lieferungen zu ernähren. Wenn er das nicht täte, müssten sich die Rebellen und Russland um die Leute kümmern."
Tim Judah berichtet, wie sich die Ukraine auf einen langen Konflikt vorbereitet. In Kiew ist die Stimmung düster, im Osten den Landes nutzen beide Seiten den Waffenstillstand, um sich für die nächsten Kämpfe zu rüsten. Und was machen die Oligarchen in London? "Donezk ist die Heimatstadt und das geschäftliche Kernland von Rinat Achmetow, dem reichsten Oligarchen der Ukraine. Letzten Sommer drohten die Rebellen, seinen Besitz zu beschlagnahmen, die Kohleminen und die Stahlwerke, taten am Ende aber nichts dergleichen. Achmetow beschäftigt ungefähr 300.000 Menschen. Als der Krieg ausbrach, behaupteten einige, dass der Oligarch, der dem geschassten Präsidenten Viktor Janukowitsch nahestand, die Separatisten unterstützt habe, um seine Interessen zu wahren. Dafür gab es nie Beweise. Doch während das Management seiner Firmen Donezk verlassen hat, werden alle Arbeiter, die sich weiterhin im Rebellengebiet befinden, weiterbezahlt, auch wenn die meisten Minen oder Fabriken nicht weiterlaufen. Achmetow hilft auch, Zehntausende von Menschen durch humanitäre Lieferungen zu ernähren. Wenn er das nicht täte, müssten sich die Rebellen und Russland um die Leute kümmern." Weiteres: Thomas Powers bewundert in einer Ausstellung in New Yorker Metropolitan Museum die Kunst der Prärie-Indianer, wie zum Beispiel Howling Wolfs Erinnerung an das Sand Creek Massacre. Freeman Dyson liest eine neue Einstein-Biografie von Steven Gimble. Und Annie Sparrow geht Hinweisen nach, dass das Assads Regime seine Chlorbestände für Kampfeinsätze benutzt, anstatt damit Trinkwasser zu reinigen.
Weiteres: Thomas Powers bewundert in einer Ausstellung in New Yorker Metropolitan Museum die Kunst der Prärie-Indianer, wie zum Beispiel Howling Wolfs Erinnerung an das Sand Creek Massacre. Freeman Dyson liest eine neue Einstein-Biografie von Steven Gimble. Und Annie Sparrow geht Hinweisen nach, dass das Assads Regime seine Chlorbestände für Kampfeinsätze benutzt, anstatt damit Trinkwasser zu reinigen.Eurozine (Österreich), 15.04.2015
 In Krisenzeiten droht Totalitarismus, warnt Mykola Rjabtschuk in Eurozine. Da Extremisten keine Skrupel kennen, erreichen sie schnelle Siege. Die Situation ist in der Ukraine nicht neu: "In dem klassischen Film "Arsenal" von Oleksandr Dowschenko aus dem Jahr 1929 gibt es eine anschauliche Szene, in der ein Beamter der Ukrainischen Volksrepublik, ein Intellektueller der alten Schule mit runder Brille, den Versuch unternimmt, einen bolschewistischen Saboteur zu exekutieren, es aber nicht über sich bringen kann, ihm ins Gesicht zu schießen, und ihn daher auffordert, sich mit dem Gesicht zur Wand zu drehen. Der Bolschewik spürt die Schwäche des Intellektuellen und weigert sich hartnäckig, ihm den Rücken zuzudrehen. "Schieß mir ins Gesicht!", verlangt er, und da sein potenzieller Exekutor noch immer zögert, geht der Bolschewik auf ihn zu, nimmt ihm die Pistole aus der Hand und sagt verächtlich: "So ist es also, du kannst nicht? Ich aber schon!" Er tötet seinen Gegenspieler, ohne Reue, ohne zu zögern und ohne einen einzigen Gedanken an den absoluten Wert des menschlichen Lebens zu verschwenden."
In Krisenzeiten droht Totalitarismus, warnt Mykola Rjabtschuk in Eurozine. Da Extremisten keine Skrupel kennen, erreichen sie schnelle Siege. Die Situation ist in der Ukraine nicht neu: "In dem klassischen Film "Arsenal" von Oleksandr Dowschenko aus dem Jahr 1929 gibt es eine anschauliche Szene, in der ein Beamter der Ukrainischen Volksrepublik, ein Intellektueller der alten Schule mit runder Brille, den Versuch unternimmt, einen bolschewistischen Saboteur zu exekutieren, es aber nicht über sich bringen kann, ihm ins Gesicht zu schießen, und ihn daher auffordert, sich mit dem Gesicht zur Wand zu drehen. Der Bolschewik spürt die Schwäche des Intellektuellen und weigert sich hartnäckig, ihm den Rücken zuzudrehen. "Schieß mir ins Gesicht!", verlangt er, und da sein potenzieller Exekutor noch immer zögert, geht der Bolschewik auf ihn zu, nimmt ihm die Pistole aus der Hand und sagt verächtlich: "So ist es also, du kannst nicht? Ich aber schon!" Er tötet seinen Gegenspieler, ohne Reue, ohne zu zögern und ohne einen einzigen Gedanken an den absoluten Wert des menschlichen Lebens zu verschwenden."Außerdem in Eurozine: Der Osteuropaforscher Nikolay Mitrokhin erzählt, wie russische Intellektuelle auf die Charlie-Hebdo-Massaker reagierten. Und Simon Davies fürchtet stärkere Überwachung in Europa nach den Terrorattentaten von Paris und Kopenhagen.
HVG (Ungarn), 21.04.2015
Der Theaterregisseur und Hochschullehrer Tamás Ascher, bis zum letzten Jahr Rektor der Budapester Universität für Theater- und Filmkunst (SZFE), feierte kürzlich seinen sechsundsechzigsten Geburtstag. Im Gespräch mit Rita Szentgyörgyi klagt er über die immer erdrückenderen Bruchlinien entlang der politischen Lager in der ungarischen Theaterlandschaft: "Dass Lügen, Halbwahrheiten und Beschuldigungen zu großen Theorien aufgebaut werden, ist unerträglich. Dahinter steckt nichts als Unersättlichkeit, Raumbesetzungsbedürfnis und Verletztheit. Ähnliche Situationen erlebte ich auch vor der Wende. Damals wurden Künstlergemeinschaften, die den Servilismus ablehnten, unter dem Vorwand gepeinigt, den Sozialismus zu verteidigen. Heute ist es die Nation. Damals beschuldigte man mich, den Westen nachzuäffen oder einfach, ein Liberaler zu sein. Die Freiheit als wichtigster Referenzpunkt war in der Kádár-Ära genauso ein rotes Tuch wie heute.
London Review of Books (UK), 20.04.2015
 John Röhls vielfach gepriesene Biografie Kaiser Wilhelms II. ist jetzt auch auf Englisch erschienen. Christopher Clark ist vom dritten Band ("Der Weg in den Abgrund") beeindruckt, aber nicht überzeugt. Der deutsche Kaiser, meint Clark, sei zwar wirklich ein penetranter und aggressiver Kriegstreiber gewesen, aber es hätte ihn doch niemand ernst genommen: "Hatte der Kaiser wirklich so große Macht? Wie entscheidend waren seine Interventionen für die deutsche Außenpolitik? Das Haupthindernis in der Beantwortung dieser Frage ist schlicht und einfach, dass Wilhelms Ziele alles andere als beständig waren. Wenn er im Laufe seiner Amtszeit eine klare und konsistente Politik verfolgte hätte, könnten wir seine Intentionen mit dem Ergebnis vergleichen und so seinen Einfluss messen. Doch mit seinen Interventionen schoss Wilhelm oft aus der Hüfte, seine Ziele waren diffus und veränderten sich stetig. Empört über einen Streik von Berliner Straßenbahnarbeitern schickte der Kaiser 1900 ein Telegramm an den Kommandanten des Gardekorps: "Wenn die Truppe ausrückt, erwarte ich mindestens 500 Tote" - eine so ungeheuerliche Forderung, dass niemandem im Traum einfiel, ihr tatsächlich nachzukommen."
John Röhls vielfach gepriesene Biografie Kaiser Wilhelms II. ist jetzt auch auf Englisch erschienen. Christopher Clark ist vom dritten Band ("Der Weg in den Abgrund") beeindruckt, aber nicht überzeugt. Der deutsche Kaiser, meint Clark, sei zwar wirklich ein penetranter und aggressiver Kriegstreiber gewesen, aber es hätte ihn doch niemand ernst genommen: "Hatte der Kaiser wirklich so große Macht? Wie entscheidend waren seine Interventionen für die deutsche Außenpolitik? Das Haupthindernis in der Beantwortung dieser Frage ist schlicht und einfach, dass Wilhelms Ziele alles andere als beständig waren. Wenn er im Laufe seiner Amtszeit eine klare und konsistente Politik verfolgte hätte, könnten wir seine Intentionen mit dem Ergebnis vergleichen und so seinen Einfluss messen. Doch mit seinen Interventionen schoss Wilhelm oft aus der Hüfte, seine Ziele waren diffus und veränderten sich stetig. Empört über einen Streik von Berliner Straßenbahnarbeitern schickte der Kaiser 1900 ein Telegramm an den Kommandanten des Gardekorps: "Wenn die Truppe ausrückt, erwarte ich mindestens 500 Tote" - eine so ungeheuerliche Forderung, dass niemandem im Traum einfiel, ihr tatsächlich nachzukommen."Außerdem stecken die Briten mitten im Wahlkampf: James Meek berichtet aus Grimsby, dem einstigen Sitz der britischen ausgedienten Fischereiflotte. Weil die EU vor zwanzig Jahren die Fangquoten regulierte, wählen die Leute dort jetzt alle Ukip. Richard Seymour fragt, worin die Labour Party eigentlich ihren Sinn sieht abgesehen, wenn sie alle konservativen Rezepte übernimmt.
Mother Jones (USA), 01.05.2015
 Allein mit Schusswaffen werden jedes Jahr über 11.000 Menschen in den USA ermordet, mehr als 20.000 begehen Selbstmord, annähernd 100.000 werden verletzt. Doch im Gegensatz zu Gefährdungen wie dem Straßenverkehr, Tabak, Übergewicht oder Krankheiten existieren keine Studien darüber, welche Kosten Schusswaffengewalt für die Allgemeinheit verursacht, berichten Mark Follman, Julia Lurie, Jaeaj Lee und James West. Gemeinsam mit dem Statistiker Ted Miller vom Pacific Institute for Research and Evaluation errechnen sie einen Betrag von 229 Milliarden Dollar pro Jahr: "Damit liegen die Kosten von mit Schusswaffen verübte Gewalttaten 47 Milliarden über dem weltweiten Jahresgewinn von Apple und 88 Milliarden über dem gesamten Bildungsbudget der USA. Verteilt man diese Zahl auf jeden Mann, jede Frau und jedes Kind des Landes, kämen jährlich über 700 Dollar pro Person zusammen... Dazu kommen Kosten, die von den verfügbaren Daten nicht erfasst werden. Was ist mit dem Trauma ganzer Gemeinschaften, ausgelöst von Massenschießereien oder chronischer Straßengewalt? Was ist mit den hohen sozialen Kosten der Angst, die die wirtschaftliche Entwicklung hemmt und immense Ausgaben für Sicherheit und Prävention nach sich zieht?"
Allein mit Schusswaffen werden jedes Jahr über 11.000 Menschen in den USA ermordet, mehr als 20.000 begehen Selbstmord, annähernd 100.000 werden verletzt. Doch im Gegensatz zu Gefährdungen wie dem Straßenverkehr, Tabak, Übergewicht oder Krankheiten existieren keine Studien darüber, welche Kosten Schusswaffengewalt für die Allgemeinheit verursacht, berichten Mark Follman, Julia Lurie, Jaeaj Lee und James West. Gemeinsam mit dem Statistiker Ted Miller vom Pacific Institute for Research and Evaluation errechnen sie einen Betrag von 229 Milliarden Dollar pro Jahr: "Damit liegen die Kosten von mit Schusswaffen verübte Gewalttaten 47 Milliarden über dem weltweiten Jahresgewinn von Apple und 88 Milliarden über dem gesamten Bildungsbudget der USA. Verteilt man diese Zahl auf jeden Mann, jede Frau und jedes Kind des Landes, kämen jährlich über 700 Dollar pro Person zusammen... Dazu kommen Kosten, die von den verfügbaren Daten nicht erfasst werden. Was ist mit dem Trauma ganzer Gemeinschaften, ausgelöst von Massenschießereien oder chronischer Straßengewalt? Was ist mit den hohen sozialen Kosten der Angst, die die wirtschaftliche Entwicklung hemmt und immense Ausgaben für Sicherheit und Prävention nach sich zieht?"Proceso (Mexiko), 18.04.2015
 Juan Alberto Cedillo berichtet von "Kollateralschäden" des Krieges der Drogenkartelle gegen die mexikanische Zivilgesellschaft: "Nach der Welle von Ermordungen und Entführungen von Universitätsangehörigen durch das organisierte Verbrechen im besonders stark vom Terror betroffenen Nordosten Mexikos wandern zahlreiche Studenten in andere Landesteile oder die USA ab. Ihre bisherigen Lehrstätten stellten derweil vorläufig oder auch endgültig den Lehrbetrieb ein. Manchen war von Angehörigen der Kartelle "Schutz" gegen monatliche Zahlungen von bis zu 350 000 Pesos angeboten worden. Die Zweigstelle der Universidad del Valle de México in Reynosa wurde mehrere Tage lang unter militärische Bewachung gestellt. Kaum waren die Soldaten wieder abgezogen, wurde der Campus von Kriminellen überfallen. Lehrer der Universidad Autónoma de Tamaulipas wiederum müssen regelmäßig Beträge an die Drogenkartelle abführen, während die Studenten gezwungen werden, Lose von Lotterien zu erwerben, deren Preise niemals ausbezalt werden."
Juan Alberto Cedillo berichtet von "Kollateralschäden" des Krieges der Drogenkartelle gegen die mexikanische Zivilgesellschaft: "Nach der Welle von Ermordungen und Entführungen von Universitätsangehörigen durch das organisierte Verbrechen im besonders stark vom Terror betroffenen Nordosten Mexikos wandern zahlreiche Studenten in andere Landesteile oder die USA ab. Ihre bisherigen Lehrstätten stellten derweil vorläufig oder auch endgültig den Lehrbetrieb ein. Manchen war von Angehörigen der Kartelle "Schutz" gegen monatliche Zahlungen von bis zu 350 000 Pesos angeboten worden. Die Zweigstelle der Universidad del Valle de México in Reynosa wurde mehrere Tage lang unter militärische Bewachung gestellt. Kaum waren die Soldaten wieder abgezogen, wurde der Campus von Kriminellen überfallen. Lehrer der Universidad Autónoma de Tamaulipas wiederum müssen regelmäßig Beträge an die Drogenkartelle abführen, während die Studenten gezwungen werden, Lose von Lotterien zu erwerben, deren Preise niemals ausbezalt werden."Rolling Stone (USA), 14.04.2015
 Andy Greene erzählt die immer noch zu schön um wahr zu seiende Geschichte des Bill Withers, der einige der schönsten Soul-Songs aller Zeiten schrieb und sang und dann von der Szenerie verschwand, weil er keine Lust mehr hatte auf das Pop-Business (jetzt wird er in die Rock"n"Roll-Hall of Fame aufgenommen). Er ist inzwischen 76. Mit Musik angefangen hat er überhaupt erst mit 29. Der Produzent Clarence Avant erkannte sein Talent und heuerte Booker T. Jones für die erste Studio-Sitzung an: "Jones, der berühmte Stax-Keyboarder blätterte durch sein Rolodex und heuerte die Creme der Los-Angeles-Szene an: als Drummer Jim Keltner, als Bassist Donald "Duck" Dunn, Stephen Stills an der Gitarre. "Bill kam in einer klapprigen Karre aus der Fabrik und hatte alte Brogan-Stiefel an, und er hatte ein Notizbuch voller Songs", sagt Jones. "Als er uns alle im Studio sah, wollte er kurz unter vier Augen mit mir sprechen und fragte: "Booker, wer wird die ganzen Songs denn singen?" Ich sagte: "Du, Bill." Er dachte, da käme noch ein Sänger. Withers fühlte sich sehr unsicher. Aber dann kam Graham Nash ins Studio: "Er setzte sich zu mir und sagte, Du weißt gar nicht, wie gut du bist", sagt Withers. "Das werde ich nie vergessen.""
Andy Greene erzählt die immer noch zu schön um wahr zu seiende Geschichte des Bill Withers, der einige der schönsten Soul-Songs aller Zeiten schrieb und sang und dann von der Szenerie verschwand, weil er keine Lust mehr hatte auf das Pop-Business (jetzt wird er in die Rock"n"Roll-Hall of Fame aufgenommen). Er ist inzwischen 76. Mit Musik angefangen hat er überhaupt erst mit 29. Der Produzent Clarence Avant erkannte sein Talent und heuerte Booker T. Jones für die erste Studio-Sitzung an: "Jones, der berühmte Stax-Keyboarder blätterte durch sein Rolodex und heuerte die Creme der Los-Angeles-Szene an: als Drummer Jim Keltner, als Bassist Donald "Duck" Dunn, Stephen Stills an der Gitarre. "Bill kam in einer klapprigen Karre aus der Fabrik und hatte alte Brogan-Stiefel an, und er hatte ein Notizbuch voller Songs", sagt Jones. "Als er uns alle im Studio sah, wollte er kurz unter vier Augen mit mir sprechen und fragte: "Booker, wer wird die ganzen Songs denn singen?" Ich sagte: "Du, Bill." Er dachte, da käme noch ein Sänger. Withers fühlte sich sehr unsicher. Aber dann kam Graham Nash ins Studio: "Er setzte sich zu mir und sagte, Du weißt gar nicht, wie gut du bist", sagt Withers. "Das werde ich nie vergessen."" Am berühmtesten sind natürlich "Ain"t No Sunshine" und "Lean on Me". Unser Lieblingssong ist aber "Use Me" (unübertrefflich die Studioaufnahme)! Hier in einer Live-Aufnahme der BBC:
La vie des idees (Frankreich), 17.04.2015
 Cristelle Terroni unterhält sich mit der Historikerin Anne Martin-Fugier über die Situation der zeitgenössischen Kunst in Frankreich. Martin-Fugier hat sich bereits in mehreren Büchern mit den Protagonisten der gegenwärtigen Szene beschäftigt. Dass sich französische Kunst international so schwer tut, liegt nach Ansicht der Künstler an den Institutionen, den Händlern, aber auch an ihnen selbst: "Bei uns existiert im Gegensatz zu Großbritannien, Deutschland oder den USA derzeit kein künstlerischer Patriotismus. Laut [dem Künstler] Claude Lévêque ist an dem berühmten amerikanischen Witz "Warum sollten wir eure Künstler ausstellen, wenn ihr sie nicht mal selber ausstellt?" durchaus etwas dran. Vor allem die Maler bekommen das schmerzhaft zu spüren: "Frankreich", sagt etwa Philippe Cognée, "ist fähig, uns Medaillen zu verleihen - mir hat man die Ehrenlegion angeboten! -, aber unfähig, darauf hinzuarbeiten, uns auf internationales Niveau zu heben, uns Sichtbarkeit zu verschaffen. Heutzutage ist die einzige Sichtbarkeit kommmerziell und läuft über Pinault oder Arnault.""
Cristelle Terroni unterhält sich mit der Historikerin Anne Martin-Fugier über die Situation der zeitgenössischen Kunst in Frankreich. Martin-Fugier hat sich bereits in mehreren Büchern mit den Protagonisten der gegenwärtigen Szene beschäftigt. Dass sich französische Kunst international so schwer tut, liegt nach Ansicht der Künstler an den Institutionen, den Händlern, aber auch an ihnen selbst: "Bei uns existiert im Gegensatz zu Großbritannien, Deutschland oder den USA derzeit kein künstlerischer Patriotismus. Laut [dem Künstler] Claude Lévêque ist an dem berühmten amerikanischen Witz "Warum sollten wir eure Künstler ausstellen, wenn ihr sie nicht mal selber ausstellt?" durchaus etwas dran. Vor allem die Maler bekommen das schmerzhaft zu spüren: "Frankreich", sagt etwa Philippe Cognée, "ist fähig, uns Medaillen zu verleihen - mir hat man die Ehrenlegion angeboten! -, aber unfähig, darauf hinzuarbeiten, uns auf internationales Niveau zu heben, uns Sichtbarkeit zu verschaffen. Heutzutage ist die einzige Sichtbarkeit kommmerziell und läuft über Pinault oder Arnault.""New Yorker (USA), 27.04.2015
 D. T. Max besucht das süditalienische Städtchen Matera, das einst als der ärmste Flecken Italiens galt, wo die Menschen in Höhlen, den Sassi, lebten. Versuche, sie aus dieser Lage zu befreien, gipfelten am Ende in ihrer - wohlgemeinten! - Vertreibung aus den Höhlen und der Ansiedlung in Neubauten, deren Architekten sich durchaus Gedanken gemacht hatten, wie man die soziale Kultur der Materaner bewahren könne. Sie zerfiel trotzdem. Als die Höhlen schon einzustürzen drohten, kamen plötzlich neue Bewohner - Kreative zumeist, die sich dort niederließen. Heute ist Matera Anziehungspunkt für Filmcrews und Touristen. Und die ehemaligen Bewohner? Max besuchte einen von ihnen, Vito Festa, im Neubauviertel: "Festas Familie hatte die Sassi 1959 verlassen, da war er elf, und zog nach Spine Bianche, eines der nahen, von den Modernisten errichteten Neubauviertel. "Wir waren so glücklich, wir hüpften auf den Betten", erinnert er sich. Ihm gehört heute ein Haus im Norden der Stadt. Als wir dorthin fahren, sehe ich erstmals das moderne Matera... Festas Haus befindet sich etwa zwei Meilen von den Sassi entfernt, in einer Straße mit zweistöckigen Bungalows, die wie eine Hommage auf die alte Grotte wirken. Das Innere jedoch könnte nicht unterschiedlicher sein. Fest geht stolz durch die Garage um die Haupttür zu öffnen. Er zeigt mir Birnen- und Grapefruitbäume, die er in seinem kleinen ummauerten Hinterhof gezogen hat, die glänzenden Marmorfußböden und die zwei Küchen - eine im Keller, für die Tage wenn es zu heiß war, neben dem Wohnzimmer zu kochen. Alles blitzt. Die Sassi-Höhlen werden für ihre fehlenden rechten Winkel gefeiert. Festas Wohnung bestand aus einer Serie perfekter Rechtecke. Nichts hat eine Geschichte, außer dem roten Telefon mit Wählscheibe, einem Dekorationsstück. "Ich mag hübsche Dinge", erklärt Festa."
D. T. Max besucht das süditalienische Städtchen Matera, das einst als der ärmste Flecken Italiens galt, wo die Menschen in Höhlen, den Sassi, lebten. Versuche, sie aus dieser Lage zu befreien, gipfelten am Ende in ihrer - wohlgemeinten! - Vertreibung aus den Höhlen und der Ansiedlung in Neubauten, deren Architekten sich durchaus Gedanken gemacht hatten, wie man die soziale Kultur der Materaner bewahren könne. Sie zerfiel trotzdem. Als die Höhlen schon einzustürzen drohten, kamen plötzlich neue Bewohner - Kreative zumeist, die sich dort niederließen. Heute ist Matera Anziehungspunkt für Filmcrews und Touristen. Und die ehemaligen Bewohner? Max besuchte einen von ihnen, Vito Festa, im Neubauviertel: "Festas Familie hatte die Sassi 1959 verlassen, da war er elf, und zog nach Spine Bianche, eines der nahen, von den Modernisten errichteten Neubauviertel. "Wir waren so glücklich, wir hüpften auf den Betten", erinnert er sich. Ihm gehört heute ein Haus im Norden der Stadt. Als wir dorthin fahren, sehe ich erstmals das moderne Matera... Festas Haus befindet sich etwa zwei Meilen von den Sassi entfernt, in einer Straße mit zweistöckigen Bungalows, die wie eine Hommage auf die alte Grotte wirken. Das Innere jedoch könnte nicht unterschiedlicher sein. Fest geht stolz durch die Garage um die Haupttür zu öffnen. Er zeigt mir Birnen- und Grapefruitbäume, die er in seinem kleinen ummauerten Hinterhof gezogen hat, die glänzenden Marmorfußböden und die zwei Küchen - eine im Keller, für die Tage wenn es zu heiß war, neben dem Wohnzimmer zu kochen. Alles blitzt. Die Sassi-Höhlen werden für ihre fehlenden rechten Winkel gefeiert. Festas Wohnung bestand aus einer Serie perfekter Rechtecke. Nichts hat eine Geschichte, außer dem roten Telefon mit Wählscheibe, einem Dekorationsstück. "Ich mag hübsche Dinge", erklärt Festa."Weitere Artikel: Sarah Stillman schildert in einer Reportage die Folgen der amerikanischen Flüchtlingspolitik, die illegale Einwanderer gerade auch gegenüber kriminellen Landsleute im Regen stehen lässt. Stephen Witt rekapituliert die aufregenden Kindertage der Musikpiraterie im Netz, als Napster und Co. eine Revolution in Gang setzten. Peter Schjeldahl besucht das neue Whitney Museum of American Art von Renzo Piano. Und Oliver Sacks dokumentiert den tragischen Fall des Schauspielers und Schriftstellers Spalding Gray, den eine Gehirnverletzung in den Suizid trieb.
Novinky.cz (Tschechien), 16.04.2015
 Tereza Šimůnková unterhält sich mit dem Kunsthistoriker Jiří Fajt, der nach Jahren an der Universität Leipzig unlängst als neuer Generaldirektor der Prager Nationalgalerie angetreten ist. "Nach meiner Rückkehr dachte ich naiverweise, es sei möglich, an die 90er-Jahre anzuknüpfen, in denen trotz gewisser Probleme eine durchweg positive Atmosphäre herrschte. Stattdessen stelle ich fest, dass sich unsere Gesellschaft während meiner Abwesenheit in eine Abwärtsrichtung bewegt hat. Diesen Niedergang verbinde ich mit dem Wegfall der moralischen Autorität von Václav Havel und dem Antreten der Macht-Ingenieure der Václav-Klaus-Ära. Es tut mir unendlich leid, wenn ich sehe, wie viele intelligente, kreative und tatkräftige Menschen heute nicht mehr an den Staat glauben. Die, die sich in der Vergangenheit engagiert haben, sind so oft enttäuscht worden, dass sie keine Kraft mehr für Neuanfänge haben, oder sie sind darüber alt geworden. Ich treffe hier auf eine unglaubliche Skepsis, die ich aus Deutschland nicht kenne. Es ist, als wären alle am Gemeinwohl resigniert, niemand definiert es mehr, niemand versucht es durchzusetzen. In Tschechien wurden in den letzten fünfzehn Jahren keine Probleme mehr angegangen, sondern systematisch umgangen."
Tereza Šimůnková unterhält sich mit dem Kunsthistoriker Jiří Fajt, der nach Jahren an der Universität Leipzig unlängst als neuer Generaldirektor der Prager Nationalgalerie angetreten ist. "Nach meiner Rückkehr dachte ich naiverweise, es sei möglich, an die 90er-Jahre anzuknüpfen, in denen trotz gewisser Probleme eine durchweg positive Atmosphäre herrschte. Stattdessen stelle ich fest, dass sich unsere Gesellschaft während meiner Abwesenheit in eine Abwärtsrichtung bewegt hat. Diesen Niedergang verbinde ich mit dem Wegfall der moralischen Autorität von Václav Havel und dem Antreten der Macht-Ingenieure der Václav-Klaus-Ära. Es tut mir unendlich leid, wenn ich sehe, wie viele intelligente, kreative und tatkräftige Menschen heute nicht mehr an den Staat glauben. Die, die sich in der Vergangenheit engagiert haben, sind so oft enttäuscht worden, dass sie keine Kraft mehr für Neuanfänge haben, oder sie sind darüber alt geworden. Ich treffe hier auf eine unglaubliche Skepsis, die ich aus Deutschland nicht kenne. Es ist, als wären alle am Gemeinwohl resigniert, niemand definiert es mehr, niemand versucht es durchzusetzen. In Tschechien wurden in den letzten fünfzehn Jahren keine Probleme mehr angegangen, sondern systematisch umgangen."Im gleichen Magazin erinnert sich der tschechische Günter-Grass-Übersetzer Hanuš Karlach: "Sein stets lautstarkes Auftreten, gegen die russische Invasion in der Tschechoslowakei, gegen die "Normalisierung", die darauf eintrat, und seine unverhohlene Unterstützung aller Gegner dieser Entwicklung zog natürlich ein komplettes Publikationsverbot seines Werkes bei uns nach sich. Und da halfen weder Gutachten noch Vor- oder Nachworte darüber, dass es sich hier eigentlich um einen linken, wenn nicht gar sozialistischen Autor handelte. Grass durfte nicht existieren." Das änderte sich freilich nach der Samtenen Revolution. "Irgendwann Mitte der Neunziger war Grass hier zu Besuch und ich begleitete ihn als sein Übersetzer durch Prag. Als wir über den Altstädter Ring gingen, erhoben sich ein paar amerikanische Studenten von den Bänken und sagten zueinander überrascht und ehrfurchtsvoll: "Look! Is it possible? It"s Günter Grass!""
Pitchfork (USA), 21.04.2015
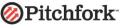 Wenig rosig ist das 21. Jahrhundert bislang aus der Perspektive der Musikindustrie, die heute - trotz der positiven Effekte von iTunes und Spotify - gerade einmal noch ein Viertel dessen umsetzt, was sie zu ihrer stärksten Phase im Jahr 1996 umgesetzt hatte. In einem mit vielen interessanten Fakten gespickten Text wirft Marc Hogan einen Blick weit zurück und fragt sich: Was war Musik jemals wert und was ist sie im Vergleich dazu eigentlich heute wert? Nicht nur erfährt man dabei einiges über die Schwierigkeiten, auf die man stößt, wenn man heutige Streamabrechnungen mit früheren Single-Verkäufen vergleichen will, sondern auch, dass Konzerte und Musikverkauf nur einen Teil der Einkünfte von Musikern ausmachen. Und dann gibt es noch diesen Wert, der kein Preisschild hat: "Carusos Victor-Aufnahme von Pagliaccis "Vesti la giubba" gilt als die erste in Millionenauflage verkaufte Platte der Geschichte. Bei ihrem Erscheinen 1904 kostete sie zwei Dollar, was 2015 einem Wert von 51,46 Dollar entspricht. Bescheidenere Victor-Aufnahmen kosteten 25 (6,43 Dollar) bis 50 Cent (12,84 Dollar). Kein anderer Populist als der Historiker Studs Terkel erinnerte sich, wie sein Vater "eine Victor-Aufnahme nach Hause brachte und sie behutsam auf den Phonographen legte". Seine Mutter, schrieb Terkel, "war stinksauer" über die Ausgabe. "Mein Vater machte nicht viele Worte. Er sagte einfach "Caruso"."
Wenig rosig ist das 21. Jahrhundert bislang aus der Perspektive der Musikindustrie, die heute - trotz der positiven Effekte von iTunes und Spotify - gerade einmal noch ein Viertel dessen umsetzt, was sie zu ihrer stärksten Phase im Jahr 1996 umgesetzt hatte. In einem mit vielen interessanten Fakten gespickten Text wirft Marc Hogan einen Blick weit zurück und fragt sich: Was war Musik jemals wert und was ist sie im Vergleich dazu eigentlich heute wert? Nicht nur erfährt man dabei einiges über die Schwierigkeiten, auf die man stößt, wenn man heutige Streamabrechnungen mit früheren Single-Verkäufen vergleichen will, sondern auch, dass Konzerte und Musikverkauf nur einen Teil der Einkünfte von Musikern ausmachen. Und dann gibt es noch diesen Wert, der kein Preisschild hat: "Carusos Victor-Aufnahme von Pagliaccis "Vesti la giubba" gilt als die erste in Millionenauflage verkaufte Platte der Geschichte. Bei ihrem Erscheinen 1904 kostete sie zwei Dollar, was 2015 einem Wert von 51,46 Dollar entspricht. Bescheidenere Victor-Aufnahmen kosteten 25 (6,43 Dollar) bis 50 Cent (12,84 Dollar). Kein anderer Populist als der Historiker Studs Terkel erinnerte sich, wie sein Vater "eine Victor-Aufnahme nach Hause brachte und sie behutsam auf den Phonographen legte". Seine Mutter, schrieb Terkel, "war stinksauer" über die Ausgabe. "Mein Vater machte nicht viele Worte. Er sagte einfach "Caruso"."Gatopardo (Kolumbien), 18.04.2015
 Der Journalist Diego Enrique Osorno besucht einen der reichsten Männer der Welt, den mexikanischen Unternehmer und Telekom-Milliardär Carlos Slim, mittlerweile auch Hauptaktionär der New York Times, und lässt sich von diesem seine Bibliothek vorführen: "Vor allem Biografien, Bücher über Unternehmen, Sport- und Wirtschaftsstatistiken sowie Geschichtsbücher, die sich in einem schmucklosen Regal aneinanderdrängen, das eine ganze Wand seines 90 Quadratmeter großen Büros bedeckt. Eins der ersten Bücher, zu denen er greift, ist "Mr. Baruch" von Margaret L. Coit, die 1957 erschienene Geschichte des "einsamen Wolfes von der Wall Street", der mit Spekulationen auf dem Zucker-Markt Millionen verdiente und später Kriegsberater der Präsidenten Wilson, Roosevelt und Truman wurde. Als nächstes die Biografie von Jim Ling, ein gelernter Elektriker, der mithilfe von Spekulationen einen der größten Konzerne der Welt schuf, bis er in der Krise der 70er Jahre bankrott ging. Dann die von Robert Vesco, Sohn eines Italieners und einer Jugoslawin, der nicht einmal die Oberschule beendete, als genialer Verkäufer Millionen verdiente, nach einem Betrug nach Kuba floh, wo man ihn mit offenen Armen empfing, jedoch nach einem weiteren Betrug an einem Neffen Fidel Castros ins Gefängnis steckte. Und ganz zuletzt eine Faksimile-Ausgabe von Che Guevaras bolivianischem Tagebuch, ursprünglich von Evo Morales in einer Sonderauflage an verschiedene Präsidenten verschenkt und dann, wie auch immer, in Slims Bibliothek gelandet, was unweigerlich zu der Frage führte, ob unser Gastgeber sich als Rechter oder Linker betrachte..."
Der Journalist Diego Enrique Osorno besucht einen der reichsten Männer der Welt, den mexikanischen Unternehmer und Telekom-Milliardär Carlos Slim, mittlerweile auch Hauptaktionär der New York Times, und lässt sich von diesem seine Bibliothek vorführen: "Vor allem Biografien, Bücher über Unternehmen, Sport- und Wirtschaftsstatistiken sowie Geschichtsbücher, die sich in einem schmucklosen Regal aneinanderdrängen, das eine ganze Wand seines 90 Quadratmeter großen Büros bedeckt. Eins der ersten Bücher, zu denen er greift, ist "Mr. Baruch" von Margaret L. Coit, die 1957 erschienene Geschichte des "einsamen Wolfes von der Wall Street", der mit Spekulationen auf dem Zucker-Markt Millionen verdiente und später Kriegsberater der Präsidenten Wilson, Roosevelt und Truman wurde. Als nächstes die Biografie von Jim Ling, ein gelernter Elektriker, der mithilfe von Spekulationen einen der größten Konzerne der Welt schuf, bis er in der Krise der 70er Jahre bankrott ging. Dann die von Robert Vesco, Sohn eines Italieners und einer Jugoslawin, der nicht einmal die Oberschule beendete, als genialer Verkäufer Millionen verdiente, nach einem Betrug nach Kuba floh, wo man ihn mit offenen Armen empfing, jedoch nach einem weiteren Betrug an einem Neffen Fidel Castros ins Gefängnis steckte. Und ganz zuletzt eine Faksimile-Ausgabe von Che Guevaras bolivianischem Tagebuch, ursprünglich von Evo Morales in einer Sonderauflage an verschiedene Präsidenten verschenkt und dann, wie auch immer, in Slims Bibliothek gelandet, was unweigerlich zu der Frage führte, ob unser Gastgeber sich als Rechter oder Linker betrachte..."Aeon (UK), 16.04.2015
 Der Psychologe und Radiologe Jeffrey M. Zacks geht einer längst überfälligen Frage nach: Warum explodieren unsere Gehirne nicht, wenn wir Filme sehen? Immerhin widerspricht der Filmschnitt, bei dem sich auf einen Schlag alle visuellen Informationen ändern können, unserem über Jahrmillionen entwickelten Sehsinn - oder etwa nicht? "Unsere Seherfahrung kommt uns vielleicht nicht so zerstückelt vor wie eine von Paul Greengrass inszenierte Kampfszene, aber in Wirklichkeit ist sie es. Zum einen blinzeln wir alle paar Sekunden und sind jeweils für mehrere Zehntelsekunden blind. Zum anderen bewegen sich unsere Augen, zwei oder drei pro Sekunde vollziehen sie ruckartige sogenannte sakkadische Augenbewegungen. Diese dauern weniger als eine Zehntelsekunde, und die Information, die während dessen ans Hirn gesendet wird, ist ziemlich unbrauchbar. Das Hirn hat einen famosen Kontrollmechanismus um den Informationsmüll während der Sakkaden auszublenden. Mit Blinzeln und Sakkaden sind wir rund ein Drittel unseres Wachlebens funktionell blind."
Der Psychologe und Radiologe Jeffrey M. Zacks geht einer längst überfälligen Frage nach: Warum explodieren unsere Gehirne nicht, wenn wir Filme sehen? Immerhin widerspricht der Filmschnitt, bei dem sich auf einen Schlag alle visuellen Informationen ändern können, unserem über Jahrmillionen entwickelten Sehsinn - oder etwa nicht? "Unsere Seherfahrung kommt uns vielleicht nicht so zerstückelt vor wie eine von Paul Greengrass inszenierte Kampfszene, aber in Wirklichkeit ist sie es. Zum einen blinzeln wir alle paar Sekunden und sind jeweils für mehrere Zehntelsekunden blind. Zum anderen bewegen sich unsere Augen, zwei oder drei pro Sekunde vollziehen sie ruckartige sogenannte sakkadische Augenbewegungen. Diese dauern weniger als eine Zehntelsekunde, und die Information, die während dessen ans Hirn gesendet wird, ist ziemlich unbrauchbar. Das Hirn hat einen famosen Kontrollmechanismus um den Informationsmüll während der Sakkaden auszublenden. Mit Blinzeln und Sakkaden sind wir rund ein Drittel unseres Wachlebens funktionell blind."Vanity Fair (USA), 15.04.2015
 Vanity Fair bringt einen umfangreichen, sehr lesenswerten Auszug aus Josh Karps neuem Buch, das sich ausschließlich mit Orson Welles letztem, Ruine gebliebenem Film "The Other Side of the Wind" beschäftigt, eine Satire auf "New Hollywood", über einen Regisseur namens Hannaford, der aus Europa zurückkehrt, um einen letzten großen Film zu drehen. Bei einer Hollywood-Zeremonie zu Ehren von Welles versuchte der Regisseur mit einigen Szenen aus dem Film letztmals Finanzmittel einzuholen: "Die präsentierte Szene findet in einem Vorführsaal statt, in dem einer von Hannafords Mitarbeitern sich darum bemüht, den unvollendeten Film des Regisseurs (für den er, genau wie Welles, eine letzte Kapitalspritze benötigt) an einen hübschen, jungen Studioboss, der auf Robert Evans basiert, zu verkaufen - was die ganze Sache ziemlich unbequem machte. Noch schlimmer wurde es, als sich herausstellte, dass Hannafords Film keinen Dialog und keine Story hatte, und nichts anderes darstellt als ein wunderschön gefilmtes Desaster, das nicht einmal der Verkäufer erklären konnte. ... Welles behauptete zwar, im Anschluss ein Angebot erhalten zu haben, dass die Produktionsgesellschaft Astrophore es jedoch in Erwartung anderer - besserer - Angebote abgelehnt habe. Bogdanovich aber kann sich an kein Studio und keinen Produzenten erinnern, der Welles Geld zur Fertigstellung seines Films über einen Regisseur, der zur Fertigstellung seines Films Geld sucht, geben wollte. "Das war die bittere Ironie des Ganzen ", sagt er, "sie applaudierten wie blöde, aber keiner rückte auch nur einen Cent heraus.""
Vanity Fair bringt einen umfangreichen, sehr lesenswerten Auszug aus Josh Karps neuem Buch, das sich ausschließlich mit Orson Welles letztem, Ruine gebliebenem Film "The Other Side of the Wind" beschäftigt, eine Satire auf "New Hollywood", über einen Regisseur namens Hannaford, der aus Europa zurückkehrt, um einen letzten großen Film zu drehen. Bei einer Hollywood-Zeremonie zu Ehren von Welles versuchte der Regisseur mit einigen Szenen aus dem Film letztmals Finanzmittel einzuholen: "Die präsentierte Szene findet in einem Vorführsaal statt, in dem einer von Hannafords Mitarbeitern sich darum bemüht, den unvollendeten Film des Regisseurs (für den er, genau wie Welles, eine letzte Kapitalspritze benötigt) an einen hübschen, jungen Studioboss, der auf Robert Evans basiert, zu verkaufen - was die ganze Sache ziemlich unbequem machte. Noch schlimmer wurde es, als sich herausstellte, dass Hannafords Film keinen Dialog und keine Story hatte, und nichts anderes darstellt als ein wunderschön gefilmtes Desaster, das nicht einmal der Verkäufer erklären konnte. ... Welles behauptete zwar, im Anschluss ein Angebot erhalten zu haben, dass die Produktionsgesellschaft Astrophore es jedoch in Erwartung anderer - besserer - Angebote abgelehnt habe. Bogdanovich aber kann sich an kein Studio und keinen Produzenten erinnern, der Welles Geld zur Fertigstellung seines Films über einen Regisseur, der zur Fertigstellung seines Films Geld sucht, geben wollte. "Das war die bittere Ironie des Ganzen ", sagt er, "sie applaudierten wie blöde, aber keiner rückte auch nur einen Cent heraus.""Fast Company (USA), 07.04.2015
 Wie tiefgreifend die Erschütterungen sind, die von Netflix für HBO ausgehen, verdeutlicht Nicole Laporte auf sehr eindrückliche Weise mit einer Reportage über die händeringenden Versuche des eigentlich boomenden PayTV-Senders, sich mit einem eigenständigen Onlineangebot auch auf dem Streamingmarkt der Zukunft zu positionieren: Nach langwierigen, aber am Ende gescheiterten Versuchen, dieses Unternehmen in house anzugehen, hat man nun Bündnisse mit dem Sportprogrammanbieter MLB und Apple geschmiedet und die nur auf Apple-Produkten laufende App HBO Now zu Wege gebracht. "Geschäftsführer Richard Plepler verliert über diese Entscheidung keine Tränen. Die technologische Seite des Projekts zu delegieren, ist für HBO ein strategischer Wendepunkt zurück zu den Wurzeln: HBO war schon immer ein Content-, kein Tech-Unternehmen. ... Aber ist HBO Now wirklich so ein alles umwerfendes Ereignis? Mit der Kooperation mit Apple stellt Plepler einen coolen Service vor, der lediglich einen Tippser vom Bildschirm entfernt ist, ganz ohne eine vorangegangene, zähe Pay-TV-Authorisierung. Doch auch wenn Version 1.0 jetzt nicht mehr störanfällig ist und mit viel Premium-Content lockt, stellt sie dennoch nur einen Abglanz dessen dar, was zuvor einmal geplant war. Wenn das Produkt wirklich gut ist, dann führt es HBO sichtlich an Netflix heran. Doch nicht weit genug, um den Gegner tatsächlich zu erlegen."
Wie tiefgreifend die Erschütterungen sind, die von Netflix für HBO ausgehen, verdeutlicht Nicole Laporte auf sehr eindrückliche Weise mit einer Reportage über die händeringenden Versuche des eigentlich boomenden PayTV-Senders, sich mit einem eigenständigen Onlineangebot auch auf dem Streamingmarkt der Zukunft zu positionieren: Nach langwierigen, aber am Ende gescheiterten Versuchen, dieses Unternehmen in house anzugehen, hat man nun Bündnisse mit dem Sportprogrammanbieter MLB und Apple geschmiedet und die nur auf Apple-Produkten laufende App HBO Now zu Wege gebracht. "Geschäftsführer Richard Plepler verliert über diese Entscheidung keine Tränen. Die technologische Seite des Projekts zu delegieren, ist für HBO ein strategischer Wendepunkt zurück zu den Wurzeln: HBO war schon immer ein Content-, kein Tech-Unternehmen. ... Aber ist HBO Now wirklich so ein alles umwerfendes Ereignis? Mit der Kooperation mit Apple stellt Plepler einen coolen Service vor, der lediglich einen Tippser vom Bildschirm entfernt ist, ganz ohne eine vorangegangene, zähe Pay-TV-Authorisierung. Doch auch wenn Version 1.0 jetzt nicht mehr störanfällig ist und mit viel Premium-Content lockt, stellt sie dennoch nur einen Abglanz dessen dar, was zuvor einmal geplant war. Wenn das Produkt wirklich gut ist, dann führt es HBO sichtlich an Netflix heran. Doch nicht weit genug, um den Gegner tatsächlich zu erlegen."Magyar Narancs (Ungarn), 21.04.2015
Vor zwei Jahren wies das Wiener Burgtheater eine Einladung zum neugegründeten internationalen Theaterfestival POSzT des Budapester Nationaltheaters unter dem Direktoren Attila Vidnyánszky zurück (mehr hier). Am diesjährigen Treffen nahm das Burgtheater zum ersten Mal teil, der Gastauftritt (mit Jan Bosses Tschechow-Inszenierung "Die Möwe") endete am gestrigen Abend mit einem Eklat, meldet Népszabadság. Nach der Vorstellung verlas Martin Reinke (in der Rolle des Jewgenij Dorn) eine politische Erklärung auf Deutsch und auf Englisch und überraschte damit den anwesenden Vidnyánszky aber auch das Publikum vollkommen: Das Burg-Ensemble bekundete in der Erklärung seine Solidarität mit denen, die - wie Teile der ungarischen Theaterszene - die wachsenden Demokratiedefizite ertragen müssen. (Mehr dazu hier)
Ein Skandal dieses Theatertreffens ist die grundlose Ablehnung der Kandidatin für den Vorsitz der fachlichen Jury, Judit Csáki, durch die von Vidnyánszky angeführte Ungarische Theatrumgesellschaft. Die Vereinigung der Theaterkritiker rief daraufhin zum Boykott auf, dem sich bisher zahlreiche Fachzeitschriften, Onlineportale aber auch Schriftsteller wie Péter Esterházy, Pál Závada oder Lajos Parti Nagy, Kunst- und Kulturhistoriker wie Péter György oder János Rainer M. und Regisseure wie Róbert Alföldi oder Árpád Schilling anschlossen. Weiterhin verkündeten einige teilnehmenden Theaterhäuser (Örkény, Szputnyik), dass sie zwar ihre Stücke spielen, sich jedoch aus dem Wettbewerb zurückziehen würden. Péter Urfi stellt die Zukunft des Festivals unter den gegebenen Umständen grundsätzlich in Frage: "Das anhaltende Schweigen über den wachsenden Boykott wird immer peinlicher. Zwar kann ein protziges Festival die Absagen von Intellektuellen wie Esterházy, Parti Nagy, Péter György, Závada u.a. vom Tisch fegen, doch die Liste mit bestimmenden Figuren des gegenwärtigen ungarischen Theaters wie Alföldi, Schilling oder der Direktorin der Vereinigung der unabhängigen Theaterhäuser Adrienn Zubek wird auch immer länger. Sie alle zu ignorieren ist - gelinde gesagt - eine Unverschämtheit, was erneut zu der Frage führt, was für eine Veranstaltung aus dem POSZT geworden ist."
Ein Skandal dieses Theatertreffens ist die grundlose Ablehnung der Kandidatin für den Vorsitz der fachlichen Jury, Judit Csáki, durch die von Vidnyánszky angeführte Ungarische Theatrumgesellschaft. Die Vereinigung der Theaterkritiker rief daraufhin zum Boykott auf, dem sich bisher zahlreiche Fachzeitschriften, Onlineportale aber auch Schriftsteller wie Péter Esterházy, Pál Závada oder Lajos Parti Nagy, Kunst- und Kulturhistoriker wie Péter György oder János Rainer M. und Regisseure wie Róbert Alföldi oder Árpád Schilling anschlossen. Weiterhin verkündeten einige teilnehmenden Theaterhäuser (Örkény, Szputnyik), dass sie zwar ihre Stücke spielen, sich jedoch aus dem Wettbewerb zurückziehen würden. Péter Urfi stellt die Zukunft des Festivals unter den gegebenen Umständen grundsätzlich in Frage: "Das anhaltende Schweigen über den wachsenden Boykott wird immer peinlicher. Zwar kann ein protziges Festival die Absagen von Intellektuellen wie Esterházy, Parti Nagy, Péter György, Závada u.a. vom Tisch fegen, doch die Liste mit bestimmenden Figuren des gegenwärtigen ungarischen Theaters wie Alföldi, Schilling oder der Direktorin der Vereinigung der unabhängigen Theaterhäuser Adrienn Zubek wird auch immer länger. Sie alle zu ignorieren ist - gelinde gesagt - eine Unverschämtheit, was erneut zu der Frage führt, was für eine Veranstaltung aus dem POSZT geworden ist."
New York Times (USA), 19.04.2015

Sally Mann, Foto aus der Serie "Immediate Family", 1992
Im aktuellen Magazin bringt die New York Times einen Vorabdruck aus der Autobiografie der amerikanischen Fotografin Sally Mann. Mann setzt sich darin mit ihrem 1992 erschienenen Fotoband "Immediate Family" und den teils heftigen Reaktionen auf die darin enthaltenen intimen Fotos ihrer Kinder auseinander: "Was die Leute abgesehen von all der redlichen Sorge um das Wohl meiner Kinder nicht verstanden haben, ist der Umstand, dass diese Arbeit nichts mit meinen Aufgaben als Mutter zu tun hat. Als ich hinter die Kamera trat und meine Kinder ablichtete, war ich eine Fotografin und sie Schauspieler, gemeinsam schufen wir ein Bild. Viele verwechselten die Bilder mit der Wirklichkeit oder dichteten meinen Kindern auf Grundlage der Fotos bestimmte Eigenschaften an (ein Kommentator nannte sie "böse"). Tatsächlich aber sind das nicht meine Kinder; es sind zeitlose Gestalten auf Silberpapier. Sie repräsentieren meine Kinder im Bruchteil einer Sekunde an einem bestimmten Nachmittag mit unendlich vielen Variablen des Lichts, des Ausdrucks, der Haltung, der Muskelspannung, der Stimmung, des Winds und der Schatten. Es sind nicht meine Kinder, es sind Kinder auf einem Foto. Eine Unterscheidung, die sie selbst sehr wohl begriffen … Für die Leute war das schwer zu verstehen, genauso, wie der Unterschied zwischen den Bildern und der Fotografin, die viele für unmoralisch hielten. Nehmen wir an, es ist wahr, und ich war manipulativ, krank, verdorben, vulgär, wie einige Kommentatoren meinten, auf die Wahrnehmung der Arbeit sollte das keinen Einfluss haben. Wenn wir nur die Arbeiten von Leuten ehren würden, denen wir unsere Großmutter anvertrauen würden, wäre es um die Kunst schlecht bestellt."
Mary Anne Weaver geht der Frage nach, warum so viele britische Muslime sich den radikalen Islamisten im Irak und in Syrien angeschlossen haben. Sechs- bis siebenhundert sollen es derzeit sein. Was charakterisiert den typischen britischen Dschihadisten, fragt Weaver Shiraz Maher vom International Center for the Study of Radicalization (I.C.S.R.) am King"s College in London. Seine Antwort: "Der durchschnittliche britische Kämpfer ist männlich, in seinen frühen Zwanzigern und südasiatischer Herkunft. Er hat in der Regel die Universität besucht und Kontakt zu Aktivistengruppen. Immer wieder haben wir gesehen, dass die Radikalisierung nicht notwendig aus sozialem Mangel oder Armut erwächst. Manche gehen aus humanitären Gründen, die anderen wegen des Märtyrertums. Sie wollen so schnell wie möglich sterben und ins Paradies kommen." Außerdem gebe es noch Abenteurer, die ihre Männlichkeit beweisen wollten, Kriminelle und Ultraradikale, die Amerikaner töten wollten.
Kommentieren