Magazinrundschau
Zuerst die ungarische Wahrheit
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
01.03.2016. The Atlantic spürt dem großen Kaktusschmuggel nach. Nepszabadsag und Hospodarske noviny analysieren die Rhetorik in den Visegrad-Ländern. Die LRB verteidigt den Drohnenkrieg. Der Merkur denkt über Design und Charakter nach. Der New Yorker optimiert sich mit digitalem Lernen. Die New York Times lernt von Google den Wert komplizierter Gespräche. Im Guardian erklärt Karl Ove Knausgard, warum nicht Tolstoi, sondern Turgenjew sein Vorbild ist. Wenn die Revolution kommt, dann dank der alleinstehenden Frauen, ruft das New York Magazine.
The Atlantic (USA), 28.02.2016
 Auch wenn Naji Abu Nowars in der Rubrik "bester fremdsprachiger Film" nominierter "Theeb" bei den Oscars leer ausging, markiert schon dessen bloße Existenz einen Quantensprung für das arabische Kino, schreibt Nadine Ajaka: Bei dem Film handelt es sich um die erste unabhängig jordanische Produktion seit 50 Jahren. Überhaupt befinde sich das Kino der gesamten arabischen Region im Auftrieb: "'Theeb' ist lediglich der neueste Film einer ganzen Welle von komplexen und künstlerisch wertvollen Filmen aus dem Nahen Osten und dem nordafrikanischen Raum. Die Zugänglichkeit der Produktionsmittel und der Siegeszug der digitalen Distribution hat etwas ins Rollen gebracht, von dem sich einige Experten und Filmemacher übereinstimmend ein Goldenes Zeitalter des arabischen Kinos versprechen. ... Innerhalb der letzten zehn Jahre sind streitsüchtige Filmemacher mit wirklich Grenzen überschreitenden Filmen auf der Bildfläche erschienen und das sogar inmitten des sozialen und politischen Chaos, wie es für weite Teilen des modernen Nahen Ostens typisch ist."
Auch wenn Naji Abu Nowars in der Rubrik "bester fremdsprachiger Film" nominierter "Theeb" bei den Oscars leer ausging, markiert schon dessen bloße Existenz einen Quantensprung für das arabische Kino, schreibt Nadine Ajaka: Bei dem Film handelt es sich um die erste unabhängig jordanische Produktion seit 50 Jahren. Überhaupt befinde sich das Kino der gesamten arabischen Region im Auftrieb: "'Theeb' ist lediglich der neueste Film einer ganzen Welle von komplexen und künstlerisch wertvollen Filmen aus dem Nahen Osten und dem nordafrikanischen Raum. Die Zugänglichkeit der Produktionsmittel und der Siegeszug der digitalen Distribution hat etwas ins Rollen gebracht, von dem sich einige Experten und Filmemacher übereinstimmend ein Goldenes Zeitalter des arabischen Kinos versprechen. ... Innerhalb der letzten zehn Jahre sind streitsüchtige Filmemacher mit wirklich Grenzen überschreitenden Filmen auf der Bildfläche erschienen und das sogar inmitten des sozialen und politischen Chaos, wie es für weite Teilen des modernen Nahen Ostens typisch ist."Außerdem eine kuriose, aber tatsächlich sehr erhellende Lektüre: J. Weston Phippens Reportage über den Kaktusschmuggel in den USA, der mehr und mehr Kakteenarten in die Liste der vom Aussterben bedrohten Pflanzen aufsteigen lässt: Sehr begehrt ist zum Beispiel der riesige, "Saguaro" genannte und insbesondere aus dem Westernkino bekannte Riesenkaktus Carnegiea gigantea, der dummerweise nicht gerade schnell wächst: "Die ersten zehn Jahre seines Lebens misst er gerade mal einen Zoll. Es dauert 75 Jahre, bis er seine berühmten Arme ausfährt. Da Hausbesitzer aber einen Saguaro bereits in ihrem Vorgarten stehen haben wollen, bevor sie über 80 Jahre alt sind, stehlen Verbrecher sie aus der Wildnis."
Und: Wenn ein glühender Etatist wie der schottische Philosoph Alistair Duff auf die radikale Staatsskepsis im Silicon Valley trifft, kann das ja nichts werden. Im Gespräch mit Kaveh Waddell erklärt er, warum die IT-Konzerne sich unbedingt staatlicher Kontrolle beugen sollten (man könnte meinen, die staatlichen Schnüffelprogramme im Zuge von NSA und Konsorten sollten ein gesundes Maß an Skepsis walten lassen) und bedauert, dass die digitale Revolution noch kein Pendant zum Sozialismus, der als Reaktion auf die industrielle Revolution entstanden ist, hervorgebacht hat.
Nepszabadsag (Ungarn), 27.02.2016
 Für den ungarischen Sozialpsychologen und Schriftsteller Péter Hunčík aus Bratislava steht die scheinbar erstarkte Kooperationsbereitschaft der Visegrád-Länder (Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn) auf tönernen Füßen, denn das Pochen auf nationalstaatliche Lösungen gegen Brüssel werde die alten Konfliktlinien zwischen den vier Staaten erneut zu Tage fördern. "Wie gelangen wir von Versailles zu den Visegrád-Ländern? Ziel der Pariser Verhandlungen war die Schaffung von Nationalstaaten. Doch die Rivalität von Nationalstaaten führte zu Hass, Hass führte erneut zum Krieg. Danach kam die lange sowjetische Dominanz, die das Problem mit dem Homo Sovieticus lösen wollte. Schließlich kam 1989. Seitens der EU hieß es: Erstens: Die Grenzen sind unantastbar! Zweitens: Ihr könnt einander sowieso nicht besiegen! Drittens: Versucht miteinander zu kooperieren! Miteinander kooperieren, aber gegen wen? 1991 gab es keinen gemeinsamen Gegner, es ging etwas befremdlich um ein gemeinsames Ziel. Von Empathie und Solidarität konnte jedoch keine Rede sein, denn die Visegrád-Länder verachteten sich gegenseitig. Lediglich die Ankunft der Flüchtlinge in der Region brachte ihr wahres Ich hervor. (...) Und so führt ein gerader Weg erneut nach Versailles. Da wird wieder alles gut werden. Nur die verfluchten Slowaken (und Tschechen und Polen) sollen endlich begreifen, dass zuerst die ungarische Wahrheit zählt!"
Für den ungarischen Sozialpsychologen und Schriftsteller Péter Hunčík aus Bratislava steht die scheinbar erstarkte Kooperationsbereitschaft der Visegrád-Länder (Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn) auf tönernen Füßen, denn das Pochen auf nationalstaatliche Lösungen gegen Brüssel werde die alten Konfliktlinien zwischen den vier Staaten erneut zu Tage fördern. "Wie gelangen wir von Versailles zu den Visegrád-Ländern? Ziel der Pariser Verhandlungen war die Schaffung von Nationalstaaten. Doch die Rivalität von Nationalstaaten führte zu Hass, Hass führte erneut zum Krieg. Danach kam die lange sowjetische Dominanz, die das Problem mit dem Homo Sovieticus lösen wollte. Schließlich kam 1989. Seitens der EU hieß es: Erstens: Die Grenzen sind unantastbar! Zweitens: Ihr könnt einander sowieso nicht besiegen! Drittens: Versucht miteinander zu kooperieren! Miteinander kooperieren, aber gegen wen? 1991 gab es keinen gemeinsamen Gegner, es ging etwas befremdlich um ein gemeinsames Ziel. Von Empathie und Solidarität konnte jedoch keine Rede sein, denn die Visegrád-Länder verachteten sich gegenseitig. Lediglich die Ankunft der Flüchtlinge in der Region brachte ihr wahres Ich hervor. (...) Und so führt ein gerader Weg erneut nach Versailles. Da wird wieder alles gut werden. Nur die verfluchten Slowaken (und Tschechen und Polen) sollen endlich begreifen, dass zuerst die ungarische Wahrheit zählt!"Hospodarske noviny (Tschechien), 25.02.2016
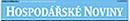 Trotz all der derzeitigen Gehässigkeit gegen Flüchtlinge und die EU-Politik erlaubt sich der tschechische Ökonom Tomáš Sedláček Optimismus in Hinblick auf sein Land. Volkes Stimme drücke sich immer noch in den Wahlen aus. "Und dieses Land hat eine Regierung mit Premier Sobotka an der Spitze gewählt, die Zemans und Klause haben in den Parlamentswahlen kaum Stimmen gewonnen. Der tschechische Wähler will das Geschimpfe und das Wälzen in Angst und Hass (gegen die EU, gegen die USA, gegen Flüchtlinge, gegen Andersdenkende), doch nur auf einer rhetorischen Ebene. Der Hass, den das Volk empfindet, will impotent und passiv bleiben, auf einer symbolischen Ebene. All das Gezeter ist nur Gezeter. Offenbar wollen wir einen Präsidenten, der in fast jede Richtung (außer Russland) Gift und Galle spuckt, aber wir wollen ihn nicht in der Regierung. Darin unterscheidet sich die tschechische Republik von den anderen Ländern der Visegrader Vier. Alle anderen hatte im Lauf der nachkommunistischen Jahre eine extremistische oder nationalistische Partei in der Regierung, die im Rest der westlichen Welt zu Stirnrunzeln geführt hat. Wir nicht. Um Verschlossenheit, Exzesse und extremistische Meinungen haben sich immer unsere letzten beiden Präsidenten gekümmert. Ihr Hass blieb dabei immer machtlos, wenn er auch als Ventil zum Dampfablassen, als Begleitung zum Bier-auf-den-Tisch-Knallen, gute Dienste geleistet hat."
Trotz all der derzeitigen Gehässigkeit gegen Flüchtlinge und die EU-Politik erlaubt sich der tschechische Ökonom Tomáš Sedláček Optimismus in Hinblick auf sein Land. Volkes Stimme drücke sich immer noch in den Wahlen aus. "Und dieses Land hat eine Regierung mit Premier Sobotka an der Spitze gewählt, die Zemans und Klause haben in den Parlamentswahlen kaum Stimmen gewonnen. Der tschechische Wähler will das Geschimpfe und das Wälzen in Angst und Hass (gegen die EU, gegen die USA, gegen Flüchtlinge, gegen Andersdenkende), doch nur auf einer rhetorischen Ebene. Der Hass, den das Volk empfindet, will impotent und passiv bleiben, auf einer symbolischen Ebene. All das Gezeter ist nur Gezeter. Offenbar wollen wir einen Präsidenten, der in fast jede Richtung (außer Russland) Gift und Galle spuckt, aber wir wollen ihn nicht in der Regierung. Darin unterscheidet sich die tschechische Republik von den anderen Ländern der Visegrader Vier. Alle anderen hatte im Lauf der nachkommunistischen Jahre eine extremistische oder nationalistische Partei in der Regierung, die im Rest der westlichen Welt zu Stirnrunzeln geführt hat. Wir nicht. Um Verschlossenheit, Exzesse und extremistische Meinungen haben sich immer unsere letzten beiden Präsidenten gekümmert. Ihr Hass blieb dabei immer machtlos, wenn er auch als Ventil zum Dampfablassen, als Begleitung zum Bier-auf-den-Tisch-Knallen, gute Dienste geleistet hat."London Review of Books (UK), 03.03.2016
 Die Tage des Islamischen Staats sind gezählt, glaubt Patrick Cockburn, der einen ziemlich kenntnisreichen Blick auf die Lage in Syrien und Irak wirft: "Das Pentagon, die irakische Regierung und die Kurden übertreiben ihre Erfolge gegen den IS, aber der musste tatsächlich schwere Verluste einstecken und ist, seit er die Verbindung zur Türkei verloren hat, von der Außenwelt abgeschnitten. Wirtschaft und Organisation des Kalifats beginnen unter dem Druck der Bombardierung und Blockade zusammenzubrechen. Diesen Eindruck vermitteln zumindest die Menschen, die Anfang Februar von Mosul nach Rojava geflohen sind. Ihre Reise war nicht leicht, da der IS jedem verbietet, das Kalifat zu verlassen - er will keinen Massenexodus. Wer es raus geschafft hat, berichtet, dass der IS mit zunehmender Gewalt seine Fatwas und religiösen Gesetze durchsetzt."
Die Tage des Islamischen Staats sind gezählt, glaubt Patrick Cockburn, der einen ziemlich kenntnisreichen Blick auf die Lage in Syrien und Irak wirft: "Das Pentagon, die irakische Regierung und die Kurden übertreiben ihre Erfolge gegen den IS, aber der musste tatsächlich schwere Verluste einstecken und ist, seit er die Verbindung zur Türkei verloren hat, von der Außenwelt abgeschnitten. Wirtschaft und Organisation des Kalifats beginnen unter dem Druck der Bombardierung und Blockade zusammenzubrechen. Diesen Eindruck vermitteln zumindest die Menschen, die Anfang Februar von Mosul nach Rojava geflohen sind. Ihre Reise war nicht leicht, da der IS jedem verbietet, das Kalifat zu verlassen - er will keinen Massenexodus. Wer es raus geschafft hat, berichtet, dass der IS mit zunehmender Gewalt seine Fatwas und religiösen Gesetze durchsetzt."Thomas Nagel verteidigt den Drohnenkrieg. Rechtlich fragwürdig sei zwar, dass man nicht mehr zwischen Gefahrenabwehr und Hinrichtung unterscheiden könne, ansonsten sei die Abwehr reiner Affekt: "Ich vermute, dass viele das Persönliche, Individualisierte am Drohnenkrieg erschreckend finden. Es scheint leichter, beim Verfolgen legitimer militärischer Ziele das Sterben gesichtsloser Massen durch Raketen, Bomben und Granaten hinzunehmen und die damit einhergehenden, unvermeidlichen Kollateralschäden. Krieg ist die Hölle, das wissen wir. Aber wenn der Präsident jemanden auf eine Tötungsliste für einen Drohnenschlag setzt, schafft dies das illusorische Gefühl einer direkteren Verantwortung für diesen Tod als für einen anderen. Es fühlt sich wie eine Exekution an, dabei ist es nur die Einzelhandelsversion der Kriegsführung. Die Verantwortung ist, individuell und kollektiv, in beiden Fällen gleich groß."
Weiteres: Andrew O'Hagan bespricht Jean Steins Blick zurück auf die große Zeit Hollywoods "West of Eden". Frances Stonor Saunders räsoniert über das Ich, die Grenzen und die Selbstvergewisserung.
Merkur (Deutschland), 01.03.2016
 Haben Menschen mit niederer Gesinnung auch schlechten Geschmack? Warum sieht man Architekten nie in ihren eigenen Entwürfen leben, dafür über Leidenschaft und Intelligenz, Strenge und Spiel schwärmen? Viele Fragen drängen sich Christian Demand auf zur Beziehung von Design und Charakter: "Glossing, auf Hochglanz bringen, so nennt der amerikanische Ethnologe Keith M. Murphy diese in Zeitschriften wie AD meisterlich vorgeführte Amalgamierung der Wertwelt ambitionierter Produktgestaltung mit der anderer kreativer Felder wie Kunst, Architektur, Film, High-End-Gastronomie und Luxusbrands. Es ist eine der vielen Techniken zur Nobilitierung und Auratisierung von Designobjekten, denen Murphy in seiner Studie über den öffentlichen Umgang mit Design in Schweden nachgeht, einem Land, in dem der Glaube an eine natürliche Verbindung von guter Gestaltung und guter Gesinnung - Murphys prägnante Formel dafür lautet 'the morality of goods' - eine ebenso lange Tradition hat wie in Deutschland."
Haben Menschen mit niederer Gesinnung auch schlechten Geschmack? Warum sieht man Architekten nie in ihren eigenen Entwürfen leben, dafür über Leidenschaft und Intelligenz, Strenge und Spiel schwärmen? Viele Fragen drängen sich Christian Demand auf zur Beziehung von Design und Charakter: "Glossing, auf Hochglanz bringen, so nennt der amerikanische Ethnologe Keith M. Murphy diese in Zeitschriften wie AD meisterlich vorgeführte Amalgamierung der Wertwelt ambitionierter Produktgestaltung mit der anderer kreativer Felder wie Kunst, Architektur, Film, High-End-Gastronomie und Luxusbrands. Es ist eine der vielen Techniken zur Nobilitierung und Auratisierung von Designobjekten, denen Murphy in seiner Studie über den öffentlichen Umgang mit Design in Schweden nachgeht, einem Land, in dem der Glaube an eine natürliche Verbindung von guter Gestaltung und guter Gesinnung - Murphys prägnante Formel dafür lautet 'the morality of goods' - eine ebenso lange Tradition hat wie in Deutschland."Patrick Bahners macht noch einmal Einwände gegen die kommentierte Ausgabe von Hitlers "Mein Kampf" geltend, wobei ihm vor allem die Singularitätsrhetorik des federführenden Instituts für Zeitgeschichte gegen den Strich zu gehen scheint: "Der Glaube an die Gegenzaubermacht der Wissenschaft ist der rote Faden der Arbeit des IfZ."
New Yorker (USA), 07.03.2016
 Für die aktuelle Ausgabe des Magazins schaute sich Rebecca Mead in den neuen Schulen um, in denen das digitale Lernen Einzug gehalten hat: "Das Klassenzimmer sieht aus wie ein Junggesellen-Apartment mit Sofas, Bücherregalen, Flachbildschirm und Küchenzeile. Anstatt auf die Lehrerin vor ihnen, starren die Schüler auf ein Bild von ihr auf ihren Chromebooks. In der computersimulierten Gesellschaft spielt jeder von ihnen eine Rolle: Verkäufsleiter, Sekretärin, CEO. Ihre Aufgabe an diesem Tag besteht darin, ihr Einkommen im Internet zu recherchieren und ihre Steuer zu errechnen … Personalisierte Lehre lockt mit der Vorstellung, auf standardisierte Tests zu verzichten und die persönlichen Stärken jedes Kindes herauszuarbeiten. Doch die Philosophie dieser Schulen ist bei aller Feier der Individualität, der Autonomie und der Kreativität durchaus utilitaristisch. Sie beinhaltet die Forderung, dass jedes Kind aufs Beste auf die künftige Arbeitswelt vorbereitet sein soll, und die Annahme, dass diese Arbeitswelt Individualität, Kreativität, Kollaboration und kritisches Denken erfordern wird."
Für die aktuelle Ausgabe des Magazins schaute sich Rebecca Mead in den neuen Schulen um, in denen das digitale Lernen Einzug gehalten hat: "Das Klassenzimmer sieht aus wie ein Junggesellen-Apartment mit Sofas, Bücherregalen, Flachbildschirm und Küchenzeile. Anstatt auf die Lehrerin vor ihnen, starren die Schüler auf ein Bild von ihr auf ihren Chromebooks. In der computersimulierten Gesellschaft spielt jeder von ihnen eine Rolle: Verkäufsleiter, Sekretärin, CEO. Ihre Aufgabe an diesem Tag besteht darin, ihr Einkommen im Internet zu recherchieren und ihre Steuer zu errechnen … Personalisierte Lehre lockt mit der Vorstellung, auf standardisierte Tests zu verzichten und die persönlichen Stärken jedes Kindes herauszuarbeiten. Doch die Philosophie dieser Schulen ist bei aller Feier der Individualität, der Autonomie und der Kreativität durchaus utilitaristisch. Sie beinhaltet die Forderung, dass jedes Kind aufs Beste auf die künftige Arbeitswelt vorbereitet sein soll, und die Annahme, dass diese Arbeitswelt Individualität, Kreativität, Kollaboration und kritisches Denken erfordern wird."Außerdem: Matthieu Aikins berichtet über Geschäftemachereien im Afghanistan-Krieg. Und David Owen rekapituliert einen Betrugsskandal in der Welt des Profi-Bridgespiels.
Guardian (UK), 29.02.2016
 Vor dem Erscheinen des nächsten Bandes aus seiner megalomanen Autobiografie "Mein Kampf" erzählt Karl Ove Knausgard, wie er - trotz aller Bewunderung für Tolstoi - von Turgenjew lernte, authentisch und lebensnah zu schreiben, denn dessen Figuren, meint er, verweisen auf nichts anderes als auf sich selbst: "Ich wollte nicht über einen Vater und seinen Sohn schreiben. Ich wollte über meinen Vater und mich schreiben. Das war mir all die Jahre über nicht bewusst, in denen ich die Geschichte aufzuschreiben versuchte. Für mich ist Schreiben blind und intuitiv, entweder funktioniert es oder nicht, wie und warum es das tut, kann man kann nur im Nachhinein erklären. Was funktioniert, gewinnt am Ende allein aus sich selbst. Als ich mich also nach zehn Jahren hinsetzte und einige Seiten über etwas verfasst, das mir widerfahren war und das mich so beschämte, dass ich bisher mit keiner Menschenseele darüber gesprochen hatte, und das alles unter meinem eigenen Namen, da hatte ich keine Ahnung, warum ich das tat und was das mit meinem Roman zu tun haben würde. Ich schickte es meinem Lektor, der es als 'manisch bekenntnishaft' beschrieb, und mir schien, dass er ein wenig auf Abstand ging, denn es war beunruhigend und in keinem literarischen Sinne gut. Aber da war etwas anderes, und das sahen wir beide. Was das war? Zuerst einmal Freiheit."
Vor dem Erscheinen des nächsten Bandes aus seiner megalomanen Autobiografie "Mein Kampf" erzählt Karl Ove Knausgard, wie er - trotz aller Bewunderung für Tolstoi - von Turgenjew lernte, authentisch und lebensnah zu schreiben, denn dessen Figuren, meint er, verweisen auf nichts anderes als auf sich selbst: "Ich wollte nicht über einen Vater und seinen Sohn schreiben. Ich wollte über meinen Vater und mich schreiben. Das war mir all die Jahre über nicht bewusst, in denen ich die Geschichte aufzuschreiben versuchte. Für mich ist Schreiben blind und intuitiv, entweder funktioniert es oder nicht, wie und warum es das tut, kann man kann nur im Nachhinein erklären. Was funktioniert, gewinnt am Ende allein aus sich selbst. Als ich mich also nach zehn Jahren hinsetzte und einige Seiten über etwas verfasst, das mir widerfahren war und das mich so beschämte, dass ich bisher mit keiner Menschenseele darüber gesprochen hatte, und das alles unter meinem eigenen Namen, da hatte ich keine Ahnung, warum ich das tat und was das mit meinem Roman zu tun haben würde. Ich schickte es meinem Lektor, der es als 'manisch bekenntnishaft' beschrieb, und mir schien, dass er ein wenig auf Abstand ging, denn es war beunruhigend und in keinem literarischen Sinne gut. Aber da war etwas anderes, und das sahen wir beide. Was das war? Zuerst einmal Freiheit."Jason Burke beschreibt, wie der Medienwandel nicht nur die Verbreitungskanäle des Terrorismus verändert, sondern auch dessen Struktur. Die Anschläge vom 11. September entsprachen in Inszenierung und Organisation noch dem Fernsehen: zentralisiert, hierarchisch und strikt kontrolliert von Osama bin Laden. Später unter al-Zarkawi rangen einzelne al-Qaida-Gruppen um Aufmerksamkeit im heftig umkämpften Online-Gewerbe. Der IS praktiziert heute mit Smartphones und Handy-Kameras den "führerlosen Dschihad": "Seine Devise lautet, dass die extremistischen Aktivisten Prinzipien, nicht Organisationen bräuchten und ermutigt werden sollten, als Individuen zu handeln, von Texten geleitet, die jeder online finden kann, und ohne zu einer Gruppe gehören zu müssen. Terroristen kommunizieren über verschiedene Kanäle gleichzeitig. Anschläge werden in kleinen Gruppen geplant, nicht zentral. Die Struktur terroristischer Gruppen spiegelt - vielfältig, fragmentiert und dynamisch - die sich wandelnde Struktur der Medien, deren Aufmerksamkeit sie suchen."
New York Magazine (USA), 01.03.2016
 2009 gab es zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten mehr alleinstehende Frauen als verheiratete. Die Entwicklung dieser neuen Population - erwachsene Frauen, die weder ökonomisch noch sozial, sexuell oder bei der Fortpflanzung definiert sind durch einen Ehemann - hat enorme soziale und politische Folgen, erklärt Rebecca Traister. Denn diese Frauen wählen pragmatisch und sie wählen links. "Es ist nicht das erste Mal, dass alleinstehende Frauen einen solch dramatischen Einfluss auf das Land haben. Wenn ihre Zahl wuchs, gab es in der Geschichte immer Veränderungen. Im 19. Jahrhundert, als der Bürgerkrieg und der Zug nach Westen das Zahlenverhältnis der Geschlechter durcheinanderbrachte, sanken die Heiratszahlen weißer Mittelklassefrauen und das Heiratsalter erhöhte sich. Unbeschwert von der Verantwortung für Ehemann und Kinder taten diese Frauen, was sie gelernt hatten: sie widmeten sich öffentlichen Angelegenheiten, in diesem Fall den Reformbewegungen. Viele, wenn auch längst nicht alle, die den Kampf für die Abschaffung der Sklaverei, für Emanzipation und gegen das Lynchen führten, die neue Colleges für Frauen gründeten und leiteten (Mount Holyoke, Smith, Spelman), die als Pioniere in neuen wissenschaftlichen Feldern arbeiteten, waren unverheiratet. Susan B. Anthony; Sarah Grimké; Jane Addams; Alice Paul; Catharine Beecher; Elizabeth Blackwell: Keine dieser Frauen hatte einen Ehemann. Viele andere Aktivistinnen führten Ehen, die zu jener Zeit als sehr unkonventionell galten - kurz, offen oder erst geschlossen, nachdem sich diese Frauen ökonomisch und professionell bereits etabliert hatten."
2009 gab es zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten mehr alleinstehende Frauen als verheiratete. Die Entwicklung dieser neuen Population - erwachsene Frauen, die weder ökonomisch noch sozial, sexuell oder bei der Fortpflanzung definiert sind durch einen Ehemann - hat enorme soziale und politische Folgen, erklärt Rebecca Traister. Denn diese Frauen wählen pragmatisch und sie wählen links. "Es ist nicht das erste Mal, dass alleinstehende Frauen einen solch dramatischen Einfluss auf das Land haben. Wenn ihre Zahl wuchs, gab es in der Geschichte immer Veränderungen. Im 19. Jahrhundert, als der Bürgerkrieg und der Zug nach Westen das Zahlenverhältnis der Geschlechter durcheinanderbrachte, sanken die Heiratszahlen weißer Mittelklassefrauen und das Heiratsalter erhöhte sich. Unbeschwert von der Verantwortung für Ehemann und Kinder taten diese Frauen, was sie gelernt hatten: sie widmeten sich öffentlichen Angelegenheiten, in diesem Fall den Reformbewegungen. Viele, wenn auch längst nicht alle, die den Kampf für die Abschaffung der Sklaverei, für Emanzipation und gegen das Lynchen führten, die neue Colleges für Frauen gründeten und leiteten (Mount Holyoke, Smith, Spelman), die als Pioniere in neuen wissenschaftlichen Feldern arbeiteten, waren unverheiratet. Susan B. Anthony; Sarah Grimké; Jane Addams; Alice Paul; Catharine Beecher; Elizabeth Blackwell: Keine dieser Frauen hatte einen Ehemann. Viele andere Aktivistinnen führten Ehen, die zu jener Zeit als sehr unkonventionell galten - kurz, offen oder erst geschlossen, nachdem sich diese Frauen ökonomisch und professionell bereits etabliert hatten."Elet es Irodalom (Ungarn), 25.02.2016
 Der Filmkritiker und Hochschuldozent zieht eine Bilanz der diesjährigen Berliner Filmfestspiele und ist begeistert von der Risikobereitschaft der Auswahl-Jury für den Wettbewerb, auch wenn der ungarische Beitrag von Bence Fliegauf ("Lily Lane") im Forum kaum herausragen konnte. "Die Kühnheit, die Angela Merkel trotz der europäischen Stimmung und der Meinungsumfragen an den Tag legt, birgt eindeutig Risiken in sich, doch immer mehr Analysen besagen, dass ihre Einstellung für Deutschland über den Humanismus hinaus einen strategischen Vorteil von historischer Dimension bringen kann. Beim diesjährigen Programm agierte die Berlinale nach den vergangenen konservativeren Jahren mit ähnlicher Kühnheit, was sich auszahlte: Die diesjährige Ausgabe war vielleicht die beste der letzten zehn Jahre. Die für den Wettbewerb ausgewählten Filme gingen große formale Risiken ein. (…) Diese Kühnheit vermisse ich in Bence Fliegaufs Film 'Lily Lane'."
Der Filmkritiker und Hochschuldozent zieht eine Bilanz der diesjährigen Berliner Filmfestspiele und ist begeistert von der Risikobereitschaft der Auswahl-Jury für den Wettbewerb, auch wenn der ungarische Beitrag von Bence Fliegauf ("Lily Lane") im Forum kaum herausragen konnte. "Die Kühnheit, die Angela Merkel trotz der europäischen Stimmung und der Meinungsumfragen an den Tag legt, birgt eindeutig Risiken in sich, doch immer mehr Analysen besagen, dass ihre Einstellung für Deutschland über den Humanismus hinaus einen strategischen Vorteil von historischer Dimension bringen kann. Beim diesjährigen Programm agierte die Berlinale nach den vergangenen konservativeren Jahren mit ähnlicher Kühnheit, was sich auszahlte: Die diesjährige Ausgabe war vielleicht die beste der letzten zehn Jahre. Die für den Wettbewerb ausgewählten Filme gingen große formale Risiken ein. (…) Diese Kühnheit vermisse ich in Bence Fliegaufs Film 'Lily Lane'."New York Review of Books (USA), 10.03.2016
 In Dänemark ist sich die Mehrheit von links bis rechts einig: keine Einwanderer mehr und vor allem nicht aus muslimischen Ländern, lernt Hugh Eakin, der angenehm sachlich sowohl die populistischen wie die rationalen Gründe für diese Haltung darlegt. Sie wird vor allem repräsentiert durch die Dänische Volkspartei, die mit ihrer Anti-Immigrationspolitik (bei gleichzeitiger Unterstützung des Wohlfahrtsstaates) alle dänischen Parteien geprägt hat und auch in andere europäische Länder ausstrahlt: In Deutschland "schließen sich seit den Kölner Übergriffen Feministinnen und Mitglieder der Linken, die die 'patriarchalen' Traditionen des 'arabischen Manns' beklagen, den konservativen Opponenten gegen Angela Merkel an. Jüngste Zahlen über die Schwedendemokraten, die gegen Einwanderung sind, zeigen, dass der Anstieg ihrer Popularität auf 28 Prozent im Januar mit einem Niedergang der immigrationsfreundlichen Sozialdemokraten einhergeht. Mit einer derart populistischen Welle konfrontiert, kündigte die schwedische Regierung am 27. Januar an, sie wolle 80.000 Asylsuchende ausweisen."
In Dänemark ist sich die Mehrheit von links bis rechts einig: keine Einwanderer mehr und vor allem nicht aus muslimischen Ländern, lernt Hugh Eakin, der angenehm sachlich sowohl die populistischen wie die rationalen Gründe für diese Haltung darlegt. Sie wird vor allem repräsentiert durch die Dänische Volkspartei, die mit ihrer Anti-Immigrationspolitik (bei gleichzeitiger Unterstützung des Wohlfahrtsstaates) alle dänischen Parteien geprägt hat und auch in andere europäische Länder ausstrahlt: In Deutschland "schließen sich seit den Kölner Übergriffen Feministinnen und Mitglieder der Linken, die die 'patriarchalen' Traditionen des 'arabischen Manns' beklagen, den konservativen Opponenten gegen Angela Merkel an. Jüngste Zahlen über die Schwedendemokraten, die gegen Einwanderung sind, zeigen, dass der Anstieg ihrer Popularität auf 28 Prozent im Januar mit einem Niedergang der immigrationsfreundlichen Sozialdemokraten einhergeht. Mit einer derart populistischen Welle konfrontiert, kündigte die schwedische Regierung am 27. Januar an, sie wolle 80.000 Asylsuchende ausweisen."Weitere Artikel: Mark Lilla beschreibt die Französische Republik als verhängnisvoll schwach angesichts der Herausforderungen durch die globale Wirtschaft und den militanten Islamismus. Einzig Alain Juppe scheint ihm bisher eine erfolgversprechende Strategie entwickelt zu haben. Adam Shatz stellt Alan Lights Biografie über Nina Simone und den darauf basierenden Netflixfilm vor. Und Zadie Smith analysiert mit Hilfe von Schopenhauer Charlie Kaufmans Film "Anomalisa" und Robert Zemeckis "The Polar Express".
Telerama (Frankreich), 25.02.2016
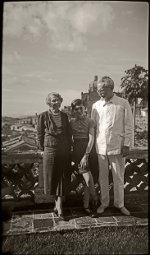 Das Blog delibere.fr präsentiert einige unbekannte Fotos des späten Trotzki kurz vor seinem Tod, aufgenommen vom befreundeten Ehepaar Rosmer. René Solis porträtiert auf delibere.fr Seva Volkov, den Enkelsohn Trotzkis und letzten überlebenden Zeugen seiner Ermordung, der noch einige Jahrzehnte in Trotzkis Haus in Mexiko Stadt weiterlebte, bis es zu einem Museum umfunktioniert wurde. Gilles Walusinski stellt die Fotos vor. Auch Jérémie Maire betrachtet die Fotos in Télérama: "Man sieht die Einsamkeit Trotzkis. Nur einige wenige Pereonen umgeben ihn, seine Frau, Freunde, sein Enkel. Man sieht auch seine Angst, die Leibwächter mit ihren Patronengürteln. Und die Herausforderung, trotz allem zu überleben, während in Europa der Krieg ausbricht. Trotzki sagt es in seinen Schriften: Er weiß, dass seine Tage gezählt sind. Er ist für Stalin kein nützlicher Gegner mehr."
Das Blog delibere.fr präsentiert einige unbekannte Fotos des späten Trotzki kurz vor seinem Tod, aufgenommen vom befreundeten Ehepaar Rosmer. René Solis porträtiert auf delibere.fr Seva Volkov, den Enkelsohn Trotzkis und letzten überlebenden Zeugen seiner Ermordung, der noch einige Jahrzehnte in Trotzkis Haus in Mexiko Stadt weiterlebte, bis es zu einem Museum umfunktioniert wurde. Gilles Walusinski stellt die Fotos vor. Auch Jérémie Maire betrachtet die Fotos in Télérama: "Man sieht die Einsamkeit Trotzkis. Nur einige wenige Pereonen umgeben ihn, seine Frau, Freunde, sein Enkel. Man sieht auch seine Angst, die Leibwächter mit ihren Patronengürteln. Und die Herausforderung, trotz allem zu überleben, während in Europa der Krieg ausbricht. Trotzki sagt es in seinen Schriften: Er weiß, dass seine Tage gezählt sind. Er ist für Stalin kein nützlicher Gegner mehr."New York Times (USA), 28.02.2016
 Das aktuelle Magazin der New York Times widmet sich der Frage, wie wir heute arbeiten. Charles Duhigg beschreibt Googles Projekt Aristoteles, die Suche nach dem perfekten Mitarbeiterteam: "Ein Ergebnis der Studie ist, dass niemand eine Maschine sein möchte, sondern sein Privatleben mitnimmt. Um bei der Arbeit präsent zu sein und uns psychologisch wohlzufühlen, müssen wir sichergehen können, dass wir im Team auch Schwächen teilen können, ohne Diskriminieruung zu fürchten. Wir können nicht nur effizient sein, sondern müssen auch Defizite ansprechen dürfen. Und wir wollen Gehör finden. Wir wollen, dass Arbeit mehr ist als nur Mühe … Es ist paradox, dass Googles intensive Datenanalyse zu den gleichen Ergebnissen führt, die gute Manager immer schon beherzigt haben: In jedem guten Team hören die Mitglieder einander zu und verhalten sich einfühlsam gegenüber den Gefühlen und Bedürfnissen der anderen … Googles Projekt erinnert daran, dass bei Optimierungsversuchen oft vergessen wird, wie wichtig für den Erfolg Erfahrungen sind, emotionaler Austausch, komplizierte Gespräche und Diskussionen darüber, wer wir sein wollen und wie wir uns in der Gruppe fühlen. Dergleichen lässt sich kaum optimieren."
Das aktuelle Magazin der New York Times widmet sich der Frage, wie wir heute arbeiten. Charles Duhigg beschreibt Googles Projekt Aristoteles, die Suche nach dem perfekten Mitarbeiterteam: "Ein Ergebnis der Studie ist, dass niemand eine Maschine sein möchte, sondern sein Privatleben mitnimmt. Um bei der Arbeit präsent zu sein und uns psychologisch wohlzufühlen, müssen wir sichergehen können, dass wir im Team auch Schwächen teilen können, ohne Diskriminieruung zu fürchten. Wir können nicht nur effizient sein, sondern müssen auch Defizite ansprechen dürfen. Und wir wollen Gehör finden. Wir wollen, dass Arbeit mehr ist als nur Mühe … Es ist paradox, dass Googles intensive Datenanalyse zu den gleichen Ergebnissen führt, die gute Manager immer schon beherzigt haben: In jedem guten Team hören die Mitglieder einander zu und verhalten sich einfühlsam gegenüber den Gefühlen und Bedürfnissen der anderen … Googles Projekt erinnert daran, dass bei Optimierungsversuchen oft vergessen wird, wie wichtig für den Erfolg Erfahrungen sind, emotionaler Austausch, komplizierte Gespräche und Diskussionen darüber, wer wir sein wollen und wie wir uns in der Gruppe fühlen. Dergleichen lässt sich kaum optimieren."Außerdem im Dossier: Susan Dominus hinterfragt die Gleichgewichtung von Arbeit und Freizeit. Virginia Heffernan wägt die Vor- und Nachteile von Meetings ab. Julian Faulhaber prüft den Nutzen flexibler Büroarchitektur. Und Brian Finke hat Menschen beim Essen am Schreibtisch fotografiert.
Kommentieren








