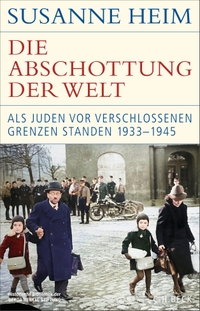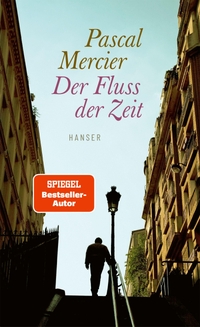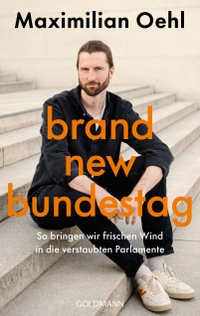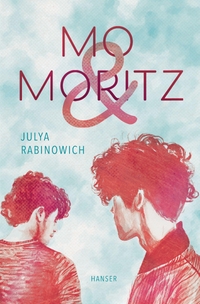Magazinrundschau
Wir schreiben Jeremiaden
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
30.03.2010. In 3 quarks daily lernen wir, wie man zugleich "unberührbar" sein und als arrogant gelten kann. Wired stellt einen Meisterdieb. Tygodnik ist seit 65 Jahren katholisch und trotzdem nicht antisemitisch. Newsweek fragt: Wird das Internet durch das Ipad zu einem total geschlossenen System? Slate bespricht Paul Bermans neues Buch zur Islamdebatte zwischen Pascal Bruckner und Timothy Garton Ash. In Salon analysiert Adam Michnik den Nationalismus in den postkommunistischen Ländern. Im Zürcher Magazin wehrt sich Elisabeth Badinter gegen die Heiligsprechung von Mutterliebe.
3 quarks daily | New Yorker | Das Magazin | Outlook India | Merkur | Walrus Magazine | Sinn und Form | Eurozine | New York Times | Wired | Tygodnik Powszechny | Newsweek | Le Monde | Slate | Buzzmachine | Salon.eu.sk
3 quarks daily (USA), 29.03.2010
 Namit Arora bespricht die Erinnerungen des "Unberührbaren" Omprakash Valmiki. Der Artikel ist voller Links zu anderen Büchern von Dalits, die gerade ein neues mächtiges Genre in der indischen Literatur und gleichzeitig eine große Widerstandsbewegung begründen. "'Joothan', erzählt in scharfen Vignetten, ist auch der bemerkenswerte Bericht einer seltenen indischen Reise, die einen Jungen von extrem elenden sozioökonomischen Bedingungen zur Prominenz als Autor und Sozialkritiker führte. [...] In den letzten zwei Absätzen nimmt er seine Kritiker vorweg: 'Bis heute bleibt die Kaste ein herausragender Faktor im sozialen Leben. So lange die Leute nicht wissen, dass du ein Dalit bist, läuft alles gut. In dem Augenblick, in dem sie über deine Kaste Bescheid wissen, ändert sich alles. Das Gemurmel schlitzt deine Adern wie ein Messer auf. Armut, Analphabetentum, gescheiterte Existenzen, der Schmerz, draußen vor der Tür zu stehen - was können die zivilisierten Savarna Hindus davon wissen? Warum ist meine Kaste meine einzige Identität? Viele Freunde weisen mich auf die Lautstärke und Arroganz meines Schreibens hin. Sie unterstellen mir, dass ich mich in einen engen Kreis eingeschlossen habe. Sie sagen, dass der literarische Ausdruck auf das Universelle zielen sollte. Ein Schriftsteller sollte sich nicht auf ein enges, begrenztes Lebensgebiet beschränken. Das heißt, wenn ich mich als Dalit auf meine Herkunft berufe und zu einer Haltung komme, die meiner Situation entspricht, dann gelte ich als arrogant. Denn in ihren Augen bin ich nur ein SC, einer, der draußen vor der Tür steht."
Namit Arora bespricht die Erinnerungen des "Unberührbaren" Omprakash Valmiki. Der Artikel ist voller Links zu anderen Büchern von Dalits, die gerade ein neues mächtiges Genre in der indischen Literatur und gleichzeitig eine große Widerstandsbewegung begründen. "'Joothan', erzählt in scharfen Vignetten, ist auch der bemerkenswerte Bericht einer seltenen indischen Reise, die einen Jungen von extrem elenden sozioökonomischen Bedingungen zur Prominenz als Autor und Sozialkritiker führte. [...] In den letzten zwei Absätzen nimmt er seine Kritiker vorweg: 'Bis heute bleibt die Kaste ein herausragender Faktor im sozialen Leben. So lange die Leute nicht wissen, dass du ein Dalit bist, läuft alles gut. In dem Augenblick, in dem sie über deine Kaste Bescheid wissen, ändert sich alles. Das Gemurmel schlitzt deine Adern wie ein Messer auf. Armut, Analphabetentum, gescheiterte Existenzen, der Schmerz, draußen vor der Tür zu stehen - was können die zivilisierten Savarna Hindus davon wissen? Warum ist meine Kaste meine einzige Identität? Viele Freunde weisen mich auf die Lautstärke und Arroganz meines Schreibens hin. Sie unterstellen mir, dass ich mich in einen engen Kreis eingeschlossen habe. Sie sagen, dass der literarische Ausdruck auf das Universelle zielen sollte. Ein Schriftsteller sollte sich nicht auf ein enges, begrenztes Lebensgebiet beschränken. Das heißt, wenn ich mich als Dalit auf meine Herkunft berufe und zu einer Haltung komme, die meiner Situation entspricht, dann gelte ich als arrogant. Denn in ihren Augen bin ich nur ein SC, einer, der draußen vor der Tür steht."Wired (USA), 18.04.2010
Wired pflegt eine unheilbare romantische Liebe für Meisterverbrecher. Diesmal erzählt Joshua Bearman die Geschichte des Meisterdiebs Gerald Blanchard, der unter anderem den Sissi-Stern im Wiener Schloss Schönbrunn klaute. Gesehen hat er das gut bewachte Stück bei einem offiziellen Besuch mit seiner Frau und seinem Schwiegervater. Keine lange Planung! Noch im Schloss "fing er sofort an zu arbeiten, fing er jedes Detail des Zimmers mit seiner Videokamera ein". Am nächsten Tag hatte er das Schmuckstück. "Später gelangte der Sissi-Stern im Beatmungsgerät einer Tauchausrüstung in seine Heimatstation in Kanada, wo Blanchard versammeln würde, was die Ankläger später in Ermangelung einer besseren Bezeichnung die Kriminelle Blanchard Organisation nennen würde. Blanchard, der aus seinem enzyklopädischen Wissen über Überwachung und Elektronik schöpfte, wurde ein kriminelles Meisterhirn. Der Sissi-Stern war der Raub, der ihn von einem erfolgreichen und erfahrenen Dieb in einem kriminellen Virtuosen verwandeln sollte. 'Durchtrieben, clever, hinterhältig und kreativ', wie ihn ein Ankläger nennen sollte, entzog sich Blanchard jahrelang der Polizei. Aber schließlich machte er einen Fehler. Und dieser Fehler sollte zwei Beamte der bescheidenen Polizei von Winnipeg, Kanada, auf einen wilden Trip durch die High-Tech-Gaunerei in Afrika, Kanada und Europa führen. Mitch McCormick, einer der Untersuchungsbeamten aus Winnipeg, sagt: 'Wir hatten so etwas niemals vorher gesehen.'"
Wie wird das Ipad und wie werden in seinem Gefolge andere Tablet-Computer die Welt verändern?, fragt Wired in einem faszinierenden Dossier. Steven Levy sieht die Entstehung dieser neuen Geräte zunächst auch als Episode im Kampf der Giganten Apple mit seiner Zugangskontrolle und Google mit seinem Traum von der Wolke: "Apple will lieber die makellose Ordnung der Autokratie als die chaotische Freiheit eines offenen Systems." Außerdem entwickeln einige Netzvordenker Visionen für den Tabletcomputer. Kevin Kelly zum Beispiel sieht ihn eher als Kamera: "Wenn jemand durch den Bildschirm zu dir spricht, bewege den Bildschirm und er wird dir den Raum des Anrufers zeigen... Viele sehen den Bildschirm als einen vielfarbigen, hochauflösenden E-Reader, aber dieses Sehgerät handelt ebenso sehr von bewegten Bildern wie von Text. Man kann damit nicht nur betrachten, sondern auch machen, und es wird als tragbare Kinoleinwand dienen, möglicherweise 3D-tauglich. Du wirst mit der Leinwand 'filmen'! Es wird sowohl die Buch- als auch die Filmindustrie neu definieren, denn es schafft ein transmediales Gerät, das Buch und Video verschmelzen wird. Du kannst Fernsehen lesen, Bücher betrachten, Filme berühren."
Wie wird das Ipad und wie werden in seinem Gefolge andere Tablet-Computer die Welt verändern?, fragt Wired in einem faszinierenden Dossier. Steven Levy sieht die Entstehung dieser neuen Geräte zunächst auch als Episode im Kampf der Giganten Apple mit seiner Zugangskontrolle und Google mit seinem Traum von der Wolke: "Apple will lieber die makellose Ordnung der Autokratie als die chaotische Freiheit eines offenen Systems." Außerdem entwickeln einige Netzvordenker Visionen für den Tabletcomputer. Kevin Kelly zum Beispiel sieht ihn eher als Kamera: "Wenn jemand durch den Bildschirm zu dir spricht, bewege den Bildschirm und er wird dir den Raum des Anrufers zeigen... Viele sehen den Bildschirm als einen vielfarbigen, hochauflösenden E-Reader, aber dieses Sehgerät handelt ebenso sehr von bewegten Bildern wie von Text. Man kann damit nicht nur betrachten, sondern auch machen, und es wird als tragbare Kinoleinwand dienen, möglicherweise 3D-tauglich. Du wirst mit der Leinwand 'filmen'! Es wird sowohl die Buch- als auch die Filmindustrie neu definieren, denn es schafft ein transmediales Gerät, das Buch und Video verschmelzen wird. Du kannst Fernsehen lesen, Bücher betrachten, Filme berühren."
Tygodnik Powszechny (Polen), 28.03.2010
 Die liberal-katholische Wochenzeitung feiert ihr 65-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gibt sie unter dem provokanten Titel "Zydownik Powszechny" (etwa: Jüdische Wochenzeitung, eine Abwandlung des Namens, die in kommunistischen Zeiten als Beleidigung benutzt wurde) eine Beilage mit ihren bekanntesten Texten zum polnisch-jüdischen Verhältnis heraus. Der Chefredakteur Adam Boniecki schreibt dazu: "Jemanden, der 2010 den Artikel von Jerzy Turowicz liest, mag es verwundern, dass dieser so breit und mit großem Nachdruck erklärt, was offensichtlich erscheint. Etwa, dass man nicht gleichzeitig bewusster Katholik und Antisemit sein kann. Gerade diese Offensichtlichkeit ist eine wunderbare Frucht vergangener Anstrengungen. Nur: Ist es wirklich für alle offensichtlich?"
Die liberal-katholische Wochenzeitung feiert ihr 65-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gibt sie unter dem provokanten Titel "Zydownik Powszechny" (etwa: Jüdische Wochenzeitung, eine Abwandlung des Namens, die in kommunistischen Zeiten als Beleidigung benutzt wurde) eine Beilage mit ihren bekanntesten Texten zum polnisch-jüdischen Verhältnis heraus. Der Chefredakteur Adam Boniecki schreibt dazu: "Jemanden, der 2010 den Artikel von Jerzy Turowicz liest, mag es verwundern, dass dieser so breit und mit großem Nachdruck erklärt, was offensichtlich erscheint. Etwa, dass man nicht gleichzeitig bewusster Katholik und Antisemit sein kann. Gerade diese Offensichtlichkeit ist eine wunderbare Frucht vergangener Anstrengungen. Nur: Ist es wirklich für alle offensichtlich?" Außerdem: Ein Interview mit dem Künstler Zbigniew Libera, der für sein "Lego-KZ" berühmt wurde. Und der neue Literaturpreis der Stadt Gdansk (Danzig) wird vorgestellt - der "Europäische Freiheitsdichter": Am Wochenende wurde bekannt gegeben, dass der Weißrusse Uladsimir Arlou ausgezeichnet wurde (hier die Pressemitteilung und einige Fotos).
Außerdem: Ein Interview mit dem Künstler Zbigniew Libera, der für sein "Lego-KZ" berühmt wurde. Und der neue Literaturpreis der Stadt Gdansk (Danzig) wird vorgestellt - der "Europäische Freiheitsdichter": Am Wochenende wurde bekannt gegeben, dass der Weißrusse Uladsimir Arlou ausgezeichnet wurde (hier die Pressemitteilung und einige Fotos).Newsweek (USA), 29.03.2010
 Zugleich begeisternd und unheimlich erscheint das Ipad Daniel Lyons: Wenn es sich durchsetzt, wird Steve Jobs zum Big Brother: "Dieses elegante kleine Gerät ist ein Ausbund von Jobs' aufgeblasenen Ambitionen, ein weiteres Beispiel seines Willens, das übliche Gerede hinter sich zu lassen und das Ethos von Silicon Valley an seinen Willen zu binden. Das Internet gilt als das Medium der Freiheit und der Optionen - und hier kommt nun Steve Jobs mit einem Internet als total geschlossenem System. Apple verkauft Ihnen nicht nur das Gerät, sondern betreibt auch den einzigen Laden auf dem Planeten, der Software dafür verkauft." In einem zweiten Artikel stellt sich die Schriftstellerin Anna Quindlen die Frage, die sich jetzt stellt: "Hm, was ist das Buch überhaupt? Ist es sein Körper oder seine Seele?" Und schließlich erklärt der Apple-Mitbegründer Steve Wozniak, warum es besser sein wird, zwei Ipads zu haben statt einem. Klar doch, sobald wir Wozniaks Gehalt haben.
Zugleich begeisternd und unheimlich erscheint das Ipad Daniel Lyons: Wenn es sich durchsetzt, wird Steve Jobs zum Big Brother: "Dieses elegante kleine Gerät ist ein Ausbund von Jobs' aufgeblasenen Ambitionen, ein weiteres Beispiel seines Willens, das übliche Gerede hinter sich zu lassen und das Ethos von Silicon Valley an seinen Willen zu binden. Das Internet gilt als das Medium der Freiheit und der Optionen - und hier kommt nun Steve Jobs mit einem Internet als total geschlossenem System. Apple verkauft Ihnen nicht nur das Gerät, sondern betreibt auch den einzigen Laden auf dem Planeten, der Software dafür verkauft." In einem zweiten Artikel stellt sich die Schriftstellerin Anna Quindlen die Frage, die sich jetzt stellt: "Hm, was ist das Buch überhaupt? Ist es sein Körper oder seine Seele?" Und schließlich erklärt der Apple-Mitbegründer Steve Wozniak, warum es besser sein wird, zwei Ipads zu haben statt einem. Klar doch, sobald wir Wozniaks Gehalt haben.Le Monde (Frankreich), 27.03.2010
Berlusconi hat bei den Regionalwahlen überraschende Erfolge gefeiert, unter anderem in Süditalien (mehr dazu hier). Hatte der Journalist Roberto Saviano recht, als er letzte Woche in Le Monde eine internationale Kontrolle der Wahlen insbesondere in den von der Mafia kontrollierten Gebieten forderte? Allein in Kalabrien liefen gegen 35 der 50 Regionalpolitiker Ermittlungsverfahren oder sie seien schon verurteilt. Saviano, der seit seinem Buch über die Camorra unter Polizeischutz leben muss, rechnet in seinem Text mit der italienischen Politik gnadenlos ab. "Man geht hier in Italien grundsätzlich davon aus, dass die Politik keine Richtung hat, keine Ideen, keine Konzepte. Deshalb erwarten und rufen die Leute nach etwas anderem... Sie hat keinerlei Glaubwürdigkeit mehr. Nichts als ein leeres Gehäuse, das man mit Worten füllen kann und mitunter selbst das nicht mehr. Und so kommt es dazu, dass man vielleicht nicht mehr imstande ist, sie überhaupt zu nutzen. Wenn das aus der Politik wird, hat die Mafia schon gewonnen. Denn niemand schafft es, größere Sicherheiten zu bieten als sie: die eines Jobs, eines Einkommens, einer Wohnung."
Slate (USA), 25.03.2010
Auch in anderen Ländern geht die Debatte um Islamkritik beziehungsweise "Fundamentalismus der Aufklärung" weiter, die im Jahr 2007 durch einen Artikel Pascal Bruckners in Perlentaucher und signandsight.com lanciert wurde. Paul Berman hatte sie bereits 2007 in einem langen Porträt über Tariq Ramadan aufgegriffen und hat diesen Text nun zu einem Buch ausgebaut, das demnächst erscheint: "The Flight of the Intellectuals". Ron Rosenbaum greift Bermans Frage auf, warum die Intellektuellen 1989 Salman Rushdie noch weithin verteidigten, während sie Ayaan Hirsi Ali die gleiche Solidarität versagten: "Berman mag es abstreiten, aber ich glaube, der Subtext seiner Kritik an Alis Kritikern ist, dass der Protest gegen islamistische Todesdrohungen zwanzig Jahre nach der Rushdie-Affäre wesentlich mehr physischen Mut fordert als die Intellektuellen bereit sind aufzubringen. Sie greifen eher zu kleinlicher Kritik, die ihnen als Feigenblatt dient, um der Gefahr auszuweichen."
Buzzmachine (USA), 23.03.2010
"Das Problem mit Kommentaren sind nicht die Kommentare" überschreibt Jeff Jarvis seinen Blogeintrag, in dem er sich mit der Kritik von Bloggern an bösen, gemeinen oder schlicht widerlichen Leserkommentaren auseinandersetzt. Das Problem sei vielmehr, dass viele Blogger das Internet als Medium betrachteten. "Man will es hübsch gebündelt, sauber und kontrolliert haben, wie Zeitungen und Magazine es vormachen, und wenn jemand einen Haufen drauf setzt - also einen fiesen Kommentar - denken wir, jetzt sei die ganze Sache ruiniert... Aber wie ich von Doc Searls (Blog) gelernt habe, ist das Internet kein Medium - begreift man es als ein Medium, führt das tatsächlich zu einer Reihe von Annahmen über Kontrolle und Eigentum und Regulierung. Nein, Doc sagt, das Internet ist ein Ort. Es ist ein Park oder eine Straßenkreuzung, wo Leute vorbeikommen und sich treffen, reden und streiten, Recht haben oder sich irren, wo sie sich vernetzen und Informationen und Aktionen öffnen. Es ist ein öffentlicher Ort. (A propos Öffentlichkeit, sehen Sie es doch mal so: Wenn Sie in New York an einer Person vorbeigehen, die flucht, schreiben Sie dann gleich die ganze Stadt ab? Also ich nicht. Vor allem, weil ich die Person sein könnte, an der Sie vorbeigehen.)"
Salon.eu.sk (Slowakei), 24.03.2010
 Salon hat eine in der Gazeta Wyborcza veröffentlichte Rede Adam Michniks ins Englische übersetzt, in der er den Nationalismus als böse Hinterlassenschaft des Kommunismus in Osteuropa anprangert: "Mit bitterem Zynismus meinte Cioran: 'Das Volk, wie es ist, befördert Despotismus. Es hält große Prüfungen aus, manchmal verlangt es sogar nach ihnen und dann rebelliert es gegen sie, nur um wieder neue, noch monströsere als die vorherigen zu suchen.' Zum Glück ist der Kommunismus ausgestorben. Aber er hat den Nationalismus zurückgelassen, der von Leuten praktiziert wird, die ein tierisches Vergnügen daraus ziehen, ihre Humanität zu verleugnen. Er lebt in Form von Nostalgie, einer Phobie, einer antidemokratischen, antiliberalen, antieuropäischen und antiamerikanischen Ideologie. Menschen, die so denken, trifft man in allen politischen Eliten in allen postkommunistischen Ländern - von Bukarest und Moskau bis Berlin, von Warschau bis Prag, von Zagreb bis Belgrad. Nationalismus in der postkommunistischen Zeit kann viele Formen annehmen: die des nostalgischen Kommunisten Milosevic, des postsowjetischen Diktators Putin oder der postsowjetischen Antikommunisten Viktor Orban und Jaroslaw Kaczynski."
Salon hat eine in der Gazeta Wyborcza veröffentlichte Rede Adam Michniks ins Englische übersetzt, in der er den Nationalismus als böse Hinterlassenschaft des Kommunismus in Osteuropa anprangert: "Mit bitterem Zynismus meinte Cioran: 'Das Volk, wie es ist, befördert Despotismus. Es hält große Prüfungen aus, manchmal verlangt es sogar nach ihnen und dann rebelliert es gegen sie, nur um wieder neue, noch monströsere als die vorherigen zu suchen.' Zum Glück ist der Kommunismus ausgestorben. Aber er hat den Nationalismus zurückgelassen, der von Leuten praktiziert wird, die ein tierisches Vergnügen daraus ziehen, ihre Humanität zu verleugnen. Er lebt in Form von Nostalgie, einer Phobie, einer antidemokratischen, antiliberalen, antieuropäischen und antiamerikanischen Ideologie. Menschen, die so denken, trifft man in allen politischen Eliten in allen postkommunistischen Ländern - von Bukarest und Moskau bis Berlin, von Warschau bis Prag, von Zagreb bis Belgrad. Nationalismus in der postkommunistischen Zeit kann viele Formen annehmen: die des nostalgischen Kommunisten Milosevic, des postsowjetischen Diktators Putin oder der postsowjetischen Antikommunisten Viktor Orban und Jaroslaw Kaczynski."New Yorker (USA), 05.04.2010
 In einem wunderbaren Artikel stellt Adam Gopnik die französische Bewegung Le Fooding vor, die gegen die Klischees der klassischen französischen Küche und die "Diktatur" eines zum Fossil gewordenen Gastronomiebegriffs anarbeitet. So ist ihr Restaurantführer etwa auch für Fastfood und Pizza offen, einer ihrer Gründer, der Journalist Alexandre Cammas, fasst die Idee so zusammen: "Keine Kategorisierungen mehr... Keine Regeln! Exzellenz ist die einzige Regel." Gopniks Recherchen führten ihn auch nach Paris, wo er herausfand: "Was Le Fooding auszeichnet, ist, dass es sich in der Tat gegen einen allzu europäischen, traditionslastigen Küchenansatz wendet. Slow ist das Letzte, was die französische Küche sein will, sie ist schon langsam genug. Das Ziel der Fooding-Bewegung ist, den französischen Snobismus in Form seiner bornierten, hyperheiklen Diskriminierung zu überwinden, während das Ziel der Slowfood-Bewegung darin besteht ... eine bornierte Hyper-Diskriminierung aufzubauen. Fooding ist eine Form kulinarischer Futurismus: Sie will, dass es auf den Tischen genauso schnell zugeht wie im modernen Leben."
In einem wunderbaren Artikel stellt Adam Gopnik die französische Bewegung Le Fooding vor, die gegen die Klischees der klassischen französischen Küche und die "Diktatur" eines zum Fossil gewordenen Gastronomiebegriffs anarbeitet. So ist ihr Restaurantführer etwa auch für Fastfood und Pizza offen, einer ihrer Gründer, der Journalist Alexandre Cammas, fasst die Idee so zusammen: "Keine Kategorisierungen mehr... Keine Regeln! Exzellenz ist die einzige Regel." Gopniks Recherchen führten ihn auch nach Paris, wo er herausfand: "Was Le Fooding auszeichnet, ist, dass es sich in der Tat gegen einen allzu europäischen, traditionslastigen Küchenansatz wendet. Slow ist das Letzte, was die französische Küche sein will, sie ist schon langsam genug. Das Ziel der Fooding-Bewegung ist, den französischen Snobismus in Form seiner bornierten, hyperheiklen Diskriminierung zu überwinden, während das Ziel der Slowfood-Bewegung darin besteht ... eine bornierte Hyper-Diskriminierung aufzubauen. Fooding ist eine Form kulinarischer Futurismus: Sie will, dass es auf den Tischen genauso schnell zugeht wie im modernen Leben."Weitere Artikel: Judith Thurman berichtet über Philip Roth - und John Grisham - als Opfer einer Zeitungsente: Ein italienischer Journalist erfand für die Berlusconi-nahe Boulevardzeitung Libero Interviews, in denen er prominenten Amerikanern Obama-kritische Äußerungen andichtete. John Lahr bespricht eine Inszenierung von Tennessee Williams' "Glasmenagerie". Und David Denby sah im Kino Tim Blake Nelsons Thriller "Leaves of Grass", Raymond De Felittas Komödie "City Island" und Andy Tennants Actionkomödie "The Bounty Hunter". Zu lesen ist außerdem die Erzählung "Gavin Highly" von Janet Frame und Lyrik von Cornelius Eady und Matthew Dickman.
Das Magazin (Schweiz), 29.03.2010
 Die französische Philosophin Elisabeth Badinter hat gerade ein heftig umstrittenes Buch über Frauen und Mütter veröffentlicht. Darin wehrt sie sich gegen die jetzt auch in Frankreich um sich greifende Tendenz, die Mutterliebe zu heiligen. Um die Situation heute zu verstehen, lohnt es sich, erklärt sie Daniel Binswanger, den Wandel des Mutter-Begriffs im 18. Jahrhundert zu betrachten. "'In den Sechzigerjahren des 18. Jahrhunderts ist etwas geschehen, das sich mit der heutigen Entwicklung vergleichen lässt', sagt Badinter. 'Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde das Stillen des eigenen Babys von einem gesellschaftlichen Tabu zu einer moralischen Pflicht. Am Ende dieser Entwicklung stand die bürgerliche Ehe des 19. Jahrhunderts, das heißt eine Institution, die den Frauen das Gegenteil von Befreiung brachte. Da darf man sich schon fragen, ob die aggressive Propagierung der Stillpflicht, die wir heute erleben, nicht von Neuem die Rechtlosigkeit der Frauen fördern wird.'"
Die französische Philosophin Elisabeth Badinter hat gerade ein heftig umstrittenes Buch über Frauen und Mütter veröffentlicht. Darin wehrt sie sich gegen die jetzt auch in Frankreich um sich greifende Tendenz, die Mutterliebe zu heiligen. Um die Situation heute zu verstehen, lohnt es sich, erklärt sie Daniel Binswanger, den Wandel des Mutter-Begriffs im 18. Jahrhundert zu betrachten. "'In den Sechzigerjahren des 18. Jahrhunderts ist etwas geschehen, das sich mit der heutigen Entwicklung vergleichen lässt', sagt Badinter. 'Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde das Stillen des eigenen Babys von einem gesellschaftlichen Tabu zu einer moralischen Pflicht. Am Ende dieser Entwicklung stand die bürgerliche Ehe des 19. Jahrhunderts, das heißt eine Institution, die den Frauen das Gegenteil von Befreiung brachte. Da darf man sich schon fragen, ob die aggressive Propagierung der Stillpflicht, die wir heute erleben, nicht von Neuem die Rechtlosigkeit der Frauen fördern wird.'"Außerdem: Finn Canonica und David Iselin beschreiben die Vor- und Nachteile der perfektionierten japanischen Dienstleistungsgesellschaft.
Outlook India (Indien), 05.04.2010
 Indien ist die viertgrößte Nation der illegalen Downloader, berichten sieben Reporter im Aufmacher von Outlook India. Die Gründe dafür sind vielfältig. "'Inder sparen ihr Geld genauso wie ihre Energie', sagt Dr. Harish Shetty, ein in Bombay praktizierender Psychiater. 'Außerdem downloaden Inder die ganze Zeit, weil es ihnen Spaß macht, das in ihrem privaten Bereich zu tun.' Es ist auch eine Generationsfrage. Murthy [Chef einer Marketingfirma] nennt als Beispiel seinen 12-jährigen Sohn, der Software-Anleitungen herunterlud und seinen Vater überraschte, als er in wenigen Wochen ein neues Paket ohne jedes formelle Training meisterte. 'Mit schrecklich intelligenten Menschen wie ihm', sagt der stolze Vater, 'müssen Musiklabels, Musiker, Schauspieler, Regisseure, Produzenten und Softwareprogrammierer neue Wege finden, um Geld zu verdienen. Es reicht einfach nicht, CDs rauszuhauen in der Hoffnung, dass Konsumenten wie er sie weiterhin kaufen werden.'"
Indien ist die viertgrößte Nation der illegalen Downloader, berichten sieben Reporter im Aufmacher von Outlook India. Die Gründe dafür sind vielfältig. "'Inder sparen ihr Geld genauso wie ihre Energie', sagt Dr. Harish Shetty, ein in Bombay praktizierender Psychiater. 'Außerdem downloaden Inder die ganze Zeit, weil es ihnen Spaß macht, das in ihrem privaten Bereich zu tun.' Es ist auch eine Generationsfrage. Murthy [Chef einer Marketingfirma] nennt als Beispiel seinen 12-jährigen Sohn, der Software-Anleitungen herunterlud und seinen Vater überraschte, als er in wenigen Wochen ein neues Paket ohne jedes formelle Training meisterte. 'Mit schrecklich intelligenten Menschen wie ihm', sagt der stolze Vater, 'müssen Musiklabels, Musiker, Schauspieler, Regisseure, Produzenten und Softwareprogrammierer neue Wege finden, um Geld zu verdienen. Es reicht einfach nicht, CDs rauszuhauen in der Hoffnung, dass Konsumenten wie er sie weiterhin kaufen werden.'"Merkur (Deutschland), 01.04.2010
 Siegfried Kohlhammer macht sich einige zum Teil recht unbehagliche Gedanken zur misslingenden Integration von Muslimen in Europa, für die er dezidiert nicht die europäischen Gesellschaften verantwortlich macht. "Keine andere Migrantengruppe beklagt sich so häufig über Diskriminierung und Mangel an Respekt und stellt derart exorbitante Forderungen, deren Zurückweisung dann als weiterer Beweis für Islamophobie gilt. Als der frühere englische Innenminister Charles Clarke 2005 erklärte, über die Einführung des Kalifats und der Scharia, die Aufhebung der Gleichheit der Geschlechter und der Meinungsfreiheit könne es keine Verhandlungen geben, sah ein Vertreter von Hizb ut-Tahrir Britain darin 'einen Angriff gegen den Islam'. Ein dänischer Muslimführer beklagte sich 2004 über den Säkularismus der dänischen Gesellschaft als 'eine widerwärtige Form der Unterdrückung'. Und keine andere Migrantengruppe droht derart ungeniert und ungestraft - und erfolgreich - mit Gewalt, sobald sie sich gekränkt oder herausgefordert fühlt."
Siegfried Kohlhammer macht sich einige zum Teil recht unbehagliche Gedanken zur misslingenden Integration von Muslimen in Europa, für die er dezidiert nicht die europäischen Gesellschaften verantwortlich macht. "Keine andere Migrantengruppe beklagt sich so häufig über Diskriminierung und Mangel an Respekt und stellt derart exorbitante Forderungen, deren Zurückweisung dann als weiterer Beweis für Islamophobie gilt. Als der frühere englische Innenminister Charles Clarke 2005 erklärte, über die Einführung des Kalifats und der Scharia, die Aufhebung der Gleichheit der Geschlechter und der Meinungsfreiheit könne es keine Verhandlungen geben, sah ein Vertreter von Hizb ut-Tahrir Britain darin 'einen Angriff gegen den Islam'. Ein dänischer Muslimführer beklagte sich 2004 über den Säkularismus der dänischen Gesellschaft als 'eine widerwärtige Form der Unterdrückung'. Und keine andere Migrantengruppe droht derart ungeniert und ungestraft - und erfolgreich - mit Gewalt, sobald sie sich gekränkt oder herausgefordert fühlt."Weitere Artikel: Der inzwischen in Israel lebende Schriftsteller Chaim Noll versucht den Ungeist zu fassen zu bekommen, der die Neue Klasse in den sozialistischen Länder antrieb und, sofern sie ihr eigenes Ende überlebt haben, noch immer antreibt. Der Soziologe Alan Johnson versucht zu begreifen, was Europas Linke an Slavoj Zizek findet, der noch immer dem egalitären Terror und dem autoritären Kommunismus das Wort rede. Theodore Dalrymple wettert gegen Le Corbusier: "Le Corbusier bedeutete für die Architektur, was Pol Pot für die Gesellschaftsreform war." (Hier der Originaltext) Und Walter Laqueur warnt Europa davor, seine eigene Schwäche zu rationalisieren.
Walrus Magazine (Kanada), 01.04.2010
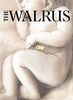 Wer noch daran glaubt, mit den Kategorien links oder rechts feste politische Positionen beschreiben zu können, sollte Stephen Henighans Porträt des kanadischen Schriftstellers und Vorsitzenden des Internationalen PEN, John Ralston Saul, lesen. Nach einem bewegten beruflichen und intellektuellem Leben ist Saul zu dem Schluss gelangt, dass die herrschenden neoliberalen Eliten von "Selbsthass" geplagt sind und das kanadische Erbe verspielen. Dieses Erbe definiert er als eine von den Ureinwohnern inspirierte "Mischzivilisation". Einige Ureinwohner sind damit jedoch nicht einverstanden: "Als ich letztes Jahr an einem Panel in Toronto teilnahm", schreibt Henighan am Ende seines Artikels, "war ich überrascht, mit welcher Vehemenz urbane, rassisch gemischte Intellektuelle, die nicht die Sprachen ihrer Ahnen sprachen, alle Vorstellungen von sich wiesen, wonach sie zu einer gemischten Kultur gehören sollten, und die ihre Identität in Form von der Sorte kultureller und rassischer Reinheit verteidigten, die Saul ablehnt."
Wer noch daran glaubt, mit den Kategorien links oder rechts feste politische Positionen beschreiben zu können, sollte Stephen Henighans Porträt des kanadischen Schriftstellers und Vorsitzenden des Internationalen PEN, John Ralston Saul, lesen. Nach einem bewegten beruflichen und intellektuellem Leben ist Saul zu dem Schluss gelangt, dass die herrschenden neoliberalen Eliten von "Selbsthass" geplagt sind und das kanadische Erbe verspielen. Dieses Erbe definiert er als eine von den Ureinwohnern inspirierte "Mischzivilisation". Einige Ureinwohner sind damit jedoch nicht einverstanden: "Als ich letztes Jahr an einem Panel in Toronto teilnahm", schreibt Henighan am Ende seines Artikels, "war ich überrascht, mit welcher Vehemenz urbane, rassisch gemischte Intellektuelle, die nicht die Sprachen ihrer Ahnen sprachen, alle Vorstellungen von sich wiesen, wonach sie zu einer gemischten Kultur gehören sollten, und die ihre Identität in Form von der Sorte kultureller und rassischer Reinheit verteidigten, die Saul ablehnt."Außerdem: Silver Donald Cameron erzählt, wie der Premierminister von Bhutan, Jigmi Y. Thinley, mit Hilfe der GPI Atlantic den "gross national happiness"-Faktor, kurz GNH, in seinem Land heben will. Thinley erklärt das auch selbst sehr schön in einem Video auf Youtube. Tim Mckeough stellt den minimalistischen und dennoch sehr spielerischen japanischen Designer Oki Sato vor. Lesen dürfen wir auch einen Auszug aus Steven Heightons neuem Roman "Every Lost Country".
Sinn und Form (Deutschland), 29.03.2010
 Wie schon in den Zeitungen berichtet, ist in dieser Ausgabe ein kritischer Essay von W.G. Sebald über Jurek Beckers Romane abgedruckt. Uwe Schütte schreibt in seiner Anmerkung zu dem Essay, die wir in einem sehr karg bemessenen Auszug lesen dürfen: " Als literarisches Kernproblem identifiziert er 'die Absenz des Autors' und dessen stete Sorge, 'daß er nicht mit hineingerät in sein Werk', das unter dem Vorzeichen eines 'Erinnerungsembargos' stehe. Dies sei, wie Sebald am Ende konzediert, als Schutzmechanismus zu verstehen, um 'das Aufsteigen der Erinnerung' an die Becker durch seine Ghetto- und KZ-Kindheit 'aufgebürdete Last' zu verhindern, damit sie nicht 'das sich erinnernde Subjekt mit ihrer zerstörerischen Gewalt einholt'. 'Ich möchte zu ihnen hinabsteigen und finde den Weg nicht' - der Titel unterstreicht Sebalds Diagnose, denn er zitiert den Schlußsatz von Beckers Essay über Fotos aus dem Ghetto Lodz, worin dieser eingesteht, auch mit Hilfe der Aufnahmen die verschüttete Erinnerung an die Kindheit nicht freilegen zu können."
Wie schon in den Zeitungen berichtet, ist in dieser Ausgabe ein kritischer Essay von W.G. Sebald über Jurek Beckers Romane abgedruckt. Uwe Schütte schreibt in seiner Anmerkung zu dem Essay, die wir in einem sehr karg bemessenen Auszug lesen dürfen: " Als literarisches Kernproblem identifiziert er 'die Absenz des Autors' und dessen stete Sorge, 'daß er nicht mit hineingerät in sein Werk', das unter dem Vorzeichen eines 'Erinnerungsembargos' stehe. Dies sei, wie Sebald am Ende konzediert, als Schutzmechanismus zu verstehen, um 'das Aufsteigen der Erinnerung' an die Becker durch seine Ghetto- und KZ-Kindheit 'aufgebürdete Last' zu verhindern, damit sie nicht 'das sich erinnernde Subjekt mit ihrer zerstörerischen Gewalt einholt'. 'Ich möchte zu ihnen hinabsteigen und finde den Weg nicht' - der Titel unterstreicht Sebalds Diagnose, denn er zitiert den Schlußsatz von Beckers Essay über Fotos aus dem Ghetto Lodz, worin dieser eingesteht, auch mit Hilfe der Aufnahmen die verschüttete Erinnerung an die Kindheit nicht freilegen zu können."Eurozine (Österreich), 26.03.2010
 In einem Artikel für Index on Censorship, den Eurozine online gestellt hat, erklären Ron Deibert und Rafal Rohozinski von der OpenNet-Initiative, wie die Zensur der 'nächsten Generation' das Web kontrollieren will. Zum Beispiel so: "Eine der am schnellsten wachsenden und effektivsten Kontrollen der 'nächsten Generation' betrifft den ausgedehnten Gebrauch von Verleumdungs-, Beleidigungs- und anderen Gesetzen, um erlaubte Kommunikation zu beschränken und ein Klima der Furcht, Einschüchterung und schließlich Selbstzensur zu schaffen. Zum Teil reflektiert dies den natürlichen Reifeprozess, in dem die Behörden versuchen, den Cyberspace zu beherrschen und unter behördliche Aufsicht zu bringen. Schändlicher noch, reflektiert dies auch eine Taktik der Strangulation, die dazu führt, dass drohende Prozesse mehr dazu beitragen, die Verbreitung bedrohlicher Informationen zu verhindern als passive Kontrollen, die in einer defensiven Manier installiert werden. Obwohl neue Gesetze entworfen werden, die die Sicherheit und Regulierung des Cyberspace zum Thema haben, werden manchmal alte, obskure oder kaum benutzte Vorschriften ex post facto geltend gemacht, um Akte der Internetzensur zu rechtfertigen." Und die beiden reden nicht nur von Diktaturen.
In einem Artikel für Index on Censorship, den Eurozine online gestellt hat, erklären Ron Deibert und Rafal Rohozinski von der OpenNet-Initiative, wie die Zensur der 'nächsten Generation' das Web kontrollieren will. Zum Beispiel so: "Eine der am schnellsten wachsenden und effektivsten Kontrollen der 'nächsten Generation' betrifft den ausgedehnten Gebrauch von Verleumdungs-, Beleidigungs- und anderen Gesetzen, um erlaubte Kommunikation zu beschränken und ein Klima der Furcht, Einschüchterung und schließlich Selbstzensur zu schaffen. Zum Teil reflektiert dies den natürlichen Reifeprozess, in dem die Behörden versuchen, den Cyberspace zu beherrschen und unter behördliche Aufsicht zu bringen. Schändlicher noch, reflektiert dies auch eine Taktik der Strangulation, die dazu führt, dass drohende Prozesse mehr dazu beitragen, die Verbreitung bedrohlicher Informationen zu verhindern als passive Kontrollen, die in einer defensiven Manier installiert werden. Obwohl neue Gesetze entworfen werden, die die Sicherheit und Regulierung des Cyberspace zum Thema haben, werden manchmal alte, obskure oder kaum benutzte Vorschriften ex post facto geltend gemacht, um Akte der Internetzensur zu rechtfertigen." Und die beiden reden nicht nur von Diktaturen.Außerdem: Der niederländische Medientheoretiker Geert Lovink denkt über die neue Netz-Architektur und die Versuche nach, ein nationales Web zu schaffen.
New York Times (USA), 28.03.2010
Mit Blick auf etliche Manifeste der letzten Zeit - David Shields "Reality Hunger" oder Jaron Lanier "You Are Not a Gadget" - erinnert Wen Stephenson daran, dass Manifeste eine europäische und ganz unamerikanische Form des Protestes sind: "Wir schreiben Jeremiaden". Den Unterschied erklärt er mit Rückgriff auf Sacvan Bercovitchs "The American Jeremiad" so: "Wenn das Manifest furchtlos in die Zukunft blickt und die etablierte Ordnung durch etwas gänzlich Neues ersetzen will, dann ist die Jeremiade überspannt und nostalgisch zugleich und blickt ängstlich über ihre Schulter in eine paradiesische Zukunft zurück. Die amerikanische Jeremiade, beobachtet Bercovitch, macht die Angst zu ihrem Mittel und ihrem Zweck."
Wie willkürlich rassische Unterscheidungen sind, hat Linda Gordon in Nell Irvin Painters schön provokanter "History of White People" gelernt: "Einige antike Schilderungen betonten die Hautfarbe, etwa wenn die Griechen bemerkten, dass ihre 'barbarischen' nördlichen Nachbarn, die Skythen und Kelten, hellere Haut hatten, als die Griechen für normal erachteten. Die meisten Völker des Altertums definierten Bevölkerungsunterschiede kulturell, nicht physisch, und betrachteten hellere Menschen als weniger zivilisiert. Jahrhundert später hielten europäische Reiseschriftsteller ausgerechnet die hellhäutigen Kaukasier als am besten für die Sklaverei geeignet, kürten kaukasische Frauen aber zugleich zum Inbegriff der Schönheit. Frauen von angeblich niederer 'Rasse' zu exotisieren und sexualisieren, hat eine lange und andauernde Tradition im rassischen Denken, nur dass es heute meistens schwarze Frauen trifft."
Wie willkürlich rassische Unterscheidungen sind, hat Linda Gordon in Nell Irvin Painters schön provokanter "History of White People" gelernt: "Einige antike Schilderungen betonten die Hautfarbe, etwa wenn die Griechen bemerkten, dass ihre 'barbarischen' nördlichen Nachbarn, die Skythen und Kelten, hellere Haut hatten, als die Griechen für normal erachteten. Die meisten Völker des Altertums definierten Bevölkerungsunterschiede kulturell, nicht physisch, und betrachteten hellere Menschen als weniger zivilisiert. Jahrhundert später hielten europäische Reiseschriftsteller ausgerechnet die hellhäutigen Kaukasier als am besten für die Sklaverei geeignet, kürten kaukasische Frauen aber zugleich zum Inbegriff der Schönheit. Frauen von angeblich niederer 'Rasse' zu exotisieren und sexualisieren, hat eine lange und andauernde Tradition im rassischen Denken, nur dass es heute meistens schwarze Frauen trifft."
3 quarks daily | New Yorker | Das Magazin | Outlook India | Merkur | Walrus Magazine | Sinn und Form | Eurozine | New York Times | Wired | Tygodnik Powszechny | Newsweek | Le Monde | Slate | Buzzmachine | Salon.eu.sk
Kommentieren