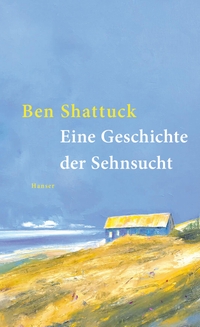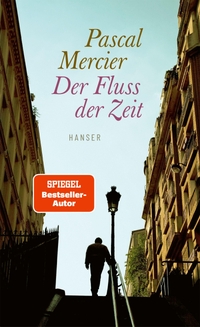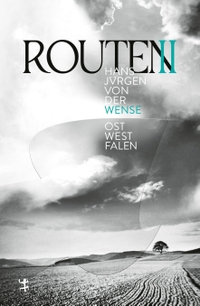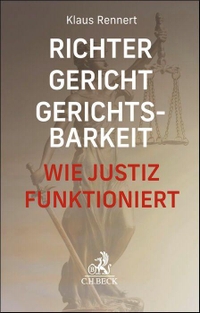Magazinrundschau
Huhn so, Schwein anders
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
09.03.2010. In Magyar Narancs fordert Agnes Heller mehr Zivilcourage von den Ungarn. Warum konservative Kreise in Ägypten Frauen gern als Bonbons sehen würden, erklärt Mohammed Ali Atassi in Qantara. In Resetdoc sieht Olivier Roy kaum mehr Platz für ein Blatt Papier zwischen christlichen Rechten und säkularen Linken. Im Magazin erklärt der Philosoph Ludwig Hasler - nicht nur - den Schweizern: Wer heute das Mittelmaß bevorzugt, kann morgen nicht Elite erwarten. In Prospect erklärt Jonathan Safran Foer, warum er kein Huhn im Bett wünscht - und auch nicht auf seinem Teller. Die NYT begibt sich auf human-flesh search und findet eine Katzenmörderin.
Magyar Narancs (Ungarn), 25.02.2010
 Die Mehrheit der ungarischen Bevölkerung kann sich mit der vor zwanzig Jahren geschaffenen Republik nicht identifizieren. Istvan Bundula sprach mit der Philosophin Agnes Heller, die dies unter anderem damit erklärt, dass Ungarn die "lustigste Baracke" im Lager war: "Die paternalistische Politik der Kadar-Ära hat die Menschen derart verwöhnt, dass sie bis heute alles von dem Staat erwarten, sich selbst aber nicht in der Pflicht sehen. In Ungarn gibt es keine starke, von den Parteien unabhängige Zivilgesellschaft, keine selbständigen Initiativen - weder in der Wirtschaft, noch in der Mobilität oder in der Politik. In Lessings 'Emilia Galotti' heißt es: 'Gewalt! Wer kann der Gewalt nicht trotzen? [...] Verführung ist die wahre Gewalt.'" Einen der Gründe für das neuerliche Erstarken der extremen Rechten sieht Agnes Heller im Wesen der Eskalation, die den Ungarn nicht ganz fremd zu sein scheint: "In Ungarn konnte (und kann) man immer wilder werden, immer weiter ins Extrem fallen. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass man über immer mehr Themen in der Sprache des Rechtsextremismus öffentlich reden kann. Weder die ungarischen Gesetze noch die ungarische Gesellschaft haben diesen Prozess gestoppt - und das ist das eigentliche Problem. Denn der Staat müsste keine Gesetze gegen die Hetzrede schaffen, wenn die Gesellschaft sie nicht dulden würde. [...] Wenn die Menschen so etwas hören, schauen sie weg und erheben nicht ihre Stimme, weil sie Angst haben. Dabei dürfte man in einer Demokratie keine Angst haben, denn die Grundtugend der Demokratie ist die Zivilcourage. Wo diese nicht vorhanden ist, kann keine Demokratie entstehen, und mögen die Gesetze noch so gut sein."
Die Mehrheit der ungarischen Bevölkerung kann sich mit der vor zwanzig Jahren geschaffenen Republik nicht identifizieren. Istvan Bundula sprach mit der Philosophin Agnes Heller, die dies unter anderem damit erklärt, dass Ungarn die "lustigste Baracke" im Lager war: "Die paternalistische Politik der Kadar-Ära hat die Menschen derart verwöhnt, dass sie bis heute alles von dem Staat erwarten, sich selbst aber nicht in der Pflicht sehen. In Ungarn gibt es keine starke, von den Parteien unabhängige Zivilgesellschaft, keine selbständigen Initiativen - weder in der Wirtschaft, noch in der Mobilität oder in der Politik. In Lessings 'Emilia Galotti' heißt es: 'Gewalt! Wer kann der Gewalt nicht trotzen? [...] Verführung ist die wahre Gewalt.'" Einen der Gründe für das neuerliche Erstarken der extremen Rechten sieht Agnes Heller im Wesen der Eskalation, die den Ungarn nicht ganz fremd zu sein scheint: "In Ungarn konnte (und kann) man immer wilder werden, immer weiter ins Extrem fallen. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass man über immer mehr Themen in der Sprache des Rechtsextremismus öffentlich reden kann. Weder die ungarischen Gesetze noch die ungarische Gesellschaft haben diesen Prozess gestoppt - und das ist das eigentliche Problem. Denn der Staat müsste keine Gesetze gegen die Hetzrede schaffen, wenn die Gesellschaft sie nicht dulden würde. [...] Wenn die Menschen so etwas hören, schauen sie weg und erheben nicht ihre Stimme, weil sie Angst haben. Dabei dürfte man in einer Demokratie keine Angst haben, denn die Grundtugend der Demokratie ist die Zivilcourage. Wo diese nicht vorhanden ist, kann keine Demokratie entstehen, und mögen die Gesetze noch so gut sein."Qantara (Deutschland), 08.03.2010
In Ägypten wurde eine Studie mit schockierenden Zahlen über sexuelle Belästigungen veröffentlicht, berichtet Mohammed Ali Atassi. "98 Prozent der ausländischen Frauen und 83 Prozent der ägyptischen waren schon einmal Opfer sexueller Belästigung - fast Zweidrittel der Männer gestanden, Frauen schon einmal belästigt zu haben. Auf der anderen Seite versuchten konservative und religiöse Gruppen, das Thema für ihre eigenen Zwecke auszunutzen. In verächtlicher Weise griffen sie dabei die Würde der Frauen an, indem sie die Schuld für die sexuellen Belästigungen eben bei den Frauen suchten." Als Beispiel beschreibt Atassi ein Plakat, auf dem eine Frau als Bonbon dargestellt wird, "der nur dann vor Fliegen (also den Männern) geschützt ist, wenn er mit Einwickelpapier (also dem Schleier) versehen ist. Unter dem Bild zweier Lollis, einer eingewickelt, der andere offen und mit ihn umschwirrenden Fliegen, findet sich eine religiöse Warnung, die feststellt, dass eine unverschleierte Frau sich nicht zu schützen vermag - denn Gott, der Schöpfer, weiß, was zu ihrem Besten sei, weshalb er verlange, dass sie sich verschleiern solle."
ResetDoc (Italien), 05.03.2010
In einem kurzen Interview erklärt der französische Politikwissenschaftler Olivier Roy, warum sowohl die christliche Rechte und die säkulare Linke seiner Meinung nach islamophob sind: "Die erste Tendenz ist die christliche Identität. Der Glaube, dass Europa christliche Wurzeln hat, hat nichts mit religiösem Glauben zu tun. Das ist die rechtskonservative Position. Die italienische Lega Nord geht nicht zur Kirche, betrachtet die Kirche aber als Teil ihrer eigenen Identität. Diese Leute sind in der Regel fremdenfeindlich und islamophob. Die zweite Tendenz ist die der säkularen Linken, die gegen den Islam opponiert - nicht weil er die Religion der Immigranten ist, sondern weil er eine Religion ist, und die säkulare Linke gegen jede Religion ist. Bis vor kurzem, also im 20. Jahrhundert, fand die Debatte zwischen der säkularen Linken und der christlichen Rechten statt, aber die sind jetzt keine Gegensätze mehr."
Außerdem: In einem Videointerview plädiert die in Yale lehrende Politikwissenschaftlerin Seyla Benhabib für möglichst offene und transparente Einbürgerungsmöglichkeiten für Immigranten.
Außerdem: In einem Videointerview plädiert die in Yale lehrende Politikwissenschaftlerin Seyla Benhabib für möglichst offene und transparente Einbürgerungsmöglichkeiten für Immigranten.
New York Review of Books (USA), 25.03.2010
 Um die Unabhängigkeit der Ukraine fürchtet der Historiker Timothy Snyder unter dem neuen Präsidenten nicht, dafür pflege der Moskau-freundliche Viktor Janukowitsch viel zu enge Kontakte zu den ukrainischen Oligarchen, die lieber ihre eigenen Geschäfte machen. Entscheidend findet Snyder, ob und wie Janukowitsch die Korruption angehen wird: "Da das Amt des Präsidenten nicht sehr stark und Janukowitsch ein Mann der Industrie ist, scheint in der Ukraine eine Lösung des Problems nach Art von Wladimir Putin unwahrscheinlich: Die Oligarchen - oder einige von ihnen - mit Gewalt zu zerschlagen und dann den Sieg des Rechtsstaats auszurufen. Dies hat, ohne die Korruption zu verringern, Russland zu einem autoritären Staat gemacht. Das Land steht wie die Ukraine auf Platz 146 des Transparency-International-Index. Es gibt nur einen Weg, die Ukraine heute zu regieren: Steuerschlupflöcher schließen, Oligarchen besteuern, die Mittelklasse entlasten, so dass kleine Geschäfte aus dem Untergrund hervortreten können, und vor allem sicherstellen, dass die Steuergesetze fair sind."
Um die Unabhängigkeit der Ukraine fürchtet der Historiker Timothy Snyder unter dem neuen Präsidenten nicht, dafür pflege der Moskau-freundliche Viktor Janukowitsch viel zu enge Kontakte zu den ukrainischen Oligarchen, die lieber ihre eigenen Geschäfte machen. Entscheidend findet Snyder, ob und wie Janukowitsch die Korruption angehen wird: "Da das Amt des Präsidenten nicht sehr stark und Janukowitsch ein Mann der Industrie ist, scheint in der Ukraine eine Lösung des Problems nach Art von Wladimir Putin unwahrscheinlich: Die Oligarchen - oder einige von ihnen - mit Gewalt zu zerschlagen und dann den Sieg des Rechtsstaats auszurufen. Dies hat, ohne die Korruption zu verringern, Russland zu einem autoritären Staat gemacht. Das Land steht wie die Ukraine auf Platz 146 des Transparency-International-Index. Es gibt nur einen Weg, die Ukraine heute zu regieren: Steuerschlupflöcher schließen, Oligarchen besteuern, die Mittelklasse entlasten, so dass kleine Geschäfte aus dem Untergrund hervortreten können, und vor allem sicherstellen, dass die Steuergesetze fair sind."Weiteres: Jonathan Raban hat sich in Nashville auf die Tea Party Convention der Sarah-Palin-Fans geschmuggelt: "Als ich bei der Anmeldung meinen Führerschein aus Washington State zeigte, sagte der Helfer: 'Danke, dass Sie den ganzen weiten Weg gekommen sind, um zu helfen, unser Land zu retten', und dann, als er näher hinsah: 'Seattle - ihr habt eine Menge Liberale da oben.' Ich nahm sein Beileid an." Colm Toibin stellt die beiden libanesischen Romane "Cockroach" von Rawi Hage und "The Hakawati" von Rabih Alameddine vor. Daniel Mendelsohn preist noch einmal "die visuelle Kraft und den mitreißenden Einfallsreichtum" von James Camerons seiner Meinung nach unterschätztem 3D-Hit "Avatar".
Tygodnik Powszechny (Polen), 07.03.2010
 Das bestimmende Thema bleibt die Diskussion über die Biografie von Ryszard Kapuscinski. Längst gehe es nicht mehr um die "pikanten" Informationen aus dem Leben des Reporters, um die Frage nach den Grenzen der Genre oder um die Hinterfragung der Autorität, schreibt dazu Piotr Mucharski. "Der Streit darüber, ob Artur Domoslawski ein Denkmal stürzt, ist sinnlos. Er erweckt es vielmehr zum Leben, denn die Mehrheit der im Buch erörterten Probleme ist schmerzhaft aktuell." In der öffentlichen Wahrnehmung sei Kapuscinski ein Meister ohne Ecken und Kanten gewesen, während sein politisches Engagement, das kein Geheimnis war, einfach nicht zur Kenntnis genommen wurde. "Wir behandelten ihn wie einen Fremden. Er brachte uns Neuigkeiten aus der Welt mit (...), aber nicht die polnischen, und nicht einmal die europäischen Diskussionen waren für ihn wichtig. Seine ideologische Verwurzelung hatte einen anderen Erfahrungshintergrund. Deshalb blieb er allen im Grunde fremd. Nur hatte es niemand gemerkt."
Das bestimmende Thema bleibt die Diskussion über die Biografie von Ryszard Kapuscinski. Längst gehe es nicht mehr um die "pikanten" Informationen aus dem Leben des Reporters, um die Frage nach den Grenzen der Genre oder um die Hinterfragung der Autorität, schreibt dazu Piotr Mucharski. "Der Streit darüber, ob Artur Domoslawski ein Denkmal stürzt, ist sinnlos. Er erweckt es vielmehr zum Leben, denn die Mehrheit der im Buch erörterten Probleme ist schmerzhaft aktuell." In der öffentlichen Wahrnehmung sei Kapuscinski ein Meister ohne Ecken und Kanten gewesen, während sein politisches Engagement, das kein Geheimnis war, einfach nicht zur Kenntnis genommen wurde. "Wir behandelten ihn wie einen Fremden. Er brachte uns Neuigkeiten aus der Welt mit (...), aber nicht die polnischen, und nicht einmal die europäischen Diskussionen waren für ihn wichtig. Seine ideologische Verwurzelung hatte einen anderen Erfahrungshintergrund. Deshalb blieb er allen im Grunde fremd. Nur hatte es niemand gemerkt."Das Magazin (Schweiz), 06.03.2010
 Der Schweizer Philosoph Ludwig Hasler denkt darüber nach, warum die Eliten heute so häufig versagen. Das meint er, hat auch damit zu tun, dass die Schweizer generell mit Eliten nichts am Hut haben und bei ihrem Führungspersonal das Mittelmaß lieben - vorausgesetzt, es gibt keine Krise. "Im Prinzip wollen wir ganz normale Menschen am Ruder - sobald wir in Strudel geraten, erwarten wir Übermenschen. Magistraten, die alles im Auge haben, jedes Übel von Weitem riechen, jeden gordischen Knoten zerhauen, Großmächte resolut zur Räson bringen; gleichzeitig ministrantenhaft den Hohepriester 'Volk' hofieren. Der Mix, als literarische Figur vielleicht interessant, ist real zum Vergessen."
Der Schweizer Philosoph Ludwig Hasler denkt darüber nach, warum die Eliten heute so häufig versagen. Das meint er, hat auch damit zu tun, dass die Schweizer generell mit Eliten nichts am Hut haben und bei ihrem Führungspersonal das Mittelmaß lieben - vorausgesetzt, es gibt keine Krise. "Im Prinzip wollen wir ganz normale Menschen am Ruder - sobald wir in Strudel geraten, erwarten wir Übermenschen. Magistraten, die alles im Auge haben, jedes Übel von Weitem riechen, jeden gordischen Knoten zerhauen, Großmächte resolut zur Räson bringen; gleichzeitig ministrantenhaft den Hohepriester 'Volk' hofieren. Der Mix, als literarische Figur vielleicht interessant, ist real zum Vergessen."Prospect (UK), 01.04.2010
 Der Romanautor Jonathan Safran Foer hat ein Sachbuch geschrieben, in dem er ohne Fanatismus die fleischproduzierende Industrie geißelt ("Eatin Animals", Auszug als pdf-Dokument). Nur den Kopf schütteln kann er im Interview über Vorwürfe, er sei da in erster Linie sentimental: "Sentimentalität bedeutet, dass unsere Gefühle uns stärker beeinflussen als unser Hirn und unser Verstand. Aber es ist doch eine schlichte Auseinandersetzung mit Tatsachen, wenn ich sage: 'Ich will nichts essen, das bei der Produktion die Umwelt massiv schädigt' und 'Ich will nichts essen, für dessen Produktion Tiere auf eine Weise misshandelt werden, auf die ich meinen Hund niemals misshandeln würde'. Das ist nicht sentimental, das ist nur die Haltung eines anständigen Menschen. Ich habe nicht den Wunsch, ein Huhn zu mir ins Bett kriechen zu lassen, ich möchte nur nicht, dass es nicht behandelt wird wie ein Holzklotz. Seltsam sind doch die sentimentalen Linien, die wir ziehen. Einen Hund so, ein Schwein aber anders zu behandeln, das ist sentimental. Und ich habe nie eine gute - rationale - Erklärung dafür bekommen, außer: 'Das haben wir immer schon so gemacht.'" Auf der Website zum Buch bekennen bereits Tausende, sie seien aufgrund des Buchs Veganer geworden.
Der Romanautor Jonathan Safran Foer hat ein Sachbuch geschrieben, in dem er ohne Fanatismus die fleischproduzierende Industrie geißelt ("Eatin Animals", Auszug als pdf-Dokument). Nur den Kopf schütteln kann er im Interview über Vorwürfe, er sei da in erster Linie sentimental: "Sentimentalität bedeutet, dass unsere Gefühle uns stärker beeinflussen als unser Hirn und unser Verstand. Aber es ist doch eine schlichte Auseinandersetzung mit Tatsachen, wenn ich sage: 'Ich will nichts essen, das bei der Produktion die Umwelt massiv schädigt' und 'Ich will nichts essen, für dessen Produktion Tiere auf eine Weise misshandelt werden, auf die ich meinen Hund niemals misshandeln würde'. Das ist nicht sentimental, das ist nur die Haltung eines anständigen Menschen. Ich habe nicht den Wunsch, ein Huhn zu mir ins Bett kriechen zu lassen, ich möchte nur nicht, dass es nicht behandelt wird wie ein Holzklotz. Seltsam sind doch die sentimentalen Linien, die wir ziehen. Einen Hund so, ein Schwein aber anders zu behandeln, das ist sentimental. Und ich habe nie eine gute - rationale - Erklärung dafür bekommen, außer: 'Das haben wir immer schon so gemacht.'" Auf der Website zum Buch bekennen bereits Tausende, sie seien aufgrund des Buchs Veganer geworden.Elet es Irodalom (Ungarn), 05.03.2010
 Seit mehreren Jahren befindet sich Ungarn in einer gesellschaftlichen und politischen Krise, die sich vordergründig im Misstrauen gegenüber den Institutionen, den Politikern und damit in der Ablehnung der Wende von 1989 und der damals geschaffenen Republik manifestiert. Daher wird auch bei den Parlamentswahlen im April ein erdrutschartiger Wahlsieg rechtskonservativen Fidesz-Partei erwartet, die eine autoritäre Ordnung verspricht. Der Philosoph und Kommunikationswissenschaftler Mihaly Szilagyi-Gal sieht die Gefahr, dass die Befreiung von 1989 wieder rückgängig gemacht wird. Und das, schreibt er, wäre ein größeres Fiasko als die Unterdrückung in der Diktatur: "Zum ersten Mal seit der Wende steht Ungarn vor einer Situation, in der eine Seite des politischen Angebots praktisch alleinherrschend wird. Das Problem ist nicht nur die Seite selbst, sondern die Einseitigkeit - vielleicht sogar für den Sieger. Diese Situation, die so sehr an den Monotheismus des Einparteienstaates erinnert, ist diesmal nicht das Ergebnis einer - aus der Sicht der Gesellschaft - äußeren Unterdrückung, sondern einer schlecht handelnden Gesellschaft. Das macht diese Niederlage noch schwerer. [...] Die schlecht handelnde Gesellschaft selbst ist zur unterdrückenden Macht geworden. Es gibt kein 'sie' und 'wir' mehr. Wir haben keine Feinde mehr, wir sind es selbst."
Seit mehreren Jahren befindet sich Ungarn in einer gesellschaftlichen und politischen Krise, die sich vordergründig im Misstrauen gegenüber den Institutionen, den Politikern und damit in der Ablehnung der Wende von 1989 und der damals geschaffenen Republik manifestiert. Daher wird auch bei den Parlamentswahlen im April ein erdrutschartiger Wahlsieg rechtskonservativen Fidesz-Partei erwartet, die eine autoritäre Ordnung verspricht. Der Philosoph und Kommunikationswissenschaftler Mihaly Szilagyi-Gal sieht die Gefahr, dass die Befreiung von 1989 wieder rückgängig gemacht wird. Und das, schreibt er, wäre ein größeres Fiasko als die Unterdrückung in der Diktatur: "Zum ersten Mal seit der Wende steht Ungarn vor einer Situation, in der eine Seite des politischen Angebots praktisch alleinherrschend wird. Das Problem ist nicht nur die Seite selbst, sondern die Einseitigkeit - vielleicht sogar für den Sieger. Diese Situation, die so sehr an den Monotheismus des Einparteienstaates erinnert, ist diesmal nicht das Ergebnis einer - aus der Sicht der Gesellschaft - äußeren Unterdrückung, sondern einer schlecht handelnden Gesellschaft. Das macht diese Niederlage noch schwerer. [...] Die schlecht handelnde Gesellschaft selbst ist zur unterdrückenden Macht geworden. Es gibt kein 'sie' und 'wir' mehr. Wir haben keine Feinde mehr, wir sind es selbst."Nach Ansicht des Soziologen Peter Kende wird die gesellschaftliche Krise, die nun in der starken Sehnsucht nach Law and Order gipfelt, durch drei Faktoren besonders schwerwiegend: die Legitimitätskrise der demokratischen Institutionen, das Realitätsdefizit der Ungarn (die Furcht vor der Konfrontation mit der Realität und den realen Verhältnissen, von Elemer Hankiss auch als "Morbus Hungaricus" bezeichnet) und die Existenzangst, die manche mit der Marktwirtschaft, andere wiederum mit der schwachen Leistung der jetzigen Regierung als Ordnungshüter verbinden: "Es ist tragisch, dass das Land, das von den Versprechungen der Wende von 1989 enttäuscht ist, eine Chance zu verspielen im Begriff ist, die in seiner neuzeitlichen Geschichte einmalig war. Denn wann sonst konnten wir Ungarn frei über die Gestaltung unser eigenen Angelegenheiten bestimmen, wenn nicht 1989/90? Wenn wir auf diese Errungenschaften auch nur teilweise verzichten, ist es gut möglich, dass wir keine ähnliche Chance mehr bekommen werden. Zu unseren Lebzeiten ganz sicher nicht."
Al Ahram Weekly (Ägypten), 04.03.2010
Die amerikanische Religionswissenschaftlerin Margot Badran besuchte kürzlich eine Moschee in Washington DC. Ein deprimierendes Erlebnis: Eine Gruppe von Frauen, die im Hauptgebetssaal hinter den Männern beten wollten, erregten beim Moscheeverwalter solches Missfallen, dass er die Polizei holen ließ, die die Frauen hinausdrängte, erzählt sie. "Draußen auf der Straße wandte ich mich an einen der Polizisten, der wie der andere Polizist Afroamerikaner war, und sagte: 'Sie wissen Bescheid über Rasse und Geschlecht in diesem Land. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie Frauen hinauswerfen? Hätten Sie je gedacht, dass Ihr Job das von Ihnen verlangt?' Alles was er sagte, war: 'Das ist der Grund, warum ich sie nicht verhaftet habe.' Er wiederholte, was auch der andere Polizist gesagt hatte: 'Die Moschee ist ein privater Ort und sie haben das Recht, jeden rauszuwerfen, der nicht nach ihren Regeln spielt.' ... Alles was ich zu meinem Landsmann sagen konnte war: 'Der lunch counter war auch ein privater Ort.' Was, wenn die jungen [schwarzen] Männer, die sich dort hinsetzten, nach den Regeln gespielt hätten? Wessen Regeln?"
Merkur (Deutschland), 01.03.2010
W.A. Pannapacker, Professor für Englisch am Hope College in Michigan, bekennt sich (hier im englischen Original) zu seiner Herkunft aus dem Aufsteiger-Milieu, die ihm offenbar recht quälende Jahre unter snobistischen Kommilitonen beschert hat: "Anders als die unabhängigen Highbrows und die unbefangenen Lowbrows sind die Middlebrows anscheinend derart bemüht, 'im Leben voranzukommen', dass sie etwas einzig dann wirklich mögen, wenn es von den sozial über ihnen Stehenden approbiert worden ist. Für Virginia Woolf und ihre Nachfolger sind Middlebows nichtauthentisches, unaufrichtiges Pack, sklavisch der Mode und Schicklichkeit gehorchend, eine Kultur nachäffend, die sie nicht zu verstehen vermögen; sie sind das Muster für Hyacinth Bucket in der BBC-Sendung 'Keeping Up Appearances', die Anrufe mit dem Satz 'Die Bouquet-Residenz, die Hausherrin am Telefon' entgegennimmt."
Heinz Theisen, Politikwissenschaftler an der Katholischen Hochschule in Köln, will dem Universalismus Grenzen gesetzt sehen: "Solange der Westen seine Einflusssphäre mit der Universalität der allgemeinen Menschenrechte gleichsetzt, droht jedes Problem auf der Welt zu einem Problem des Westens zu werden." Theisen plädiert für eine recht eigene Kombination aus Multikulturalismus und Geopolitik: "Je mehr wir uns aus fremden Kulturräumen zurückziehen, desto mehr Recht haben wir auf die Behauptung unseres eigenen Kulturraums. Nach dem Disengagement kann sich der Westen auf die Sicherung der eigenen Hemisphäre konzentrieren."
Hansjörg Graf schreibt über John Donne und zitiert aus einem Essay von T.S. Eliot über die lyrische Leistung der Metaphysicals: "Racine und Donne schauten in sehr viel mehr als nur ins Herz. Man muss auch auf die Hirnrinde schauen, ins Nervensystem und in den Verdauungstrakt."
Heinz Theisen, Politikwissenschaftler an der Katholischen Hochschule in Köln, will dem Universalismus Grenzen gesetzt sehen: "Solange der Westen seine Einflusssphäre mit der Universalität der allgemeinen Menschenrechte gleichsetzt, droht jedes Problem auf der Welt zu einem Problem des Westens zu werden." Theisen plädiert für eine recht eigene Kombination aus Multikulturalismus und Geopolitik: "Je mehr wir uns aus fremden Kulturräumen zurückziehen, desto mehr Recht haben wir auf die Behauptung unseres eigenen Kulturraums. Nach dem Disengagement kann sich der Westen auf die Sicherung der eigenen Hemisphäre konzentrieren."
Hansjörg Graf schreibt über John Donne und zitiert aus einem Essay von T.S. Eliot über die lyrische Leistung der Metaphysicals: "Racine und Donne schauten in sehr viel mehr als nur ins Herz. Man muss auch auf die Hirnrinde schauen, ins Nervensystem und in den Verdauungstrakt."
Weltwoche (Schweiz), 04.03.2010
 Peter Keller hat den emeritierten Informatikprofessor und Entwickler der Programmiersprache "Pascal" Niklaus Wirth getroffen, der im Interview ein für den deutschen Sprachraum sehr entspanntes Verhältnis zum Internet offenbart. Angst, ausgeforscht und "in Mathematik übersetzt" zu werden, hat er nicht. "Nein, diese Gefahr scheint mir übertrieben. Der Mensch lässt sich nie so in Mathematik übersetzen. Außerdem ist Mathematik in diesem Zusammenhang das falsche Wort. Man will sagen, in konkretes Regelwerk. Die Aussage von Autor Schirrmacher relativiert sich, wenn wir sehen, wie vieles ganz selbstverständlich von Maschinen dominiert wird. Zum Beispiel der Eisenbahnverkehr. Der Computer berechnet die Fahrpläne, und der Lokführer hat sich daran zu halten. Insofern ordnen wir uns den Computern unter, was mich nicht weiter stört. Das Ganze geschieht zum Vorteil von uns allen."
Peter Keller hat den emeritierten Informatikprofessor und Entwickler der Programmiersprache "Pascal" Niklaus Wirth getroffen, der im Interview ein für den deutschen Sprachraum sehr entspanntes Verhältnis zum Internet offenbart. Angst, ausgeforscht und "in Mathematik übersetzt" zu werden, hat er nicht. "Nein, diese Gefahr scheint mir übertrieben. Der Mensch lässt sich nie so in Mathematik übersetzen. Außerdem ist Mathematik in diesem Zusammenhang das falsche Wort. Man will sagen, in konkretes Regelwerk. Die Aussage von Autor Schirrmacher relativiert sich, wenn wir sehen, wie vieles ganz selbstverständlich von Maschinen dominiert wird. Zum Beispiel der Eisenbahnverkehr. Der Computer berechnet die Fahrpläne, und der Lokführer hat sich daran zu halten. Insofern ordnen wir uns den Computern unter, was mich nicht weiter stört. Das Ganze geschieht zum Vorteil von uns allen."New Yorker (USA), 15.03.2010
 "Immer an der Wirklichkeit bleiben" überschreibt James Wood seine Rezension des neuen Romans von Chang-Rae Lee "The Surrendered", der ein halbes Jahrhundert umfasst und auf drei Kontinenten spielt. Eingangs beschäftigt er sich jedoch mit Fragen der literarischen Konventionen, Roland Barthes Konzept des "Realitätseffekts" und streift dabei das Buch "Reality Hunger: A Manifesto" von David Shields, ein leidenschaftliches Plädoyer für das, was der Autor "wirklichkeitsgestützte Kunst" nennt. Wood findet es schwierig zu entscheiden, ob Literatur überhaupt eine Art Fortschritt macht: "Konvention mag langweilig sein, aber sie ist nicht unwahr, nur weil sie konventionell ist. Leute liegen nun mal in ihren Betten und schämen sich für das, was tagsüber passiert ist (ich jedenfalls), sie bestellen ein Bier und ein Sandwich und klappen ihre Computer auf; sie betreten und verlassen Räume, reden mit anderen Leuten... Vermutlich existieren im wirklichen Leben mehr Übereinstimmungen als in der Fiktion... Das ganze Leben ist in vielfacher Hinsicht konventionell, genau wie das erzählte."
"Immer an der Wirklichkeit bleiben" überschreibt James Wood seine Rezension des neuen Romans von Chang-Rae Lee "The Surrendered", der ein halbes Jahrhundert umfasst und auf drei Kontinenten spielt. Eingangs beschäftigt er sich jedoch mit Fragen der literarischen Konventionen, Roland Barthes Konzept des "Realitätseffekts" und streift dabei das Buch "Reality Hunger: A Manifesto" von David Shields, ein leidenschaftliches Plädoyer für das, was der Autor "wirklichkeitsgestützte Kunst" nennt. Wood findet es schwierig zu entscheiden, ob Literatur überhaupt eine Art Fortschritt macht: "Konvention mag langweilig sein, aber sie ist nicht unwahr, nur weil sie konventionell ist. Leute liegen nun mal in ihren Betten und schämen sich für das, was tagsüber passiert ist (ich jedenfalls), sie bestellen ein Bier und ein Sandwich und klappen ihre Computer auf; sie betreten und verlassen Räume, reden mit anderen Leuten... Vermutlich existieren im wirklichen Leben mehr Übereinstimmungen als in der Fiktion... Das ganze Leben ist in vielfacher Hinsicht konventionell, genau wie das erzählte."Peter Schjeldahl führt durch die von Jeff Koons kuratierte Ausstellung "Skin Fruit" im New Museum. Anthony Lane bespricht das Irak-Kriegsdrama "Green Zone" von Paul Greengrass und "Mother" ("Madeo") des Südkoreaners Bong Joon-Ho. Zu lesen ist außerdem die Erzählung "The Knocking" von David Means und Lyrik von Edward Hirsch und Barbara Ras.
Nouvel Observateur (Frankreich), 04.03.2010
 Der Obs widmet sich in seinem Titeldossier der Kontroverse zwischen Yannick Haenel und Claude Lanzmann, in der es vor allem um die Frage geht, ob die westlichen Alliierten die Juden im Stich gelassen haben. Ersterer bejaht dies in seinem Buch über den polnischen Widerstandskämpfer Jan Karski (mehr hier), wohingegen Lanzmann dieser These strikt widerspricht. Claude Weill und Laurent Lemire tragen in einem Überblicksartikel die derzeit bekannten Fakten zusammen und gehen darin auch auf die Rolle des Vichy-Regimes und des Vatikans ein. Erstaunliche Folgerung: die Alliierten sind über jeden Zweifel erhaben, aber der Vatikan ist so schuldig, wie es seit Hochhuth behauptet wird. Daneben sind Auszüge aus den Erinnerungen Karskis zu lesen, der Roosevelt 1943 - erfolglos - über die Vernichtungslager informiert hatte und 1944 seine Erinnerungen veröffentlichte, die in Frankreich nun neu aufgelegt wurden (siehe hierzu auch einen Artikel im aktuellen Figaro): "Als ich den Präsidenten verließ, war er immer noch genauso frisch, erholt und lächelte wie zu Beginn des Gesprächs. Ich dagegen fühlte mich sehr müde."
Der Obs widmet sich in seinem Titeldossier der Kontroverse zwischen Yannick Haenel und Claude Lanzmann, in der es vor allem um die Frage geht, ob die westlichen Alliierten die Juden im Stich gelassen haben. Ersterer bejaht dies in seinem Buch über den polnischen Widerstandskämpfer Jan Karski (mehr hier), wohingegen Lanzmann dieser These strikt widerspricht. Claude Weill und Laurent Lemire tragen in einem Überblicksartikel die derzeit bekannten Fakten zusammen und gehen darin auch auf die Rolle des Vichy-Regimes und des Vatikans ein. Erstaunliche Folgerung: die Alliierten sind über jeden Zweifel erhaben, aber der Vatikan ist so schuldig, wie es seit Hochhuth behauptet wird. Daneben sind Auszüge aus den Erinnerungen Karskis zu lesen, der Roosevelt 1943 - erfolglos - über die Vernichtungslager informiert hatte und 1944 seine Erinnerungen veröffentlichte, die in Frankreich nun neu aufgelegt wurden (siehe hierzu auch einen Artikel im aktuellen Figaro): "Als ich den Präsidenten verließ, war er immer noch genauso frisch, erholt und lächelte wie zu Beginn des Gesprächs. Ich dagegen fühlte mich sehr müde."Claude Lanzmann spricht in seinem Beitrag dagegen vom "Mythos der Rettung" und erklärt, dass die Juden in der Vorkriegszeit und im Krieg selbst keineswegs "das Zentrum der Welt" gewesen seien, sondern im Gegenteil eine Rand- wenn nicht gar eine marginale Stellung eingenommen hätten. "Das galt nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern für ganz Europa, von Deutschland ganz zu schweigen. Die Juden waren eben nicht - und sind es selbst heute nicht, auch wenn einige von ihnen das gerne behaupten - das Zentrum der Welt. Von der Warte dieser faktischen Wahrheit aus muss das Verhalten der Alliierten während des Kriegs und das angebliche Im-Stich-lassen der Juden betrachtet werden. Hätte man 'die Juden' oder 'Juden' retten können? Welche hätte man retten können? Wann? Wie?"
Zu lesen ist außerdem ein Interview mit Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz über die Gier der Banker und ihre "erdrückende Verantwortlichkeit" für die Krise.
New York Times (USA), 07.03.2010
 Im Magazine erzählt uns Tom Downey was über Chinas Cybertrupps und ihre human-flesh search. Das bedeutet nicht Suche nach Menschenfleisch, sondern Suche durch Menschenfleisch. Und das funktioniert so: Eine Frau stellte in China ein Video online, auf dem sie mit spitzen Stilettos eine kleine Katze tot tritt. Darüber empörte sich die Netzgemeinde in einem großen Onlineforum derart, dass sie beschließt, gemeinsam die Mörderin ausfindig zu machen. "Ein Netizen namens Beacon Bridge No Return fand den ersten Hinweis im Katzenmörder-Fall. 'Es gab eine Credit-Information vor der Zerquetschung, www.crushworld.net', schrieb der Leser. Netizens verfolgten die Email-Adresse der Seite zurück zu einem Server in Hangzhou, einige Stunden von Schanghai entfernt. Ein nachfolgender Eintrag beschäftigte sich mit der Örtlichkeit im Video: 'Kennen Leser aus Hangzhou diesen Ort?' Anwohner berichtet, dass es in ihrer Stadt keinen solchen Ort gebe wie im Video gezeigt. Aber die Netizens rechercherierten weiter, überzeugt, dass sie die Person in einer Nation von über einer Milliarde Einwohnern finden würden. Und sie hatten recht. Die traditionellen Medien griffen die Geschichte auf und Menschen in ganz China sahen das Foto der Katzenmörderin im Fernsehen. 'Ich kenne diese Frau', schrieb I'm Not Desert Angel vier Tage später. 'Sie ist nicht aus Hangzhou. Sie lebt in meiner Kleinstadt in Nordosten Chinas. Himmel, sie ist eine Krankenschwester. Das ist alles, was ich sagen kann.'" Sechs Tage später waren Ort und Frau identifiziert, ihr Name, ihre Telefonnummer und ihr Arbeitgeber öffentlich gemacht und sie und ihr Kameramann gefeuert. "Der Katzenmörder-Fall hat nicht nur Rache gebracht; er hat die Suchmaschine aus Menschenfleisch in ein nationales Phänomen verwandelt." Mit Folgen, die Tom Downey detailliert beschreibt.
Im Magazine erzählt uns Tom Downey was über Chinas Cybertrupps und ihre human-flesh search. Das bedeutet nicht Suche nach Menschenfleisch, sondern Suche durch Menschenfleisch. Und das funktioniert so: Eine Frau stellte in China ein Video online, auf dem sie mit spitzen Stilettos eine kleine Katze tot tritt. Darüber empörte sich die Netzgemeinde in einem großen Onlineforum derart, dass sie beschließt, gemeinsam die Mörderin ausfindig zu machen. "Ein Netizen namens Beacon Bridge No Return fand den ersten Hinweis im Katzenmörder-Fall. 'Es gab eine Credit-Information vor der Zerquetschung, www.crushworld.net', schrieb der Leser. Netizens verfolgten die Email-Adresse der Seite zurück zu einem Server in Hangzhou, einige Stunden von Schanghai entfernt. Ein nachfolgender Eintrag beschäftigte sich mit der Örtlichkeit im Video: 'Kennen Leser aus Hangzhou diesen Ort?' Anwohner berichtet, dass es in ihrer Stadt keinen solchen Ort gebe wie im Video gezeigt. Aber die Netizens rechercherierten weiter, überzeugt, dass sie die Person in einer Nation von über einer Milliarde Einwohnern finden würden. Und sie hatten recht. Die traditionellen Medien griffen die Geschichte auf und Menschen in ganz China sahen das Foto der Katzenmörderin im Fernsehen. 'Ich kenne diese Frau', schrieb I'm Not Desert Angel vier Tage später. 'Sie ist nicht aus Hangzhou. Sie lebt in meiner Kleinstadt in Nordosten Chinas. Himmel, sie ist eine Krankenschwester. Das ist alles, was ich sagen kann.'" Sechs Tage später waren Ort und Frau identifiziert, ihr Name, ihre Telefonnummer und ihr Arbeitgeber öffentlich gemacht und sie und ihr Kameramann gefeuert. "Der Katzenmörder-Fall hat nicht nur Rache gebracht; er hat die Suchmaschine aus Menschenfleisch in ein nationales Phänomen verwandelt." Mit Folgen, die Tom Downey detailliert beschreibt.
Kommentieren