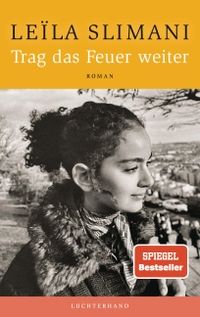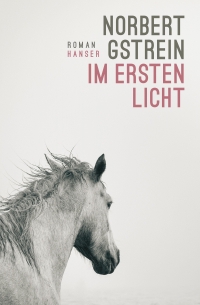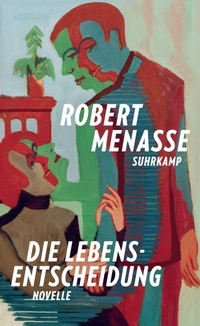Magazinrundschau
Dieses spezifische Stück Fleisch
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
06.09.2016. Buzzfeed untersucht in einer Kontinente umspannenden Reportage die Rolle internationaler Schiedsgerichte. In Babelia hofft der baskische Fernando Aramburu auf eine Aufarbeitung der mörderischen Geschichte der ETA. Der New Yorker betreibt Vergangenheitsbewältigung in Berlin mittels "Familienaufstellung". Atlantic bereitet uns schon mal auf die kommende Kopftransplantation vor. The Nation findet bei Thomas Struth Post-Internet-Art. Die New York Times erzählt die Geschichte von Oliver Stones Film über Edward Snowden.
Buzzfeed (USA), 06.09.2016
 In einer riesigen vierteiligen, mehrere Kontinente umspannenden Reportage geht Chris Hamby den internationalen Schiedsgerichten nach, die bei Problemen in geheimen Sitzungen die Beziehungen zwischen Staaten und Unternehmen regeln. Anwälte haben inzwischen ein ehemals ganz gut funktionierendes System in eine Profitmaschine verwandelt, so Hamby: "Bisher wurde vor allem gewarnt, dass große Unternehmen potentiell die Möglichkeit haben, nationale Gesetze zu verhindern wie das Verbot gefährlicher Chemikalien oder die Erhöhung des Mindestlohns. Doch dass das System auch ein Schutzschild für Kriminalität und Korruption ist, blieb weitgehend unbekannt. Während wir fünf Jahre lang alle öffentlich zugänglichen Informationen über etwa 300 Fälle durchforsteten, fanden wir mehr als 35 Fälle, in denen Firma oder Management Schutz bei Schiedsgerichten suchten vor Anklagen wie Geldwäsche, Unterschlagung, Aktienmanipulationen, Bestechung und Betrug."
In einer riesigen vierteiligen, mehrere Kontinente umspannenden Reportage geht Chris Hamby den internationalen Schiedsgerichten nach, die bei Problemen in geheimen Sitzungen die Beziehungen zwischen Staaten und Unternehmen regeln. Anwälte haben inzwischen ein ehemals ganz gut funktionierendes System in eine Profitmaschine verwandelt, so Hamby: "Bisher wurde vor allem gewarnt, dass große Unternehmen potentiell die Möglichkeit haben, nationale Gesetze zu verhindern wie das Verbot gefährlicher Chemikalien oder die Erhöhung des Mindestlohns. Doch dass das System auch ein Schutzschild für Kriminalität und Korruption ist, blieb weitgehend unbekannt. Während wir fünf Jahre lang alle öffentlich zugänglichen Informationen über etwa 300 Fälle durchforsteten, fanden wir mehr als 35 Fälle, in denen Firma oder Management Schutz bei Schiedsgerichten suchten vor Anklagen wie Geldwäsche, Unterschlagung, Aktienmanipulationen, Bestechung und Betrug."Babelia (Spanien), 02.09.2016
 Der im Baskenland geborene und seit 1985 in Deutschland lebende Schriftsteller Fernando Aramburu spricht über seinen neuen Roman "Patria", der anhand von zwei Familien die Geschichte der ETA erzählt: "Im Baskenland ist es seit dem im Oktober 2011 von der ETA verkündeten Waffenstillstand ein bisschen wie im Nachkriegsdeutschland: Die Menschen wollen vergessen bzw. nach vorne blicken, wie man so sagt. Es heißt, man könne nicht ständig an die Toten und das Blutvergießen denken, man müsse umblättern usw. Ich bin anderer Meinung, ich glaube, wir brauchen einen Raum der Erinnerung, einen Ort, wo die Leute Antworten auf ihre Fragen finden - was ist damals geschehen? Wer hat es getan? Wer hat darunter gelitten? Die vielleicht wichtigste Niederlage der ETA steht in jedem Fall noch aus - die auf dem Gebiet der Erzählungen. Und natürlich die in der Literatur. Je mehr Zeugnisse wir beibringen, desto schwieriger wird es, die alten Lügen, Mythen und Legenden aufrechtzuerhalten. Das ist heute unsere Aufgabe. Künftige Schriftsteller werden auf keine persönliche Erfahrung mehr zurückgreifen können, sie werden sich an die Archive wenden, ihre Großeltern befragen müssen. Und dabei kommt nicht immer etwas Vertrauenswürdiges heraus."
Der im Baskenland geborene und seit 1985 in Deutschland lebende Schriftsteller Fernando Aramburu spricht über seinen neuen Roman "Patria", der anhand von zwei Familien die Geschichte der ETA erzählt: "Im Baskenland ist es seit dem im Oktober 2011 von der ETA verkündeten Waffenstillstand ein bisschen wie im Nachkriegsdeutschland: Die Menschen wollen vergessen bzw. nach vorne blicken, wie man so sagt. Es heißt, man könne nicht ständig an die Toten und das Blutvergießen denken, man müsse umblättern usw. Ich bin anderer Meinung, ich glaube, wir brauchen einen Raum der Erinnerung, einen Ort, wo die Leute Antworten auf ihre Fragen finden - was ist damals geschehen? Wer hat es getan? Wer hat darunter gelitten? Die vielleicht wichtigste Niederlage der ETA steht in jedem Fall noch aus - die auf dem Gebiet der Erzählungen. Und natürlich die in der Literatur. Je mehr Zeugnisse wir beibringen, desto schwieriger wird es, die alten Lügen, Mythen und Legenden aufrechtzuerhalten. Das ist heute unsere Aufgabe. Künftige Schriftsteller werden auf keine persönliche Erfahrung mehr zurückgreifen können, sie werden sich an die Archive wenden, ihre Großeltern befragen müssen. Und dabei kommt nicht immer etwas Vertrauenswürdiges heraus."London Review of Books (UK), 08.09.2016
 Recht kühl geht Richard English zur Sache, wenn er fragt "Does Terrorism Work?" Thomas Nagel lernt aus dem Buch, dass Terroristen durchaus sekundäre Ziele erreichen, also operative Erfolge, Öffentlichkeit, Einfluss auf die Bevölkerung, Provokation des politischen Gegners, provisorische Zugeständnisse, Stärkung der eigenen Organisation. Aber die primären politische Ziele werden fast nie erreicht: "Vergeltung für erlittenes Unrecht und Demütigungen ist ein machtvolles Motiv für Gewalt, und wenn es auch als zweitrangiges Ziel dieser Bewegungen gilt, definiert es den Bereich, in dem Terrorismus automatisch funktioniert, sobald er Mitglieder der anvisierten Gruppe tötet oder verwundet. In diesem Sinne sind die Zerstörung des World Trade Centers oder Mountbattens Ermordung eherne Beispiele für funktionierenden Terrorismus. Doch selbst wenn English Rache in seine Liste miteinbezieht, ist es ja nicht wirklich das, was wir mit der Frage meinen. Wir wollen etwas über die politischen Ergebnisse wissen. Und hier sieht die Bilanz vernichtend aus. Geradezu erschütternd ist, wie wahnhaft diese Bewegungen sind, wie wenig sie vom Gleichgewicht der Kräfte verstehen, von den Motiven ihrer Gegner und dem politischen Kontext, in dem sie agieren. In dieser Hinsicht ist es extrem gnädig, sie als rationale Agenten zu bezeichnen."
Recht kühl geht Richard English zur Sache, wenn er fragt "Does Terrorism Work?" Thomas Nagel lernt aus dem Buch, dass Terroristen durchaus sekundäre Ziele erreichen, also operative Erfolge, Öffentlichkeit, Einfluss auf die Bevölkerung, Provokation des politischen Gegners, provisorische Zugeständnisse, Stärkung der eigenen Organisation. Aber die primären politische Ziele werden fast nie erreicht: "Vergeltung für erlittenes Unrecht und Demütigungen ist ein machtvolles Motiv für Gewalt, und wenn es auch als zweitrangiges Ziel dieser Bewegungen gilt, definiert es den Bereich, in dem Terrorismus automatisch funktioniert, sobald er Mitglieder der anvisierten Gruppe tötet oder verwundet. In diesem Sinne sind die Zerstörung des World Trade Centers oder Mountbattens Ermordung eherne Beispiele für funktionierenden Terrorismus. Doch selbst wenn English Rache in seine Liste miteinbezieht, ist es ja nicht wirklich das, was wir mit der Frage meinen. Wir wollen etwas über die politischen Ergebnisse wissen. Und hier sieht die Bilanz vernichtend aus. Geradezu erschütternd ist, wie wahnhaft diese Bewegungen sind, wie wenig sie vom Gleichgewicht der Kräfte verstehen, von den Motiven ihrer Gegner und dem politischen Kontext, in dem sie agieren. In dieser Hinsicht ist es extrem gnädig, sie als rationale Agenten zu bezeichnen."Weiteres: Emma Cline lässt in ihrem Roman "The Girls" noch einmal die sechziger Jahre aufleben, als sich junge Frauen, um den Zwängen ihrer Familien zu entkommen, dem fanatischen Charles Manson anschlossen. Dass sich seitdem nichts für Frauen geändert habe, wie der Roman nahelegt, nimmt Emily Witt der Autorin nicht ab. Terry Eagleton bespricht ausführlich Elizabeth Foysters Biografie des schwachköpfigen Earl of Portsmouth, John Charles Wallop, den auch Jane Austens Vater nicht zur Vernunft bringen konnte.
La regle du jeu (Frankreich), 05.09.2016
 Als Wende im weltweiten Krieg gegen den Dschihadismus feiert Bernard-Henri Lévy die Einlassungen des marokkanischen König Mohammed VI. zum radikalen Islamismus, den dieser für gesetzlos erklärt hat. "Man kann nun wie quasi die Gesamtheit der islamischen und nicht-islamischen Staatschefs bis zum Überdruss wiederholen, dass zwischen dem Islam und dem Islamismus 'keinerlei Verbindung' bestehe. Mohammed VI. tut das Gegenteil. Er erkennt die Verbindung an und zerschneidet sie. Er nimmt den Hebel zur Kenntnis, der es diesen Banditen erlaubt, angeblich im Namen Gottes zu sprechen, und er spricht ihnen dieses Recht ab, um diesen Hebel zu zerbrechen."
Als Wende im weltweiten Krieg gegen den Dschihadismus feiert Bernard-Henri Lévy die Einlassungen des marokkanischen König Mohammed VI. zum radikalen Islamismus, den dieser für gesetzlos erklärt hat. "Man kann nun wie quasi die Gesamtheit der islamischen und nicht-islamischen Staatschefs bis zum Überdruss wiederholen, dass zwischen dem Islam und dem Islamismus 'keinerlei Verbindung' bestehe. Mohammed VI. tut das Gegenteil. Er erkennt die Verbindung an und zerschneidet sie. Er nimmt den Hebel zur Kenntnis, der es diesen Banditen erlaubt, angeblich im Namen Gottes zu sprechen, und er spricht ihnen dieses Recht ab, um diesen Hebel zu zerbrechen."Guardian (UK), 05.09.2016
 In einem langen Artikel rekapituliert Christopher de Bellaigue, wie Tayyip Erdogan mit seiner Variante der autoritär-nationalistischen Demokratie in der Türkei immer populärer wurde. Auf der großen Kundgebung nach dem Putsch erlebte de Bellaigue Erdogans demokrasi in Reinform: "'Der Friedhof der Märtyrer ist nicht leer, die Helden sehnen sich nach der Erde, wie die Flagge nach dem Wehen des Windes.' Um die Bewunderung seiner Zuhörer zu quittieren, unterbrach er sich selbst: 'Was für ein glückliches, gesegnetes Volk wir sind. Es gibt auf der ganzen Welt nicht Euresgleichen.' Eine Nation ist nichts ohne ihre Feinde, und Erdogan zufolge offenbarte der gescheiterte Putsch nicht nur einen, sondern etliche. Nach den verquälten Reaktionen der einstigen Verbündeten im Westen fragte er: 'Sind wir überrascht?', und antwortete sich selbst mit einem Nein. 'Sind wir enttäuscht? Ja, wir sind menschlich.' Aber das, was er die Wiedergeburt vom 15. Juli nennt, habe den Türken gezeigt, 'dass sie weder Gerechtigkeit noch Hilfe, weder Unterstützung noch Verständnis von irgendjemandem erwarten können ... Was immer wir tun, wir sind auf uns selbst gestellt.' Indem er die Themen Glauben, Nation und Tod verbindet, versetzt er seine Anhänger in einen Zustand jubelnd weinerlicher Hilflosigkeit."
In einem langen Artikel rekapituliert Christopher de Bellaigue, wie Tayyip Erdogan mit seiner Variante der autoritär-nationalistischen Demokratie in der Türkei immer populärer wurde. Auf der großen Kundgebung nach dem Putsch erlebte de Bellaigue Erdogans demokrasi in Reinform: "'Der Friedhof der Märtyrer ist nicht leer, die Helden sehnen sich nach der Erde, wie die Flagge nach dem Wehen des Windes.' Um die Bewunderung seiner Zuhörer zu quittieren, unterbrach er sich selbst: 'Was für ein glückliches, gesegnetes Volk wir sind. Es gibt auf der ganzen Welt nicht Euresgleichen.' Eine Nation ist nichts ohne ihre Feinde, und Erdogan zufolge offenbarte der gescheiterte Putsch nicht nur einen, sondern etliche. Nach den verquälten Reaktionen der einstigen Verbündeten im Westen fragte er: 'Sind wir überrascht?', und antwortete sich selbst mit einem Nein. 'Sind wir enttäuscht? Ja, wir sind menschlich.' Aber das, was er die Wiedergeburt vom 15. Juli nennt, habe den Türken gezeigt, 'dass sie weder Gerechtigkeit noch Hilfe, weder Unterstützung noch Verständnis von irgendjemandem erwarten können ... Was immer wir tun, wir sind auf uns selbst gestellt.' Indem er die Themen Glauben, Nation und Tod verbindet, versetzt er seine Anhänger in einen Zustand jubelnd weinerlicher Hilflosigkeit." Außerdem: Sehr beeindruckt ist David Runciman von Yuval Noah Hararis Buch "Homo Deus", das ausmalt, wozu Algorithmen fähig sein werden, da Intelligenz und Bewusstsein voneinander getrennt wurden. Cathy O'Neil ahnt allerdings schon, was die Algorithmen für unser Berufsleben bedeuten.
New Yorker (USA), 12.09.2016
 Im neuen Heft des New Yorker erzählt Burkhard Bilger vom zweiten Gesicht seiner Urgroßmutter in Herzogenweiler und seinem Nazi-Großvater, dem er in deutschen Archiven auf die Spur zu kommen sucht. Das ist mühsam, und so begibt er sich zu Gabriele Baring, um der Geschichte seiner Vorfahren mittels der umstrittenen alternativ-psychologischen Methode der Familienaufstellung auf die Spur zu kommen. Er scheint das für eine in Deutschland gängige Form der Vergangenheitsbewältigung zu halten, seit die Tätergeneration fast ausgestorben ist: "Aber ihre Kinder - zu jung, um selber gekämpft oder den Krieg begriffen zu haben, doch alt genug, um davon traumatisiert zu werden - sie waren immer noch da … Wenn die 'Familienaufstellung' so großen Erfolg hat, dann vielleicht weil, die Geheimnisse dieser Nation so tief und dunkel sind. In Kontakt zu treten mit unseren Vorfahren bedeutet in Deutschland offenbar mehr als Mystik. Es ist eine praktische Notwendigkeit. Wie sonst könnte ein Volk, das so lange im Schweigen verharrte, seine wahre Geschichte erfahren?"
Im neuen Heft des New Yorker erzählt Burkhard Bilger vom zweiten Gesicht seiner Urgroßmutter in Herzogenweiler und seinem Nazi-Großvater, dem er in deutschen Archiven auf die Spur zu kommen sucht. Das ist mühsam, und so begibt er sich zu Gabriele Baring, um der Geschichte seiner Vorfahren mittels der umstrittenen alternativ-psychologischen Methode der Familienaufstellung auf die Spur zu kommen. Er scheint das für eine in Deutschland gängige Form der Vergangenheitsbewältigung zu halten, seit die Tätergeneration fast ausgestorben ist: "Aber ihre Kinder - zu jung, um selber gekämpft oder den Krieg begriffen zu haben, doch alt genug, um davon traumatisiert zu werden - sie waren immer noch da … Wenn die 'Familienaufstellung' so großen Erfolg hat, dann vielleicht weil, die Geheimnisse dieser Nation so tief und dunkel sind. In Kontakt zu treten mit unseren Vorfahren bedeutet in Deutschland offenbar mehr als Mystik. Es ist eine praktische Notwendigkeit. Wie sonst könnte ein Volk, das so lange im Schweigen verharrte, seine wahre Geschichte erfahren?"Außerdem: Tom Kizzia besucht die Inupiat in Alaska, die gleichermaßen vom Öl abhängen und vom Klimawandel betroffen sind. Ian Parker geht zum Dinner mit dem einflussreichen Restaurant-Kritiker Pete Wells, der beim Essen aussieht, als knackte er ein schwieriges Rätsel. Und Ariel Levy berichtet, dass die Amazonas-Droge Ayahuasca in New York und im Silicon-Valley gerade richtig abgeht.
Magyar Narancs (Ungarn), 05.09.2016
 Der heute 88-jährige Dichter, Übersetzer und Essayist László Lator hielt über zwanzig Jahre Meisterkurse an der Universität ELTE in Budapest. Zu seinen Schülern gehörten u.a. die Dichter und Schriftsteller Anna Szabó T., Krisztina Tóth, Kriszta Bódis, Árpád Kun, István Vörös, István Kemény und Attila Bartis. Lator, ein bedeutender Vertreter der erotischen Lyrik in Ungarn, spricht im Interview mit Gábor Köves anlässlich der Veröffentlichung eines neuen Essaybandes u.a. über die Stellung der politischen und der Liebeslyrik heute: "Alles hängt davon ab, wie ein Gedicht geschrieben ist. In der Dichtung ist nicht das Thema essentiell. Wenn wir die größten Gedichte der Weltliteratur in einer begrifflich-prosaischen Sprache zusammenfassen, dann kommen nur Plattitüden heraus. (…) Mir stößt nicht auf, wenn die politische Dichtung in den Vordergrund rückt, doch die direkt politischen Gedichte unterstütze ich nicht. Wenn wir über unsere politischen Ansichten reden wollen, dann können wir ja einen Zeitungsartikel schreiben. Im Gedicht hat Politik sehr wohl ihren Platz - wie bei Attila József oder bei Mihály Babits oder in nicht wenigen Gedichten von György Petri - aber etwas Politisches ist an sich noch keine ästhetische Kategorie."
Der heute 88-jährige Dichter, Übersetzer und Essayist László Lator hielt über zwanzig Jahre Meisterkurse an der Universität ELTE in Budapest. Zu seinen Schülern gehörten u.a. die Dichter und Schriftsteller Anna Szabó T., Krisztina Tóth, Kriszta Bódis, Árpád Kun, István Vörös, István Kemény und Attila Bartis. Lator, ein bedeutender Vertreter der erotischen Lyrik in Ungarn, spricht im Interview mit Gábor Köves anlässlich der Veröffentlichung eines neuen Essaybandes u.a. über die Stellung der politischen und der Liebeslyrik heute: "Alles hängt davon ab, wie ein Gedicht geschrieben ist. In der Dichtung ist nicht das Thema essentiell. Wenn wir die größten Gedichte der Weltliteratur in einer begrifflich-prosaischen Sprache zusammenfassen, dann kommen nur Plattitüden heraus. (…) Mir stößt nicht auf, wenn die politische Dichtung in den Vordergrund rückt, doch die direkt politischen Gedichte unterstütze ich nicht. Wenn wir über unsere politischen Ansichten reden wollen, dann können wir ja einen Zeitungsartikel schreiben. Im Gedicht hat Politik sehr wohl ihren Platz - wie bei Attila József oder bei Mihály Babits oder in nicht wenigen Gedichten von György Petri - aber etwas Politisches ist an sich noch keine ästhetische Kategorie."The Atlantic (USA), 01.09.2016
 Sollte alles gut laufen und die chinesischen Behörden grünes Licht geben, könnte ab Ende 2017 mit ersten Versuchen von Kopftransplantationen zu rechnen sein, schreibt Sam Kean. Möglich macht dies unter anderem eine spezielle, an Mäusen bereits erste Erfolge zeitigende Chemikalie, die die Enden von durchtrennten Rückgrat-Nerven, die an sich nicht nachwachsen können, dazu anregt, miteinander zu verschmelzen. Vom Hals abwärts Quergeschnittsgelähmten eröffnet dies vorsichtig eine neue Perspektive auf ein Leben ohne Rollstuhl. Doch "im Erfolgsfall wird eine Kopftransplantion Jahrhunderte alte Debatten über das Verhältnis von Verstand, Gehirn und Körper neu entflammen lassen. Ist das Selbst in einem selbst allein im Gehirn zu verorten? Oder hängt die Persönlichkeit von diesem spezifischen Stück Fleisch ab, dass man den eigenen Körper nennt? Auch gesellschaftliche Fragen werden von einer solchen Operation berührt. Allein der Körper produziert Ei- und Samenzellen. Die Kinder, die ein Transplantationspatient nach einer Operation zeugen würde, wären genetisch nicht mit ihm verwandt, wohl aber mit der Famile des Körperspenders. Hätten die biologischen Verwandten Besuchsrechte oder sogar die Position, das Kind zu vertreten? ... Die wichtigste - und unbeantwortbare - Frage ist die, ob ein Patient sich nach diesem Eingriff noch als er selbst fühlen würde."
Sollte alles gut laufen und die chinesischen Behörden grünes Licht geben, könnte ab Ende 2017 mit ersten Versuchen von Kopftransplantationen zu rechnen sein, schreibt Sam Kean. Möglich macht dies unter anderem eine spezielle, an Mäusen bereits erste Erfolge zeitigende Chemikalie, die die Enden von durchtrennten Rückgrat-Nerven, die an sich nicht nachwachsen können, dazu anregt, miteinander zu verschmelzen. Vom Hals abwärts Quergeschnittsgelähmten eröffnet dies vorsichtig eine neue Perspektive auf ein Leben ohne Rollstuhl. Doch "im Erfolgsfall wird eine Kopftransplantion Jahrhunderte alte Debatten über das Verhältnis von Verstand, Gehirn und Körper neu entflammen lassen. Ist das Selbst in einem selbst allein im Gehirn zu verorten? Oder hängt die Persönlichkeit von diesem spezifischen Stück Fleisch ab, dass man den eigenen Körper nennt? Auch gesellschaftliche Fragen werden von einer solchen Operation berührt. Allein der Körper produziert Ei- und Samenzellen. Die Kinder, die ein Transplantationspatient nach einer Operation zeugen würde, wären genetisch nicht mit ihm verwandt, wohl aber mit der Famile des Körperspenders. Hätten die biologischen Verwandten Besuchsrechte oder sogar die Position, das Kind zu vertreten? ... Die wichtigste - und unbeantwortbare - Frage ist die, ob ein Patient sich nach diesem Eingriff noch als er selbst fühlen würde."New Republic (USA), 24.08.2016
 Der Romancier Paul La Farge (natürlich nicht zu verwechseln mit Paul Lafargue, dem Marx-Schwiegersohn, der kubanische Wurzeln hatte) liest einige Science-Fiction-Romane aus Kuba, etwa die gerade ins Englische übersetzten Werke des regimetreuen Autors Agustín de Rojas, in denen wie bei "Star Wars" eine gute Föderation gegen ein böses Empire kämpft. In "A Legend of the Future" geht es um ein wieder flott zu machendes Raumschiff, das von einem Meteoriten getroffen wurde. Und im Lauf der Legende "bekommt man ein Gespür dafür, dass Rojas Kuba meint, wenn er über das Raumschiff spricht. Das ganze große kommunistische Experiment hängt von diesem bootsförmigen Eiland ab, das mitten in seiner Mission, trotz der Schäden an seiner Hülle, dem Versagen seines Funk-Tramsmitters und der beunruhigenden Möglichkeit einer Subversion seine Mission vollenden muss. Die einzige Hoffnung, suggeriert Rojas, liegt darin, an die Freuden des Lebens unter Genossen zu erinnern und den eigenen Inneraum mit den Bildern der Leute zu füllen, die du liebst, so dass du dich nicht länger alleine fühlen musst."
Der Romancier Paul La Farge (natürlich nicht zu verwechseln mit Paul Lafargue, dem Marx-Schwiegersohn, der kubanische Wurzeln hatte) liest einige Science-Fiction-Romane aus Kuba, etwa die gerade ins Englische übersetzten Werke des regimetreuen Autors Agustín de Rojas, in denen wie bei "Star Wars" eine gute Föderation gegen ein böses Empire kämpft. In "A Legend of the Future" geht es um ein wieder flott zu machendes Raumschiff, das von einem Meteoriten getroffen wurde. Und im Lauf der Legende "bekommt man ein Gespür dafür, dass Rojas Kuba meint, wenn er über das Raumschiff spricht. Das ganze große kommunistische Experiment hängt von diesem bootsförmigen Eiland ab, das mitten in seiner Mission, trotz der Schäden an seiner Hülle, dem Versagen seines Funk-Tramsmitters und der beunruhigenden Möglichkeit einer Subversion seine Mission vollenden muss. Die einzige Hoffnung, suggeriert Rojas, liegt darin, an die Freuden des Lebens unter Genossen zu erinnern und den eigenen Inneraum mit den Bildern der Leute zu füllen, die du liebst, so dass du dich nicht länger alleine fühlen musst."Werner Herzog hat einen schönen Essayfilm über das Internet gemacht, "Lo and Behold: Reveries of the Connected World". Sven Birkerts versichert, dass sich Herzog viel Zeit nimmt, um auch die steilsten Visionen über einen künftig mit dem Internet identischen, telepathisch twitternden Schwarmgeist der Menschheit auszumalen. Und doch "gehört Herzogs Herz klar den Dingen, wie wir sie kannten. Leuten mit Namen und Biografien, Objekten, auf die man klopft und die ein Geräusch machen, unendlichen Räumen voller natürlichem Licht. Auch der Langsamkeit, dem Reibungswiderstand der Wirklichkeit. Sein Film endet mit einem Rückblick auf einen älteren Spielort, die ländliche Isolation von Green Bank, West Virginia, wo wir nochmal den Astronomen Jay Lockman sehen, der auch Banjo spielt. Eine struppige Gruppe stimmt in den alten Standard 'Old Salty Dog' ein. Die Leute drumherum klatschen Beifall - eine wahre Gemeinschaft."
Hospodarske noviny (Tschechien), 03.09.2016
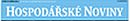 Zum Schulbeginn macht sich der tschechische Ökonom und Autor Tomáš Sedláček Gedanken über die digitalisierte Jugend. Während Mobiltelefone ja ursprünglich das Instrument reicher, wichtiger, unentbehrlicher Geschäftsleute waren, sind sie heute das Spielzeug der Kinder - und Sedláček möchte das keineswegs verteufeln, auch wenn viele ihre Kinder lieber im Sand spielen sähen. "Ein Teil unserer politischen und unternehmerischen Eliten versucht uns unablässig einzureden, dass wir handwerklich geschickte Arbeitskräfte benötigen. Dabei ist es ein offenes Geheimnis, dass in ein paar Jahren intelligente Roboter die manuelle Arbeit ersetzen werden. Es ist, als wollte man Achtjährige zu zukünftigen Taxifahrern trainieren, während wir doch täglich in der Zeitung von Autos lesen, die sich fahrerlos fortbewegen werden. Sicher, ein paar Leute werden noch Auto fahren - etwa so, wie man heute noch reitet. Aus Spaß, als Sport, aus Nostalgie. Vielleicht ahnen unsere Kinder etwas, was wir uns selbst nicht bewusst machen. Dass sie, indem sie sich in der digitalen Welt orientieren, am ehesten 'auf Sicherheit setzen' - auch wenn ich diese Formulierung nicht besonders mag. (...) Statt also gegen digitale Spiele anzukämpfen, sollten wir darüber nachdenken, ob es nicht diese Spiele sind, die unsere Kinder gleichzeitig schulen. Ich habe zum Beispiel den begründeten Verdacht, dass Minecraft meinem Sohn in den Sommerferien mehr englische Vokabeln beigebracht hat als ein ganzes Schuljahr. (...) Vielleicht sollten wir anfangen, diese Spiele als Schulung zu sehen. Als Schulung für eine Welt, auf die nicht einmal wir selbst vorbereitet sind."
Zum Schulbeginn macht sich der tschechische Ökonom und Autor Tomáš Sedláček Gedanken über die digitalisierte Jugend. Während Mobiltelefone ja ursprünglich das Instrument reicher, wichtiger, unentbehrlicher Geschäftsleute waren, sind sie heute das Spielzeug der Kinder - und Sedláček möchte das keineswegs verteufeln, auch wenn viele ihre Kinder lieber im Sand spielen sähen. "Ein Teil unserer politischen und unternehmerischen Eliten versucht uns unablässig einzureden, dass wir handwerklich geschickte Arbeitskräfte benötigen. Dabei ist es ein offenes Geheimnis, dass in ein paar Jahren intelligente Roboter die manuelle Arbeit ersetzen werden. Es ist, als wollte man Achtjährige zu zukünftigen Taxifahrern trainieren, während wir doch täglich in der Zeitung von Autos lesen, die sich fahrerlos fortbewegen werden. Sicher, ein paar Leute werden noch Auto fahren - etwa so, wie man heute noch reitet. Aus Spaß, als Sport, aus Nostalgie. Vielleicht ahnen unsere Kinder etwas, was wir uns selbst nicht bewusst machen. Dass sie, indem sie sich in der digitalen Welt orientieren, am ehesten 'auf Sicherheit setzen' - auch wenn ich diese Formulierung nicht besonders mag. (...) Statt also gegen digitale Spiele anzukämpfen, sollten wir darüber nachdenken, ob es nicht diese Spiele sind, die unsere Kinder gleichzeitig schulen. Ich habe zum Beispiel den begründeten Verdacht, dass Minecraft meinem Sohn in den Sommerferien mehr englische Vokabeln beigebracht hat als ein ganzes Schuljahr. (...) Vielleicht sollten wir anfangen, diese Spiele als Schulung zu sehen. Als Schulung für eine Welt, auf die nicht einmal wir selbst vorbereitet sind." The Nation (USA), 19.09.2016
 Das Internet ist längst zur "zweiten Natur" und für Künstler zur unendlichen Quelle von Bildern und Techniken geworden, wie könnte also "Post-Internet-Art" aussehen, fragt Barry Schwabsky. Auf der Berlin Biennale findet er keine Antworten, dafür aber bei Thomas Struth im Martin Gropius Bau, der Schwabskys Verständnis von "Natur und Politik" in Frage stellt. Gezeigt werden weder Reflektionen über den Krieg im Nahen Osten, die Krise der Europäischen Union oder den wachsenden Erfolg von populistischen Parteien, noch Bäume, Tiere, Landschaften: "Zwar zeigen einige Bilder in 'Natur und Politik' Landschaften, aufgenommen wurde sie aber in Anaheim, Kalifornien, sie sind Disneyland-Abbilder von Plätzen, die vielleicht irgendwo existieren könnten. Überraschender und auffälliger sind Bilder von Labors und technischen Instituten, wo grundlegende Elemente der Natur untersucht und manipuliert werden. Dies sind die Orte, wo Natur politisch wird und wo das Kapital hinfließt, jedoch ohne, dass es von uns bemerkt wird."
Das Internet ist längst zur "zweiten Natur" und für Künstler zur unendlichen Quelle von Bildern und Techniken geworden, wie könnte also "Post-Internet-Art" aussehen, fragt Barry Schwabsky. Auf der Berlin Biennale findet er keine Antworten, dafür aber bei Thomas Struth im Martin Gropius Bau, der Schwabskys Verständnis von "Natur und Politik" in Frage stellt. Gezeigt werden weder Reflektionen über den Krieg im Nahen Osten, die Krise der Europäischen Union oder den wachsenden Erfolg von populistischen Parteien, noch Bäume, Tiere, Landschaften: "Zwar zeigen einige Bilder in 'Natur und Politik' Landschaften, aufgenommen wurde sie aber in Anaheim, Kalifornien, sie sind Disneyland-Abbilder von Plätzen, die vielleicht irgendwo existieren könnten. Überraschender und auffälliger sind Bilder von Labors und technischen Instituten, wo grundlegende Elemente der Natur untersucht und manipuliert werden. Dies sind die Orte, wo Natur politisch wird und wo das Kapital hinfließt, jedoch ohne, dass es von uns bemerkt wird."Absolut lesenswert findet der in Stanford lehrende Historiker Richard White ein Buch von Benjamin Madley über den Genozid an den Indianern im Kalifornien der Jahre 1846-1873. Madley interessiert sich vor allem für die institutionelle Basis dieses Völkermords, so White: "Madley behauptet - und das ist der Kern seines Buchs - dass Kaliforniens Regierungsvertreter tatsächlich 'die Hauptarchitekten der Vernichtung' waren und dass sie von der Bundesregierung dazu ermächtigt und finanziell unterstützt wurden. Zusammen schufen Landes- und Bundesbeamte, was Madley als 'Tötungsmaschinerie' beschreibt, bestehend aus amerikanischen Soldaten, kalifornischer Miliz und Freiwilligen sowie aus Sklavenhändlern und Söldnern (sogenannten 'Indianerjägern'), die für Geld dabei waren. Laut Madley 'brauchte es einen nachhaltigen politischen Willen - sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene - um die Gesetze, die Strategien und die gut finanzierte Tötungsmaschinerie zu schaffen, die sicher stellten, dass [dieser Genozid] über Jahrzehnte begangen werden konnte."
Bookforum (USA), 06.09.2016
 In der aktuellen Ausgabe von Bookforum macht sich Gene Seymour Gedanken darüber, wie ein gutes Buch über das derzeitige Rennen ums Weiße Haus wohl aussehen müsste. Da sich das Leben in den USA im Moment wie ein dystopischer Roman anfühlt und Trump in seinem eigenen, undurchschaubaren Universum lebt, meint Seymour, wären vielleicht Borges oder Cortázar die passenden Autoren für so ein Buch: "Mein Buch würde nicht die Erschaffung eines Präsidenten nachvollziehen, sondern die Erschaffung einer Wählerschaft, eines Konsensus, einer wachsenden demokratischen Bewegung, die vielleicht nicht jetzt aber in der Zukunft eine Rolle spielen werden. Es wäre ein Buch über ein aufkeimendes Gefühl, das in der Kakophonie der Schlauberger und selbsternannten Weisen auf allen Seiten des politischen Spektrums nicht vorkommt: die Hoffnung auf eine Zukunft und ferne Signale von jungen Menschen, die nicht länger unter Bedingungen wie den gegenwärtigen leben wollen. Wenn der Leser solche Möglichkeiten nicht erkennen kann, wenn er sich von dem Gedröhn der Empörung und von der behaupteten Anwartschaft hat verführen lassen, um auf das Schlimmste in diesem November und darüber hinaus vorbereitet zu sein, dann ist der Leser nicht jenseits des Shitstorms, den sein Zynismus behauptet zu verachten, sondern mittendrin. Und mein Buch, wer immer es schreiben und wie immer es aussehen wird, wird gar nichts mit dem Leser zu tun haben wollen."
In der aktuellen Ausgabe von Bookforum macht sich Gene Seymour Gedanken darüber, wie ein gutes Buch über das derzeitige Rennen ums Weiße Haus wohl aussehen müsste. Da sich das Leben in den USA im Moment wie ein dystopischer Roman anfühlt und Trump in seinem eigenen, undurchschaubaren Universum lebt, meint Seymour, wären vielleicht Borges oder Cortázar die passenden Autoren für so ein Buch: "Mein Buch würde nicht die Erschaffung eines Präsidenten nachvollziehen, sondern die Erschaffung einer Wählerschaft, eines Konsensus, einer wachsenden demokratischen Bewegung, die vielleicht nicht jetzt aber in der Zukunft eine Rolle spielen werden. Es wäre ein Buch über ein aufkeimendes Gefühl, das in der Kakophonie der Schlauberger und selbsternannten Weisen auf allen Seiten des politischen Spektrums nicht vorkommt: die Hoffnung auf eine Zukunft und ferne Signale von jungen Menschen, die nicht länger unter Bedingungen wie den gegenwärtigen leben wollen. Wenn der Leser solche Möglichkeiten nicht erkennen kann, wenn er sich von dem Gedröhn der Empörung und von der behaupteten Anwartschaft hat verführen lassen, um auf das Schlimmste in diesem November und darüber hinaus vorbereitet zu sein, dann ist der Leser nicht jenseits des Shitstorms, den sein Zynismus behauptet zu verachten, sondern mittendrin. Und mein Buch, wer immer es schreiben und wie immer es aussehen wird, wird gar nichts mit dem Leser zu tun haben wollen." Außerdem: Benjamin Anastas findet Javier Marias' neuen Roman über Spionage in post-Franco-Spanien ("Thus Bad begins") allzu geschwätzig und was die Konstruktionsmittel angeht gar abgedroschen, als wäre der Autor mit seinem 13. Roman in seine Jeff-Koons-Periode eingetreten. Jabari Asim bespricht zwei Essay-Sammlungen über ethnische Beziehungen in den USA. Und Lidija Haas befasst sich mit einem Buch von Emily Witt, das Alternativen zur traditionellen Paarbeziehung erkundet und feststellt: Lieber die eigenen kleinen, konkreten Wünsche erkennen und an ihrer Erfülllung arbeiten, als auf das sexuelle Utopia warten.
New York Times (USA), 04.09.2016
 In der neuen Ausgabe des Magazins verfolgt Irina Aleksander die komplizierte Geschichte der Entstehung von Oliver Stones Film über Edward Snowden, der auf dem Roman "Time of the Octopus" von Anatoly Kucherena basiert: "'Time of the Octopus' spielt in einer einzigen Nacht. Der Protagonist Joshua Cold wird in einem bunkerartigen Teil des Flughafens Moskau-Scheremetjewo festgehalten, wo ihm sein russischer Anwalt Gesellschaft leistet. Die Kapitel wechseln zwischen den tatsächlichen Gesprächen und den Audioaufzeichnungen des Anwalts. Die Fakten und Namen klingen vertraut: Es gibt zwei Journalisten namens Boitras und Greywold und eine Organisation namens Mikileaks mit ihrem Chef Augusto Cassangie. Die meiste Zeit reden Cold und sein Anwalt über das Leben und zitieren Laotse. Aber im Roman gibt es auch einen spezifisch post-sowjetischen Ton, der mit seinen vielen Bezügen von Popeye bis Tupac Shakur wie eine Liebeserklärung an die US-Kultur klingt und zugleich nach hämischem Spott gegen die US-Regierung."
In der neuen Ausgabe des Magazins verfolgt Irina Aleksander die komplizierte Geschichte der Entstehung von Oliver Stones Film über Edward Snowden, der auf dem Roman "Time of the Octopus" von Anatoly Kucherena basiert: "'Time of the Octopus' spielt in einer einzigen Nacht. Der Protagonist Joshua Cold wird in einem bunkerartigen Teil des Flughafens Moskau-Scheremetjewo festgehalten, wo ihm sein russischer Anwalt Gesellschaft leistet. Die Kapitel wechseln zwischen den tatsächlichen Gesprächen und den Audioaufzeichnungen des Anwalts. Die Fakten und Namen klingen vertraut: Es gibt zwei Journalisten namens Boitras und Greywold und eine Organisation namens Mikileaks mit ihrem Chef Augusto Cassangie. Die meiste Zeit reden Cold und sein Anwalt über das Leben und zitieren Laotse. Aber im Roman gibt es auch einen spezifisch post-sowjetischen Ton, der mit seinen vielen Bezügen von Popeye bis Tupac Shakur wie eine Liebeserklärung an die US-Kultur klingt und zugleich nach hämischem Spott gegen die US-Regierung."Außerdem: Rachel Cusk macht sich Gedanken über häuslichen Komfort. Und Joshua Hammer stellt uns Berhanu Nega vor, der seinen Posten als geachteter Universitätsprofessor in Lewisburg gegen die Rolle eines Rebellenführers in Äthiopien eingetauscht hat.
Kommentieren