Magazinrundschau
Das ist reines Zocken
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
25.03.2013. Le Monde fragt, wer ist der Guru von Beppe Grillo und präsentiert Gianroberto Casaleggio als leicht unheimliche New-Age-Figur. Espresso bringt ein apokalyptisches Video Casaleggios. The Atlantic erzählt, warum der jordanische König nicht so demokratisch sein kann wie er möchte. Elet es Irodalom stellt ein Buch über "Ungarische Besatzungstruppen in der Sowjetunion" vor. La vie des idees erzählt, wie man in Frankreich den Tod laizisiert hat. Im Guardian erklärt Taiye Selasi, warum sie die Frage "Wo kommst du her?" kaum beantworten kann. Fast Company lernt von Kickstarter, warum Mädchen mit Lithografieprojekten immer zu bevorzugen sind. Wired möchte nicht Verleger sein.
Le Monde | Elet es Irodalom | Slate.fr | Wired | HVG | Guernica | El Malpensante | New York Times | Espresso | Guardian | Magyar Narancs | The Atlantic | La vie des idees | Fast Company | Eurozine
Le Monde (Frankreich), 14.03.2013
 Ziemlich anders kann einem werden, wenn man Philippe Ridets bestens informiertes Porträt über den "Guru von Grillo", Gianroberto Casaleggio, liest, der Beppe Grillos Blog zu einer der meistbesuchten Seiten der Welt aufgebaut hat und nebenbei an ein ziemlich sektenähnliches New-Age-Gewaber glaubt. Wie das Netz funktioniert, hat er aber bestens verstanden - seine Formel: "'Hundert Prozent der Informationen im Netz werden von zehn Prozent seiner Nutzer produziert.' Diese zehn Prozent will Casaleggio ansprechen. Darum werden alle kritischen Kommentare auf Grillos Blog systematisch gelöscht, während die 'Grillinauten' überall sonst im Netz ihre Meinungen verkünden. Italien zeichnet sich durch seinen Rückstand beim schnellen Internet aus, aber das stört den Guru nicht: 'Wer eine politische Biotschaft im Netz empfängt, tut es aus eigenem Willen. Er gibt sie weiter an seine Freunde per Facebook, an seine Eltern, seine Geschwister, abends beim Essen. Die virale Verbreitug der Message kompensiert sehr weitgehend die Grenzen des Netzes in Italien.'"
Ziemlich anders kann einem werden, wenn man Philippe Ridets bestens informiertes Porträt über den "Guru von Grillo", Gianroberto Casaleggio, liest, der Beppe Grillos Blog zu einer der meistbesuchten Seiten der Welt aufgebaut hat und nebenbei an ein ziemlich sektenähnliches New-Age-Gewaber glaubt. Wie das Netz funktioniert, hat er aber bestens verstanden - seine Formel: "'Hundert Prozent der Informationen im Netz werden von zehn Prozent seiner Nutzer produziert.' Diese zehn Prozent will Casaleggio ansprechen. Darum werden alle kritischen Kommentare auf Grillos Blog systematisch gelöscht, während die 'Grillinauten' überall sonst im Netz ihre Meinungen verkünden. Italien zeichnet sich durch seinen Rückstand beim schnellen Internet aus, aber das stört den Guru nicht: 'Wer eine politische Biotschaft im Netz empfängt, tut es aus eigenem Willen. Er gibt sie weiter an seine Freunde per Facebook, an seine Eltern, seine Geschwister, abends beim Essen. Die virale Verbreitug der Message kompensiert sehr weitgehend die Grenzen des Netzes in Italien.'"Espresso (Italien), 20.03.2013
 Grillo-Berater Gianroberto Casaleggio ist auch Autor eines programmatischen Internetvideos, "Gaia - The future of politics", dessen an Power Point gemahnende Bildsprache Marco Belpoliti in L'Espresso analysiert: Casaleggio sagt darin eine Apokalypse voraus, die die Erdbevölkerung auf eine Milliarde Menschen reduziert, bevor der im Besitz des Internets befindliche Westen die Kräfte des Bösen besiegt und eine Grassroots-Regierung ganz ohne Geheimgesellschaften und ein kollektives, per Netz kommunizierendes Bewusstsein installiert: "Wer ein solches Video realisiert, ist tief in der Kultur der siebziger Jahre verwurzelt und hat das apokalyptische Denken dieser zwischen Vergangenheit und Zukunft schwankenden Epoche zutiefst verinnerlicht und mit den Ideen verbunden, die sich in den achtziger und neunziger Jahren an den Personalcomputer knüpften. Das Anfangsbild mit dem azurblauen Planeten Gaia von James Lovelock als Hintergrund und das Schlussbild mit dem wie ein Planet rotierenden blauem Gehirn erinnern unweigerlich an Stanley Kubricks '2001'. Wähnt sich der Guru der Fünf-Sterne-Bewegung an den Schalthebeln von HAL 9000?"
Grillo-Berater Gianroberto Casaleggio ist auch Autor eines programmatischen Internetvideos, "Gaia - The future of politics", dessen an Power Point gemahnende Bildsprache Marco Belpoliti in L'Espresso analysiert: Casaleggio sagt darin eine Apokalypse voraus, die die Erdbevölkerung auf eine Milliarde Menschen reduziert, bevor der im Besitz des Internets befindliche Westen die Kräfte des Bösen besiegt und eine Grassroots-Regierung ganz ohne Geheimgesellschaften und ein kollektives, per Netz kommunizierendes Bewusstsein installiert: "Wer ein solches Video realisiert, ist tief in der Kultur der siebziger Jahre verwurzelt und hat das apokalyptische Denken dieser zwischen Vergangenheit und Zukunft schwankenden Epoche zutiefst verinnerlicht und mit den Ideen verbunden, die sich in den achtziger und neunziger Jahren an den Personalcomputer knüpften. Das Anfangsbild mit dem azurblauen Planeten Gaia von James Lovelock als Hintergrund und das Schlussbild mit dem wie ein Planet rotierenden blauem Gehirn erinnern unweigerlich an Stanley Kubricks '2001'. Wähnt sich der Guru der Fünf-Sterne-Bewegung an den Schalthebeln von HAL 9000?"Hier das (englischsprachige) Video:
Guardian (UK), 23.03.2013
 Die als Tochter eines Ghanaers und einer Nigerianerin in London geborene, und in Boston aufgewachsene Taiye Selasi, deren Roman "Diese Dinge geschehen nicht einfach so" gerade auch auf Deutsch veröffentlicht wurde, erzählt, wie schwierig es für sie ist, die einfache Frage "Wo kommst du her?" zu beanworten. "Ich war leidenschaftlich interessiert an Afrika, aber ich war nicht stolz darauf. Das konnte ich nicht. Meine Verbindung zu Afrika, zu meinem afrikanischen Vater, stand im Weg. Ileane hatte recht. Was ich in Jamaika fühlte, war Scham über meine Familiengeschichte: die Armut, Polygamie, eine Stereotyp afrikanischer Dysfunktion nach dem anderen. Es schien immer eine Sache schlichter Höflichkeit zu sein, diese Dinge Fremden gegenüber unerwähnt zu lassen, die fragten, woher ich kam. Aber offenbar war dabei auch etwas anderes im Spiel: ein Bedürfnis zu verschleiern woher und von wem ich abstamme. Intellektuell betrachte ich mich als Produkt des modernen Westafrikas. Emotional sehe ich mich als die Tochter eines westafrikanischen Polygamisten. Ich musste mich auf andere Art und Weise als Afrikanerin wahrnehmen lernen, nicht nur als Erbin der Kränkungen meiner Eltern."
Die als Tochter eines Ghanaers und einer Nigerianerin in London geborene, und in Boston aufgewachsene Taiye Selasi, deren Roman "Diese Dinge geschehen nicht einfach so" gerade auch auf Deutsch veröffentlicht wurde, erzählt, wie schwierig es für sie ist, die einfache Frage "Wo kommst du her?" zu beanworten. "Ich war leidenschaftlich interessiert an Afrika, aber ich war nicht stolz darauf. Das konnte ich nicht. Meine Verbindung zu Afrika, zu meinem afrikanischen Vater, stand im Weg. Ileane hatte recht. Was ich in Jamaika fühlte, war Scham über meine Familiengeschichte: die Armut, Polygamie, eine Stereotyp afrikanischer Dysfunktion nach dem anderen. Es schien immer eine Sache schlichter Höflichkeit zu sein, diese Dinge Fremden gegenüber unerwähnt zu lassen, die fragten, woher ich kam. Aber offenbar war dabei auch etwas anderes im Spiel: ein Bedürfnis zu verschleiern woher und von wem ich abstamme. Intellektuell betrachte ich mich als Produkt des modernen Westafrikas. Emotional sehe ich mich als die Tochter eines westafrikanischen Polygamisten. Ich musste mich auf andere Art und Weise als Afrikanerin wahrnehmen lernen, nicht nur als Erbin der Kränkungen meiner Eltern."Auch der pakistanische Autor Mohsin Hamid ist ein Wanderer zwischen den Welten. In den USA, wo er erstmals im Alter von drei bis neun Jahren lebte, lernte er mit dem Online-Rollenspiel "Dungeons and Dragons" die Grundlagen seines literarischen Handwerks, erzählt er: "Als ich mit der Arbeit an meinem dritten Roman anfing, war ich überzeugt, dass Romane keine passive Form der Unterhaltung sind. Romane waren nicht nur für den Autor, sondern auch für den Leser eine Möglichkeit, etwas zu erfinden. Romane waren anders als Film oder Fernsehen, weil Leser den Quellcode sehen - wir nennen die abstrakten Symbole Buchstaben und Wörter - und mehr von der Geschichte selbst zusammenfügen können. Romane haben keine Soundtracks und keine Besetzungsbüros. Ich dachte mir, mein neuer Roman sollte diese Natur der Autor-Leser-Beziehung deutlich machen, dass man als Leser gleichzeitig Publikum, Protagonist und Erzähler ist. Ich verstand immer mehr, dass eine Art Selbstdarstellung (und Selbst-Transzendenz und sogar Selbsthilfe) zentral ist für das, was Literatur dem Autor wie auch seinen Lesern ermöglicht."
Außerdem: Robin Yassin-Kassab stellt "The Iraqi Christ", den neuen Erzählband des in Finnland lebenden irakischen Autors Hassan Blasim vor. Anlässlich der Moore-Rodin-Ausstellung, die ab 29. März in der Henry Moore Foundation gezeigt wird, druckt der Guardian ein Interview mit Henry Moore aus dem Jahr 1970, das der künftige Direktor der Tate Gallery Alan Bowness mit ihm über Rodin führte.
Magyar Narancs (Ungarn), 05.03.2013
 In einem umfangreichen Artikel berichten Gábor Tanner und Róbert Gyökér über die Auswirkungen des veränderten Finanzierungssystems für die ungarische Filmindustrie. Durch die Veränderungen entstand eine Diversifizierung der Aufgabenbereiche, stellen die Autoren fest. So gehört die Finanzierung von Drehbüchern und Spielfilmen zum Verantwortungsbereich des Hollywood-Produzenten und Regierungsbeauftragten für die Umstrukturierung der ungarischen Filmförderung, Andrew G. Vajna. Für die Produktion von Dokumentar-, Animations- und Kurzfilmen ist die durch das ungarische Mediengesetz geschaffene Medienbehörde zuständig. Der Bereich der Kinos, Filmfestivals, Archivierung, sowie die Unterstützung vom Vertrieb der Autorenfilme liegt nun in der Zuständigkeit des Nationalen Kulturfonds (NKA). Besonders wichtig für Vajna war die Entwicklung von Drehbüchern. In den vergangenen zwei Jahren wurden 60 Drehbücher staatlich gefördert. Bei seiner Amtseinführung stellte Vajna fest, dass er jährlich für 8 bis 10 förderungsfähige Produktionen planen konnte. So entstand die Situation, dass staatlich geförderte Drehbücher schließlich doch nicht umgesetzt wurden (im Jahre 2009 gab es 26, 2008 gab es 27, 2007 gab es 32 und 2006 21 geförderte und verwirklichte Filmproduktionen). Im Bereich der Dokumentarfilme ist die Situation ähnlich. "Die künstlerische Freiheit darf nicht beeinträchtigt werden" hieß anfangs die von der Medienbehörde ausgegebene Parole. Allerdings gab es bald bevorzugte Themen wie "die Darstellung der in der Landwirtschaft Beschäftigten", Dokumentationen über "die jüngste Vergangenheit des Karpaten-Beckens" oder "die Probleme, Chancen und Aussichten von Jugendlichen".
In einem umfangreichen Artikel berichten Gábor Tanner und Róbert Gyökér über die Auswirkungen des veränderten Finanzierungssystems für die ungarische Filmindustrie. Durch die Veränderungen entstand eine Diversifizierung der Aufgabenbereiche, stellen die Autoren fest. So gehört die Finanzierung von Drehbüchern und Spielfilmen zum Verantwortungsbereich des Hollywood-Produzenten und Regierungsbeauftragten für die Umstrukturierung der ungarischen Filmförderung, Andrew G. Vajna. Für die Produktion von Dokumentar-, Animations- und Kurzfilmen ist die durch das ungarische Mediengesetz geschaffene Medienbehörde zuständig. Der Bereich der Kinos, Filmfestivals, Archivierung, sowie die Unterstützung vom Vertrieb der Autorenfilme liegt nun in der Zuständigkeit des Nationalen Kulturfonds (NKA). Besonders wichtig für Vajna war die Entwicklung von Drehbüchern. In den vergangenen zwei Jahren wurden 60 Drehbücher staatlich gefördert. Bei seiner Amtseinführung stellte Vajna fest, dass er jährlich für 8 bis 10 förderungsfähige Produktionen planen konnte. So entstand die Situation, dass staatlich geförderte Drehbücher schließlich doch nicht umgesetzt wurden (im Jahre 2009 gab es 26, 2008 gab es 27, 2007 gab es 32 und 2006 21 geförderte und verwirklichte Filmproduktionen). Im Bereich der Dokumentarfilme ist die Situation ähnlich. "Die künstlerische Freiheit darf nicht beeinträchtigt werden" hieß anfangs die von der Medienbehörde ausgegebene Parole. Allerdings gab es bald bevorzugte Themen wie "die Darstellung der in der Landwirtschaft Beschäftigten", Dokumentationen über "die jüngste Vergangenheit des Karpaten-Beckens" oder "die Probleme, Chancen und Aussichten von Jugendlichen".The Atlantic (USA), 01.04.2013
 Jordanien ist arm, rückständig und von einer Menge feindlicher Staaten umgeben. Der semi-absolutistische König Abdullah hätte sein Volk gern reicher, glücklicher und politisch emanzipierter, schreibt Jeffrey Goldberg in einem großen Porträt. Aber bisher blieben Abdullahs Reformen recht halbherzig, auch weil außer den Muslimbrüdern niemand im Wüstenstaat eine Demokratisierung befürwortet. Schon gar nicht die lokalen Machthaber: "Mehr als die Hälfte der Jordanier sind palästinensischer Herkunft, mit Wurzeln in der Westbank, aber die Stammesführer stammen von der Eastbank (des Jordans), und die Haschemiten-Könige waren zur Verteidigung des Throns auf Eastbanker angewiesen, seit sie vor hundert Jahren aus Mekka in das Gebiet kamen, das damals Transjordanien hieß. Diese Beziehung ist von kühler Geschäftsmäßigkeit: Für ihre Unterstützung des königlichen Hofes erwarten die Führer der östlichen Stammes, dass die Haschemiten im Gegenzug ihre Privilegien schützen und die Palästinenser in Schach halten. Wenn die Haschemiten dies nicht genug beachten, folgen die Probleme auf den Fuß."
Jordanien ist arm, rückständig und von einer Menge feindlicher Staaten umgeben. Der semi-absolutistische König Abdullah hätte sein Volk gern reicher, glücklicher und politisch emanzipierter, schreibt Jeffrey Goldberg in einem großen Porträt. Aber bisher blieben Abdullahs Reformen recht halbherzig, auch weil außer den Muslimbrüdern niemand im Wüstenstaat eine Demokratisierung befürwortet. Schon gar nicht die lokalen Machthaber: "Mehr als die Hälfte der Jordanier sind palästinensischer Herkunft, mit Wurzeln in der Westbank, aber die Stammesführer stammen von der Eastbank (des Jordans), und die Haschemiten-Könige waren zur Verteidigung des Throns auf Eastbanker angewiesen, seit sie vor hundert Jahren aus Mekka in das Gebiet kamen, das damals Transjordanien hieß. Diese Beziehung ist von kühler Geschäftsmäßigkeit: Für ihre Unterstützung des königlichen Hofes erwarten die Führer der östlichen Stammes, dass die Haschemiten im Gegenzug ihre Privilegien schützen und die Palästinenser in Schach halten. Wenn die Haschemiten dies nicht genug beachten, folgen die Probleme auf den Fuß."La vie des idees (Frankreich), 18.03.2013
 Nicolas Picard liest Anne Carols Studie mit dem großartigen Titel "Physiologie de la Veuve", die die von den Ärzten Joseph-Ignace Guillotin und Antoine Louis aus humanitären Gründen erfundene Guillotine in die Geschichte medizinischen Denkens stellt. Denn seit dieser Zeit, so Picard, "braucht der Übergang vom Leben zum Tod eine Diagnose. Der 'gute Tod' wird laizisiert, es geht darum, schnell und ohne Leid zu sterben. Darum spricht sich Guillotin nicht nur als Schüler des Rechtsphilosphen Cesare Beccaria und Erneuerera des Strafrechts für eine Modernisierung der Exekution aus, auch seine Ausführunen zur 'Technik' spiegeln eine medizinischer Expertenschaft in der Frage des idealen Tods wider. Aus demselben Grund wendet sich die Constituante an Antoine Louis, den Autor des 'Briefs über die Gewissheit der Todesanzeichen', der dazu beitragen soll, einen plötzlichen und schmerzlosen Tod zu bieten."
Nicolas Picard liest Anne Carols Studie mit dem großartigen Titel "Physiologie de la Veuve", die die von den Ärzten Joseph-Ignace Guillotin und Antoine Louis aus humanitären Gründen erfundene Guillotine in die Geschichte medizinischen Denkens stellt. Denn seit dieser Zeit, so Picard, "braucht der Übergang vom Leben zum Tod eine Diagnose. Der 'gute Tod' wird laizisiert, es geht darum, schnell und ohne Leid zu sterben. Darum spricht sich Guillotin nicht nur als Schüler des Rechtsphilosphen Cesare Beccaria und Erneuerera des Strafrechts für eine Modernisierung der Exekution aus, auch seine Ausführunen zur 'Technik' spiegeln eine medizinischer Expertenschaft in der Frage des idealen Tods wider. Aus demselben Grund wendet sich die Constituante an Antoine Louis, den Autor des 'Briefs über die Gewissheit der Todesanzeichen', der dazu beitragen soll, einen plötzlichen und schmerzlosen Tod zu bieten."Außerdem in La vie des idées: ein Essay des Philosophen José Luis Moreno Pestaña über die Bewegung der "Empörten" in Spanien.
Fast Company (USA), 18.03.2013
 Nicole Laporte sieht eine neue Generation von Rebellen heranwachsen, die Hollywood einmal mehr retten werden - und zwar mit Youtube, wobei Laporte insbesondere Sarah Silvermans und Michael Ceras neuen Youtube-Kanal Jash herausstellt: "Eine ganze Reihe vorausdenkender Stars, Produzenten, Agenten und Studiochefs wagen sich in die digitale Welt - bevor die digitale Welt sie ersetzt. Ihr Timing könnte gar nicht besser sein: Im Jahr 2012 schauten die US-Amerikaner erstmals mehr Filme über das Internet (via Netflix, Amazon und iTunes) als über gekaufte oder geliehene DVDs. Apps wie Angry Bird sind (bezogen auf das Verhältnis zwischen Kosten und Ertrag) so erfolgreich wie das Blockbuster-Franchise 'The Dark Knight'. ... Daraus folgt, dass Hollywood derzeit eher händeringend nach dem nächsten Instagram sucht, das innerhalb von 18 Monaten nach dem Launch von Facebook für 715 Millionen Dollar übernommen wurde, als nach dem nächsten Channing Tatum. Silverman hat vielleicht nicht viel Respekt für das 'Talent' der Youtuber, aber sie und ihre Hollywoodfreunde sind sehr interessiert an der Kompetenz von Youtube, was Online-Distribution betrifft, und deren Gabe, ein Publikum zu schaffen, das Millionen an Werbeeinahmen abwirft." Hier stellen Silverman und Cera Jash vor:
Nicole Laporte sieht eine neue Generation von Rebellen heranwachsen, die Hollywood einmal mehr retten werden - und zwar mit Youtube, wobei Laporte insbesondere Sarah Silvermans und Michael Ceras neuen Youtube-Kanal Jash herausstellt: "Eine ganze Reihe vorausdenkender Stars, Produzenten, Agenten und Studiochefs wagen sich in die digitale Welt - bevor die digitale Welt sie ersetzt. Ihr Timing könnte gar nicht besser sein: Im Jahr 2012 schauten die US-Amerikaner erstmals mehr Filme über das Internet (via Netflix, Amazon und iTunes) als über gekaufte oder geliehene DVDs. Apps wie Angry Bird sind (bezogen auf das Verhältnis zwischen Kosten und Ertrag) so erfolgreich wie das Blockbuster-Franchise 'The Dark Knight'. ... Daraus folgt, dass Hollywood derzeit eher händeringend nach dem nächsten Instagram sucht, das innerhalb von 18 Monaten nach dem Launch von Facebook für 715 Millionen Dollar übernommen wurde, als nach dem nächsten Channing Tatum. Silverman hat vielleicht nicht viel Respekt für das 'Talent' der Youtuber, aber sie und ihre Hollywoodfreunde sind sehr interessiert an der Kompetenz von Youtube, was Online-Distribution betrifft, und deren Gabe, ein Publikum zu schaffen, das Millionen an Werbeeinahmen abwirft." Hier stellen Silverman und Cera Jash vor:Auch Crowdfunding (etwa über den Branchenführer Kickstarter) zählt zu den großen Hoffnungen auf eine Erneuerung des Filmgeschäfts. Von Max Chafkin erfahren wir unterdessen, dass sich die Geschäftsführer von Kickstarter allem Erfolg zum Trotz eher als Kuratoren verstehen - weshalb sich im Netz die verärgerten Stimmen von Leuten häufen, deren Projekt von vornherein abgelehnt wurde. "Die Gründer von Kickstarter scheinen sich stark auf jene Künstler zu konzentrieren, die ihre eigene Community mitbringen. ... 'Es ist so: Würde Michael Bay auf uns zukommen und ein Kickstarter-Projekt vorschlagen, würden wir ihn sehr wahrscheinlich darum bitten, davon abzusehen', sagt Mitbegründer Strickler. 'Ich würde aber niemals das Mädchen mit seinem Lithografieprojekt von 500 Dollar verschrecken wollen, denn für so etwas haben wir mit der Sache überhaupt angefangen. Unserer Auffassung nach haben wir ihr gegenüber eine moralische Verpflichtung'. Eine idealistische Position, die einen beträchtlichen Haufen Geld von vornherein ausschlägt, doch mag dies auch den Genius der Seite ausmachen. Indem Kickstarter rigorose Richtlinien aussprach, ist es der Seite gelungen, kein Einkaufszentrum für nicht-existente Produkte zu werden."
Eurozine (Österreich), 19.03.2013
 So schön konnte man der Zensur von außen noch nie zugucken! Timothy Garton Ash greift einen Zensurskandal in China auf: Der Neujahrsartikel der Southern Weekly, einer als liberal geltenden Zeitung in der Provinz Guangdong war von lokalen Behörden bis zur Unkenntlichkeit zensiert und umgearbeitet worden. Garton Ash stellt jetzt das Original dem zensierten Artikel gegenüber (beide natürlich ins Englische übersetzt):
So schön konnte man der Zensur von außen noch nie zugucken! Timothy Garton Ash greift einen Zensurskandal in China auf: Der Neujahrsartikel der Southern Weekly, einer als liberal geltenden Zeitung in der Provinz Guangdong war von lokalen Behörden bis zur Unkenntlichkeit zensiert und umgearbeitet worden. Garton Ash stellt jetzt das Original dem zensierten Artikel gegenüber (beide natürlich ins Englische übersetzt):Hier ein Auszug aus dem Original: "Das chinesische Volk sollte frei sein. Der Traum der chinesischen Nation sollte der Traum von einer Verfassung sein. Nur unter einer verfassungsmäßigen Regierung kann unsere Nation und unser Volk stärker und wohlhabender werden. Nur unter einer verfassungsmäßigen Regierung können wir den Traum von einer Konstitutionalisierung erfüllen. Nur wenn wir den Traum von einer Verfassung verwirklicht haben, können wir davon sprechen, dass unsere Souveränität bewahrt und unsere Bürgerrechte und unsere Freiheit beschützt werden. Dann wird die Freiheit des Staates zur Freiheit der Menschen werden, die offen ihre Meinung sagen und mit ganzem Herzen träumen können."
Hier ein Auszug aus der auf Parteilinie getrimmten Version: "Träume sind eine Form des Selbstversprechens und müssen von Zeit zu Zeit überprüft werden. Wir haben ein spektakuläres Königreich geschaffen, das tausende von Jahren existierte. Aber der alte Traum erwachte 1840 plötzlich durch Gewehrfeuer aus dem Schlaf. Das führte dazu, dass wir unsere Fehler in der Vergangenheit erkannten. Wir öffneten unsere Augen um die Welt zu sehen, unsere Erfolge zu verkünden, die Intelligenz der Masse zu rühmen und unsere Moral zu erneuern. Unsere Reform und Restauration begann hier. Unsere Republik und die Revolution begannen hier. Unsere Schreie in der Bewegung 4. Mai begannen hier. Unsere Vorstellungen auf dem Boot in Nanhu (South Lake) unsere Proklamation auf dem Tiananmen Platz und unsere Hörner, die Reform und Öffnung verkündeten - alles begann hier."
Der derzeitige Aufstand gegen Politiker - gegen alle Politiker - in Bulgarien speist sich vor allem aus dem Zorn über die endlose und offenbar unausrottbare Korruption, erklärt Dimitar Bechev. Verständlich, aber was werden die Folgen sein? "In einer idealen Welt würde Bulgariens Frühling des Zorns die Staatsinstitutionen verantwortlicher machen, den endemischen Zynismus brechen, der das öffentliche Leben lähmt und der Politik erlauben, wenigstens einen kleinen Teil ihres emanzipatorischen Ideals zurückzugewinnen. Aber der Ausbruch kann genauso gut den letzten Rest der Legitimität zerstören, die das dysfunktionale demokratische Regime noch bei der Bevölkerung hat. Wenn das passiert, wird Bulgarien wahrhaftig einen besonderen Beitrag zur Dunkelheit geleistet haben, die über Europa hereinbricht.
Elet es Irodalom (Ungarn), 22.03.2013
 Anfang März hat der L'Harmattan Verlag den von Éva Maria Varga und Tamás Krausz herausgegebenen Band "Ungarische Besatzungstruppen in der Sowjetunion" veröffentlicht. Mit einer breiten Auswahl von Protokollen und Zeugenaussagen aus den Jahren 1943 bis 1945 liefert diese Arbeit zum ersten Mal Belege für eine Beteiligung der ungarischen Streitkräfte - teils im eigenen Zuständigkeitsbereich, teils zusammen mit der deutschen Wehrmacht - an zahlreichen Kriegsverbrechen und alltäglichem Völkermord in den besetzten sowjetischen Gebieten zwischen 1941 bis 1944. Eine Aufarbeitung dieser Periode der ungarischen Geschichte gab es weder während des Kalten Krieges noch in den darauffolgenden zwei Jahrzehnten. Eben deshalb konnte es auch keine moralische Regenerierung geben, meint Ákos Szilágyi in einer ausführlichen Besprechung des Buches: "Voraussetzung für eine moralische Erholung ist unverändert die Begegnung mit der Wahrheit, das Zerschlagen von politischen Kitschelementen der Nationalhistorie sowie die Übernahme der persönlichen und gemeinsamen Verantwortung für die verübten Taten. Darum kann die Bedeutung von Veröffentlichungen, welche diese Arbeit erleichtern, nicht hoch genug bewertet werden."
Anfang März hat der L'Harmattan Verlag den von Éva Maria Varga und Tamás Krausz herausgegebenen Band "Ungarische Besatzungstruppen in der Sowjetunion" veröffentlicht. Mit einer breiten Auswahl von Protokollen und Zeugenaussagen aus den Jahren 1943 bis 1945 liefert diese Arbeit zum ersten Mal Belege für eine Beteiligung der ungarischen Streitkräfte - teils im eigenen Zuständigkeitsbereich, teils zusammen mit der deutschen Wehrmacht - an zahlreichen Kriegsverbrechen und alltäglichem Völkermord in den besetzten sowjetischen Gebieten zwischen 1941 bis 1944. Eine Aufarbeitung dieser Periode der ungarischen Geschichte gab es weder während des Kalten Krieges noch in den darauffolgenden zwei Jahrzehnten. Eben deshalb konnte es auch keine moralische Regenerierung geben, meint Ákos Szilágyi in einer ausführlichen Besprechung des Buches: "Voraussetzung für eine moralische Erholung ist unverändert die Begegnung mit der Wahrheit, das Zerschlagen von politischen Kitschelementen der Nationalhistorie sowie die Übernahme der persönlichen und gemeinsamen Verantwortung für die verübten Taten. Darum kann die Bedeutung von Veröffentlichungen, welche diese Arbeit erleichtern, nicht hoch genug bewertet werden."Die scheinbar marginale, dennoch zunehmende Zahl der Obdachlosen, insbesondere die steigende Zahl von obdachlosen Roma, macht "die schwindende Kohäsion, Integrationsfähigkeit und Solidarität in der ungarischen Gesellschaft seit der Wende" deutlich, schreibt János Ladányi. War Obdachlosigkeit in den Wendejahren ein kaum - und wenn, dann eher in der Hauptstadt - existierendes Phänomen, so ist die Zahl der erfassten Obdachlosen im Jahre 2012 hier auf 30.000 gestiegen. Die Zahl der unregistrierten Obdachlosen ist wohl um ein vielfaches gestiegen. Lange herrschte die Auffassung, dass die verhältnismäßig niedrige Anzahl der obdachlosen Roma auf eine überdurchschnittlich starke Solidarität in den Roma-Gemeinden zurückzuführen ist. Diese erodierten jedoch in den vergangenen Jahren und wurden schrittweise durch stark hierarchisierte Ghettos ersetzt. Macht und Gewalt des Stärkeren stellen nun die Norm dar, Ausgrenzung und Ausbeutung der noch Ärmeren gilt mangels Alternativen als "Ordnung": "Mit polizeilichen Kampagnen ist diesem Phänomen genauso wenig zu begegnen, wie mit behördlicher Härte und Brutalität. Auch die 'kreative Gesetzgebung' auf Regierungs- oder kommunaler Ebene verfehlt die angenommene Lösbarkeit des Problems der Obdachlosigkeit", so Ladányi.
Slate.fr (Frankreich), 24.03.2013
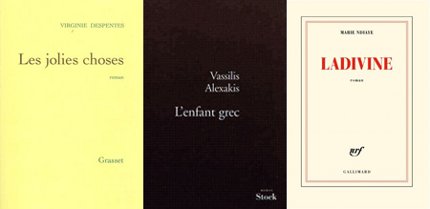
Nirgends sind die Buchcover nüchterner als in Frankreich, wo die Buchreihen viel wiedererkennbarer sind als die einzelnen Titel. Aber warum?, fragt Charlotte Pudlowski in einem längeren Essay für Slate.fr und findet heraus, dass es paradoxer Weise an einer "sehr frankreichtypischen Sakralisierung der Literatur liegt, die ins 18. und mehr noch 19. Jahrhundert zurückgeht. 'So lautet die These des berühmten Literaturwissenschaftlers Paul Bénichou', erklärt Antoin Compagnon, der selbst die 'Geburt des klassischen Schriftsteller' studiert hat. Bénichou erzählt in seinem Buch 'Le Sacre de l'écrivain, 1750-1830' die Geschichte der Emanzipation der Literatur von der Autorität der Religion, und wie sie sich sogar an deren Stelle setzt. Die Schriftsteller wurden die Helden und die Heiligen des 19. Jahrhunderts', so Compagnon. Und das sind sie geblieben."
Wired (USA), 19.03.2013
 Evan Hughes fasst in einem Überblicksartikel die ungewisse Lage von Buchverlegern im digitalen Wandel zusammen: So stehen auf der einen Seite die beeindruckendn Umsätze selbstverlegter E-Book-Millionäre, für die ein Verlagsdeal völlig uninteressant ist, und auf der anderen Seite die alteingesessenen Bestsellerautoren, für die Self-Publishing zunehmend attraktiver wird, um den etablierten Namen noch rentabler zu machen. Infrage gestellt wird dabei das bisherige Verlagsmodell, bei dem Megaseller ausreichende Erträge erzielen, um das übrige Programm - und insbesondere teure Flops - querzufinanzieren. So meint etwa Jason Epstein, lange Zeit Geschäftsführer von Random House: "'Täuscht' Euch bloß nicht - das ist reines Zocken!' Weshalb der Preisdruck auf E-Books Verleger auch das Fürchten lehrt: Wenn es sich bei ihnen tatsächlich um Zocker handelt, die am Spielautomaten ihre Einsätze riskieren und auf einen Trumpf angewiesen sind, um ihre Verluste auszugleichen, dann stellt Amazon ein Kasino dar, das immer kleinere Auszahlungen in Aussicht stellt. Abseits solcher unmittelbaren Bauchschmerzen über die Preisentwicklung sorgen sich die Verleger auch darüber, dass mit dem Verschwinden des echten Buchladens auch das gesamte Business gefährdet sein könnte - ironischerweise sogar Amazon. Analysen haben gezeigt, dass Leser nicht dazu neigen, Online-Buchläden dafür nutzen, um Entdeckungen zu machen. Sie nutzen sie, um Bücher zu kaufen, auf die sie andernorts gestoßen sind - häufig in echten Buchläden. .... Ohne Läden zum Stöbern, könnten die Verkaufszahlen überall einknicken, fürchten die Verleger."
Evan Hughes fasst in einem Überblicksartikel die ungewisse Lage von Buchverlegern im digitalen Wandel zusammen: So stehen auf der einen Seite die beeindruckendn Umsätze selbstverlegter E-Book-Millionäre, für die ein Verlagsdeal völlig uninteressant ist, und auf der anderen Seite die alteingesessenen Bestsellerautoren, für die Self-Publishing zunehmend attraktiver wird, um den etablierten Namen noch rentabler zu machen. Infrage gestellt wird dabei das bisherige Verlagsmodell, bei dem Megaseller ausreichende Erträge erzielen, um das übrige Programm - und insbesondere teure Flops - querzufinanzieren. So meint etwa Jason Epstein, lange Zeit Geschäftsführer von Random House: "'Täuscht' Euch bloß nicht - das ist reines Zocken!' Weshalb der Preisdruck auf E-Books Verleger auch das Fürchten lehrt: Wenn es sich bei ihnen tatsächlich um Zocker handelt, die am Spielautomaten ihre Einsätze riskieren und auf einen Trumpf angewiesen sind, um ihre Verluste auszugleichen, dann stellt Amazon ein Kasino dar, das immer kleinere Auszahlungen in Aussicht stellt. Abseits solcher unmittelbaren Bauchschmerzen über die Preisentwicklung sorgen sich die Verleger auch darüber, dass mit dem Verschwinden des echten Buchladens auch das gesamte Business gefährdet sein könnte - ironischerweise sogar Amazon. Analysen haben gezeigt, dass Leser nicht dazu neigen, Online-Buchläden dafür nutzen, um Entdeckungen zu machen. Sie nutzen sie, um Bücher zu kaufen, auf die sie andernorts gestoßen sind - häufig in echten Buchläden. .... Ohne Läden zum Stöbern, könnten die Verkaufszahlen überall einknicken, fürchten die Verleger." Auch Fernsehserien sind im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung nicht mehr das, was sie einmal waren, erfahren wir von Willa Paskin, die in der mittlerweile selbst produzierenden Streaming-Videothek Netflix nach dem "House of Cards"-Coup und mit vielen weiteren, kommenden Serien (darunter auch die langersehnte Fortsetzung von "Arrested Development") schon so etwas wie das neue HBO sieht. Dabei arbeitet Netflix nicht nur mit Sehvorlieben und Sehgewohnheiten, in die sie über Kundenmonitoring Einblick haben, sondern auch mit den neuen Möglichkeiten eines nicht-linearen Programms: "Das neue 'Arrested Development' ist nicht nur ein siebenstündiger Film. Es ist etwas neues - eine Sammlung von auf einen Schlag veröffentlichter Episoden, die sich remixen und neu kombinieren lassen und durch solche neuen Zusammensetzungen stets dazugewinnen. In diesem Moment bietet allein Netflix diesen Rahmen. Auf die Frage, wie die Show sich wohl entwickelt hätte, wenn der traditonelle Fernsehsender Showtime den Zuschlag erhalten hätte, sagt Produzent Hurwitz: 'Was das Storytelling betrifft, hätten sich wohl nicht ganz so durchgeknallte Ideen durchgesetzt.'" Einen Nachteil bezeichnet Paskin allerdings auch: Da alle Netflix-Produktionen zur besseren Vermarktung auf einer genauen Vorliebenanalyse basieren, "klingen sie alle sonderbar vertraut, so aufpoliert sie auch sein mögen."
Außerdem: Ed Yong blickt in die heilbringende Zukunft der Schwarmwissenschaft. Brian Raftery porträtiert den Filmemacher Shane Carruth, der sich nach dem überraschenden Erfolg seines Debütfilms "Primer" neun Jahre Zeit ließ für seinen zweiten Film "Upstream Color" (von dem unsere Kritikerin Elena Meilicke allerdings nicht völlig begeistert war). Ted Greenwald unterhält sich mit Wikipedia-Grüner Jimmy Wales, der nochmals nachdrücklich unterstreicht, dass sich Wikipedia - anders als Google - keiner Staatszensur beugen wird. Kyle Wiens plädiert für einen uneingeschränkten Zugang zum eigenen Mobiltelefon.
HVG (Ungarn), 13.03.2013
 "Warum brauchen wir Studiengebühren", fragt Gábor Bojár und liefert mögliche Antworten gleich mit: Die meisten Studierenden würden Studiengebühren nicht nur akzeptieren, sie würden diese sogar unterstützen, glaubt Bojár, wenn ein Stipendiatensystem hinzukäme, das die Studienleistungen mitberücksichtigt. Studiengebühren sind nach seinen Ausführungen wichtig, damit "Bildung" einen messbaren Marktwert erhält, was wiederum nur Sinn mache, wenn es "Kunden" gibt, die diesen Marktwert auch zu entrichten bereit sind. Dies könnte die internationale Wettbewerbsfähigkeit der ungarischen Universitäten steigern, wenn diese Institutionen nur bereit wären, sich diesem Wettbewerb zu stellen: "Denn die ungarische Hochschulbildung kann sich mit den besten ausländischen Institutionen messen (wie zahlreiche Beispiele belegen), hierzu brauchen die hervorragenden heimischen Universitäten objektive Bemessungsgrundlagen und die Möglichkeit, die Früchte des Wettbewerbs auch selbst ernten zu können."
"Warum brauchen wir Studiengebühren", fragt Gábor Bojár und liefert mögliche Antworten gleich mit: Die meisten Studierenden würden Studiengebühren nicht nur akzeptieren, sie würden diese sogar unterstützen, glaubt Bojár, wenn ein Stipendiatensystem hinzukäme, das die Studienleistungen mitberücksichtigt. Studiengebühren sind nach seinen Ausführungen wichtig, damit "Bildung" einen messbaren Marktwert erhält, was wiederum nur Sinn mache, wenn es "Kunden" gibt, die diesen Marktwert auch zu entrichten bereit sind. Dies könnte die internationale Wettbewerbsfähigkeit der ungarischen Universitäten steigern, wenn diese Institutionen nur bereit wären, sich diesem Wettbewerb zu stellen: "Denn die ungarische Hochschulbildung kann sich mit den besten ausländischen Institutionen messen (wie zahlreiche Beispiele belegen), hierzu brauchen die hervorragenden heimischen Universitäten objektive Bemessungsgrundlagen und die Möglichkeit, die Früchte des Wettbewerbs auch selbst ernten zu können."Guernica (USA), 15.03.2013
 Der Anglistik-Professor Amitava Kumar spricht im Interview mit Teju Cole über dessen Buch "Open City", flämische Malerei des 16. Jahrhunderts, die Essay- und die Tweetform. Zwar kann ein Tweet einen Essay nie ersetzen, aber warum soll er nicht als gleichberechtigte Form neben ihm stehen? "Das Medium gibt uns die Chance, am Heute teilzuhaben. Aber Twitter ist weder hier noch dort. Im 18. Jahrhundert gabe es Pamphlete, Montaigne schrieb Essays und Homer Epen. Aber wir sehen ganz richtig, dass sie an der selben Konversation teilnahmen. Darum liebe ich Dinge wie Twitter - es gibt mir die Gelegenheit mit Menschen zu sprechen, mit denen ich wirklich sprechen will."
Der Anglistik-Professor Amitava Kumar spricht im Interview mit Teju Cole über dessen Buch "Open City", flämische Malerei des 16. Jahrhunderts, die Essay- und die Tweetform. Zwar kann ein Tweet einen Essay nie ersetzen, aber warum soll er nicht als gleichberechtigte Form neben ihm stehen? "Das Medium gibt uns die Chance, am Heute teilzuhaben. Aber Twitter ist weder hier noch dort. Im 18. Jahrhundert gabe es Pamphlete, Montaigne schrieb Essays und Homer Epen. Aber wir sehen ganz richtig, dass sie an der selben Konversation teilnahmen. Darum liebe ich Dinge wie Twitter - es gibt mir die Gelegenheit mit Menschen zu sprechen, mit denen ich wirklich sprechen will."Außerdem stellt Kumar stellt die Bilder eines Fotoprojekts von Cole vor. Man sieht immer zwei Bilder von Cole aus verschiedenen Städten und liest einen kurzen Text von Kumar dazu. Weiter gibt es ein Interview mit dem Autor Aleksandar Hemon über Literatur und das echte Leben in Amerika und Bosnien. und es stehen einige Briefe online aus dem Band 'Airmail: The Letters of Robert Bly and Tomas Tranströmer'.
El Malpensante (Kolumbien), 25.03.2013
 Santiago O'Donnell hinterfragt die Todesumstände von Hugo Chávez und kommt zu dem Schluss, dass sein Tod kurz nach der Wiederwahl voraussehbar gewesen sein musste. Er findet es unverantwortlich, dass das Volk in systematischer Unwissenheit über die Krankheit des Präsidenten gehalten wurde: "Ich bin kein Experte, aber ich finde, dass eine Person die mindestens vier Mal innerhalb von 1 1/2 Jahren wegen Krebs operiert worden ist, einen sich rasend ausbreitenden Krebstyp haben muss und nicht in der Lage ist zu regieren. Schon in der Wahlkampagne im November sah man Chávez mit einem vor Cortison aufgedunsenen Gesicht und er selbst gab zu, dass er starke Beruhigungsmittel nehmen musste, um die Schmerzen zu kontrollieren. Danach war er drei Monate auf Kuba, praktisch ohne ein Lebenszeichen von sich zu geben ... Außer in Nordkorea, Iran, Cuba oder dergleichen Länder, ist es üblich, wenn eine wichtige Person erkrankt, ganz zu schweigen vom Präsidenten, dass die zuständigen Ärzte regelmäßig über den Gesundheitszustand des Pazienten informieren."
Santiago O'Donnell hinterfragt die Todesumstände von Hugo Chávez und kommt zu dem Schluss, dass sein Tod kurz nach der Wiederwahl voraussehbar gewesen sein musste. Er findet es unverantwortlich, dass das Volk in systematischer Unwissenheit über die Krankheit des Präsidenten gehalten wurde: "Ich bin kein Experte, aber ich finde, dass eine Person die mindestens vier Mal innerhalb von 1 1/2 Jahren wegen Krebs operiert worden ist, einen sich rasend ausbreitenden Krebstyp haben muss und nicht in der Lage ist zu regieren. Schon in der Wahlkampagne im November sah man Chávez mit einem vor Cortison aufgedunsenen Gesicht und er selbst gab zu, dass er starke Beruhigungsmittel nehmen musste, um die Schmerzen zu kontrollieren. Danach war er drei Monate auf Kuba, praktisch ohne ein Lebenszeichen von sich zu geben ... Außer in Nordkorea, Iran, Cuba oder dergleichen Länder, ist es üblich, wenn eine wichtige Person erkrankt, ganz zu schweigen vom Präsidenten, dass die zuständigen Ärzte regelmäßig über den Gesundheitszustand des Pazienten informieren."New York Times (USA), 26.03.2013
 Im Magazine porträtiert Chip Brown den Met-Chef Howard Gelb, der die fast unmögliche Aufgabe hat, ein konservatives Stammpublikum davon zu überzeugen, dass Oper im 21. Jahrhundert nicht mehr aussehen kann wie im 18.. Dabei helfen ihm sein offenbar ausgezeichnetes Organisationstalent und die Fähigkeit, extremen Druck auszuhalten zu können. Eine Episode, die mit nichts mit der Met zu tun hat, verdeutlicht das: "'Niemand weiß, was ein Produzent tut', sagt er, und erinnert sich an die Zeit, als er Horowitz' Rückkehr nach Russland 1986 organisierte. Horowitz, der gern jeden Tag dasselbe aß, wäre nicht nach Russland zurückgekehrt, hätte Gelb ihm nicht garantiert, dass er jeden Abend seine frische Seezunge aus Dover bekommt. Versprechen war leicht, den Fisch zu finden fast unmöglich. Gelb nahm die Hilfe des amerikanischen Botschafters in Anspruch, der mit dem britischen Botschafter sprach, der dafür sorgte, dass die Seezunge aus London eingeflogen wurde. Amerikanische Botschaftsangehörige, mit T-Shirts auf denen 'Luftbrücke Dover Seezunge' stand, holten sie vom Moskauer Flughafen ab. Der italienische Botschafter lieferte den frischen Spargel für Horowitz. Ein Aufgebot von Marines war abgeordnet, den Horowitz' Steinway zu bewachen. Kurz bevor Horowitz starb, rief er Gelb an und sagte ihm, er gehöre jetzt zur Familie und müsse ihn nicht mehr 'Mr. Horowitz' nennen. Er dürfe 'Maestro' sagen."
Im Magazine porträtiert Chip Brown den Met-Chef Howard Gelb, der die fast unmögliche Aufgabe hat, ein konservatives Stammpublikum davon zu überzeugen, dass Oper im 21. Jahrhundert nicht mehr aussehen kann wie im 18.. Dabei helfen ihm sein offenbar ausgezeichnetes Organisationstalent und die Fähigkeit, extremen Druck auszuhalten zu können. Eine Episode, die mit nichts mit der Met zu tun hat, verdeutlicht das: "'Niemand weiß, was ein Produzent tut', sagt er, und erinnert sich an die Zeit, als er Horowitz' Rückkehr nach Russland 1986 organisierte. Horowitz, der gern jeden Tag dasselbe aß, wäre nicht nach Russland zurückgekehrt, hätte Gelb ihm nicht garantiert, dass er jeden Abend seine frische Seezunge aus Dover bekommt. Versprechen war leicht, den Fisch zu finden fast unmöglich. Gelb nahm die Hilfe des amerikanischen Botschafters in Anspruch, der mit dem britischen Botschafter sprach, der dafür sorgte, dass die Seezunge aus London eingeflogen wurde. Amerikanische Botschaftsangehörige, mit T-Shirts auf denen 'Luftbrücke Dover Seezunge' stand, holten sie vom Moskauer Flughafen ab. Der italienische Botschafter lieferte den frischen Spargel für Horowitz. Ein Aufgebot von Marines war abgeordnet, den Horowitz' Steinway zu bewachen. Kurz bevor Horowitz starb, rief er Gelb an und sagte ihm, er gehöre jetzt zur Familie und müsse ihn nicht mehr 'Mr. Horowitz' nennen. Er dürfe 'Maestro' sagen."
Le Monde | Elet es Irodalom | Slate.fr | Wired | HVG | Guernica | El Malpensante | New York Times | Espresso | Guardian | Magyar Narancs | The Atlantic | La vie des idees | Fast Company | Eurozine
Kommentieren








