Magazinrundschau
Kobolde des Zweifels
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
18.09.2012. In Wired singt der Science-Fiction-Autor William Gibson ein Loblied aufs Internet. Der Merkur seziert die zertifizierte Brillanz des Experten. Vanity Fair darf mit Barack Obama auf den besten Ort des Weißen Hauses. Die polnische Jugend ist tiptop, versichert Polityka, man sehe nur den wohlinformierten Protest gegen Acta. In Newsweek erklärt Ayaan Hirsi Ali, was für Ost und West die größte Blasphemie ist: die Emanzipation der Mädchen. Film Comment porträtiert den österreichischen Regisseur Peter Kubelka. Moisés Naím hofft in Letras Libres, dass Venezuela einmal so demokratisch wird wie Chile.
Wired | Film Comment | Believer | Grantland | Letras Libres | Village Voice | Elet es Irodalom | HVG | Guardian | Merkur | La regle du jeu | New York Magazine | Vanity Fair | Polityka | Newsweek | Open Democracy | Magyar Narancs | The Nation | Outlook India
Wired (USA), 13.09.2012
 Geeta Dayal hat sich mit Science-Fiction-Autor William Gibson (@) so ausführlich unterhalten, dass das Gespräch in drei Lieferung erfolgt (hier Teil 2, hier Teil 3). Neben Gibsons Wurzeln im Punk, Herausforderungen der literarischen Futurologie und Gibsons Ansichten zu den sozialen Medien (in nuce: Twitter schlägt Facebook) dreht sich das Gespräch auch um das Internet als Wissensquelle. Anlass ist seine frühere, mittlerweile nicht mehr weiterverfolgte Begeisterung für mechanische Uhren (hier Gibsons Essay von 1999 dazu): "Ich wollte völlig ohne Anlass einfach wirklich viel über eine Sache wissen. ... Es war ein großer Spaß - ich habe damals einige ganz außergewöhnlich sonderbare Leute kennengelernt. Keine dieser Erfahrungen wäre möglich gewesen ohne das Internet. Früher musste man, wollte man auf wirklich wahnsinnige Weise etwas über eine Sache wie diese wissen, selber grundsätzlich wahnsinnig sein - du musstest die Welt bereisen, andere Leute finden, die hinreichend verrückt waren, um alles zu wissen, was es darüber zu wissen gab. Das war schwer zu bewerkstelligen, und zum Großteil reine Glückssache, weil die Anzahl solcher Leute von vornherein niedrig war. Doch heute kann man ein Jugendlicher in einer Stadt im brasilianischen Hinterland sein, der eines Morgens aufwacht und sich denkt: 'Ich möchte alles über rostfreie Sportuhren aus Stahl aus den 50er Jahren wissen.'' Und wenn man sich dann wirklich hinsetzt, im Internet, könnte man sich im Laufe eines Jahres ein Wissen aneignen, das einem Universitätsabschluss in diesem kleinen, sinnlosen Feld entspricht. Ich habe definitiv viele Leute getroffen, die sich ein Äquivalent dieses akademischen Grads angeeignet haben."
Geeta Dayal hat sich mit Science-Fiction-Autor William Gibson (@) so ausführlich unterhalten, dass das Gespräch in drei Lieferung erfolgt (hier Teil 2, hier Teil 3). Neben Gibsons Wurzeln im Punk, Herausforderungen der literarischen Futurologie und Gibsons Ansichten zu den sozialen Medien (in nuce: Twitter schlägt Facebook) dreht sich das Gespräch auch um das Internet als Wissensquelle. Anlass ist seine frühere, mittlerweile nicht mehr weiterverfolgte Begeisterung für mechanische Uhren (hier Gibsons Essay von 1999 dazu): "Ich wollte völlig ohne Anlass einfach wirklich viel über eine Sache wissen. ... Es war ein großer Spaß - ich habe damals einige ganz außergewöhnlich sonderbare Leute kennengelernt. Keine dieser Erfahrungen wäre möglich gewesen ohne das Internet. Früher musste man, wollte man auf wirklich wahnsinnige Weise etwas über eine Sache wie diese wissen, selber grundsätzlich wahnsinnig sein - du musstest die Welt bereisen, andere Leute finden, die hinreichend verrückt waren, um alles zu wissen, was es darüber zu wissen gab. Das war schwer zu bewerkstelligen, und zum Großteil reine Glückssache, weil die Anzahl solcher Leute von vornherein niedrig war. Doch heute kann man ein Jugendlicher in einer Stadt im brasilianischen Hinterland sein, der eines Morgens aufwacht und sich denkt: 'Ich möchte alles über rostfreie Sportuhren aus Stahl aus den 50er Jahren wissen.'' Und wenn man sich dann wirklich hinsetzt, im Internet, könnte man sich im Laufe eines Jahres ein Wissen aneignen, das einem Universitätsabschluss in diesem kleinen, sinnlosen Feld entspricht. Ich habe definitiv viele Leute getroffen, die sich ein Äquivalent dieses akademischen Grads angeeignet haben."Merkur (Deutschland), 17.09.2012
 Das Doppelheft des Merkurs widmet sich dem allseits herangezogenen Experten. In der Finanzwirtschaft, erklärt der Ökonom Michael Streeck, ist ein Experte jemand, der in keiner Notregierung mehr fehlen darf - und im Dienst von Goldmann Sachs steht: Larry Summers, Robert Rubin und Hank Paulsen in den USA, in Europa Lucas Papademos, Mario Draghi und Mario Monti: "Die Böcke als Gärtner und die Brandstifter als Biedermänner? Ist das, was sie angerichtet haben, tatsächlich derart, dass nur sie es wieder entwirren können? Oder ist, was als Rettung deklariert wird, in Wirklichkeit eine Schlüsselübergabe an übermächtig gewordene Belagerer, verbunden mit ergebenen Bitten um milde Behandlung? Es trifft zu, dass die meisten nicht durchschauen, was die 'Super-Marios' treiben - ob sie uns 'retten' wollen oder die, denen sie nahestehen, und ob sie tatsächlich dem Abschöpfen abgeschworen und sich dem Wertschöpfen zugewandt haben. Da es um Geld geht - um Kredite, Zentralbanken, Leistungsbilanzen usw. -, lässt sich die Sache nur allzu leicht durch Verwissenschaftlichung mystifizieren: viel zu kompliziert für Otto Normalverbraucher, mit seiner drei minus in Mathe. So viel von Harvard, Columbia e tutti quanti zertifizierte Brillanz kann nur bewirken, dass man sich geradezu lächerlich vorkäme, wenn man gegen sie auf dem eigenen gesunden Menschenverstand bestünde."
Das Doppelheft des Merkurs widmet sich dem allseits herangezogenen Experten. In der Finanzwirtschaft, erklärt der Ökonom Michael Streeck, ist ein Experte jemand, der in keiner Notregierung mehr fehlen darf - und im Dienst von Goldmann Sachs steht: Larry Summers, Robert Rubin und Hank Paulsen in den USA, in Europa Lucas Papademos, Mario Draghi und Mario Monti: "Die Böcke als Gärtner und die Brandstifter als Biedermänner? Ist das, was sie angerichtet haben, tatsächlich derart, dass nur sie es wieder entwirren können? Oder ist, was als Rettung deklariert wird, in Wirklichkeit eine Schlüsselübergabe an übermächtig gewordene Belagerer, verbunden mit ergebenen Bitten um milde Behandlung? Es trifft zu, dass die meisten nicht durchschauen, was die 'Super-Marios' treiben - ob sie uns 'retten' wollen oder die, denen sie nahestehen, und ob sie tatsächlich dem Abschöpfen abgeschworen und sich dem Wertschöpfen zugewandt haben. Da es um Geld geht - um Kredite, Zentralbanken, Leistungsbilanzen usw. -, lässt sich die Sache nur allzu leicht durch Verwissenschaftlichung mystifizieren: viel zu kompliziert für Otto Normalverbraucher, mit seiner drei minus in Mathe. So viel von Harvard, Columbia e tutti quanti zertifizierte Brillanz kann nur bewirken, dass man sich geradezu lächerlich vorkäme, wenn man gegen sie auf dem eigenen gesunden Menschenverstand bestünde." Ekkehard Knörer denkt sehr grundsätzlich darüber nach, wie sich mit dem Medienwandel auch die Position des Kritikers verändert. Eine Demokratisierung der Kritik droht seiner Ansicht aber ebenso wenig wie ein allgemeiner Niveauverlust: "Allerdings multipliziert und fragmentiert sich die Öffentlichkeit endgültig zu Öffentlichkeiten, der Kanonkonsens zu Wertegemeinschaften mit untereinander nicht vereinbaren Urteilskoordinaten. Die Tätigkeit der Kritik wird dabei nun klarer erkennbar als das, was sie stets war: ein Sprachspiel, in dem einzelne in Expertenfunktion Urteile fällen, die klingen, als gälten sie für die Allgemeinheit."
Weiteres: Christian Demand erkennt in der Architekturkritik eine Tendenz zur "bürgerlichen Bausündenschelte" und plädiert für eine ästhetische Erziehung, die lehrt, "die Welt auch dort auszuhalten, wo sie sich den eigenen ästhetischen Präferenzen gerade nicht fügen will". Rudolf Burger befasst sich mit der Futurologie der siebziger Jahre.
Vanity Fair (USA), 01.10.2012
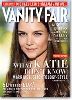 Ein halbes Jahr durfte sich Michel Lewis im Weißen Haus aufhalten, mit Barack Obama Basketball spielen und in der Air Force One fliegen. Doch auch wenn er dem Präsidenten nie richtig nahe gekommen zu sein scheint, erweckt er doch den Eindruck, als würde sich Obama in Washington nicht wirklich wohl fühlen: "Wir bogen nach rechts, in einen ovalen, gelb gestrichenen Raum, offensichtlich der Yellow Room. Obama marschierte zu den französischen Fenstern am hinteren Ende. Dort öffnete er einige Riegel und trat nach draußen: 'Das ist der beste Ort des Weißen Hauses', sagte er. Ich folgte ihm raus auf den Truman Balkon und zu diesem unverfälschten Blick auf den Südgarten. Das Washington Monument stand wie ein Soldat vor dem Jefferson Memorial. Christsterne in Blumentöpfe umgaben diesen Ort, der eine Art nach außen verlagertes Wohnzimmer ergab. 'Der beste Platz im Weißen Haus', sagte er noch einmal. 'Michelle und ich kommen oft abends her, nur um dazusitzen. Näher kommt man dem Gefühl nicht, draußen zu sein. Außerhalb der großen Blase."
Ein halbes Jahr durfte sich Michel Lewis im Weißen Haus aufhalten, mit Barack Obama Basketball spielen und in der Air Force One fliegen. Doch auch wenn er dem Präsidenten nie richtig nahe gekommen zu sein scheint, erweckt er doch den Eindruck, als würde sich Obama in Washington nicht wirklich wohl fühlen: "Wir bogen nach rechts, in einen ovalen, gelb gestrichenen Raum, offensichtlich der Yellow Room. Obama marschierte zu den französischen Fenstern am hinteren Ende. Dort öffnete er einige Riegel und trat nach draußen: 'Das ist der beste Ort des Weißen Hauses', sagte er. Ich folgte ihm raus auf den Truman Balkon und zu diesem unverfälschten Blick auf den Südgarten. Das Washington Monument stand wie ein Soldat vor dem Jefferson Memorial. Christsterne in Blumentöpfe umgaben diesen Ort, der eine Art nach außen verlagertes Wohnzimmer ergab. 'Der beste Platz im Weißen Haus', sagte er noch einmal. 'Michelle und ich kommen oft abends her, nur um dazusitzen. Näher kommt man dem Gefühl nicht, draußen zu sein. Außerhalb der großen Blase."Polityka (Polen), 14.09.2012
 Edwin Bendyk unterhält sich mit der Soziologin Krystyna Szafraniec über die polnische Jugend, die ihren Untersuchungen zufolge zwar total auf Konsum, Spaß und individuelles Glück ausgerichtet sei, aber offenbar totzdem ganz in Ordnung. Besonders beeindruckt ist Szafraniec von den Protesten gegen ACTA: "Am meisten haben mich die Reife, die Rationalität und die Wirksamkeit der Protestierenden fasziniert. Eine Analyse von Diskussionen im Internet zeigt, dass der Widerstand des Netzes, wie Sie ihn in Ihrem Buch genannt haben, die Sorge um die Zukunft und das öffentliche Interesse ausgedrückt hat, die die Politiker, die in den Strukturen einer anderen Epoche stecken, nicht richtig definieren konnten. Die jungen Menschen haben gezeigt, dass sie verstehen, worin die moderne Welt besteht, worum der Kampf im Rahmen des globalen Kapitalismus geführt wird, und sie haben in diesem Kampf ihren souveränen Standpunkt ausgedrückt."
Edwin Bendyk unterhält sich mit der Soziologin Krystyna Szafraniec über die polnische Jugend, die ihren Untersuchungen zufolge zwar total auf Konsum, Spaß und individuelles Glück ausgerichtet sei, aber offenbar totzdem ganz in Ordnung. Besonders beeindruckt ist Szafraniec von den Protesten gegen ACTA: "Am meisten haben mich die Reife, die Rationalität und die Wirksamkeit der Protestierenden fasziniert. Eine Analyse von Diskussionen im Internet zeigt, dass der Widerstand des Netzes, wie Sie ihn in Ihrem Buch genannt haben, die Sorge um die Zukunft und das öffentliche Interesse ausgedrückt hat, die die Politiker, die in den Strukturen einer anderen Epoche stecken, nicht richtig definieren konnten. Die jungen Menschen haben gezeigt, dass sie verstehen, worin die moderne Welt besteht, worum der Kampf im Rahmen des globalen Kapitalismus geführt wird, und sie haben in diesem Kampf ihren souveränen Standpunkt ausgedrückt."Newsweek (USA), 17.09.2012
 Ayaan Hirsi Ali denkt in einem größeren Newsweek-Essay über die jüngsten Aufstände in der arabischen Welt, aber auch über Salman Rushdies Erinnerungen und ihren eigenen Abfall vom Glauben nach. Er brachte ihr paradoxerweise Schwierigkeiten bei den Muslimen und in der Gastgesellschaft ein: "Auf die Frage nach der schlechten Integration muslimischer Immigranten in die holländische Bürgergesellschaft empfahl ich die Emanzipation der Mädchen von einer Praxis, die Eltern dazu bringt, ihre Kinder als Teenager von der Schule zu nehmen und zu verheiraten. Durch Emanzipation würde die muslimische Integration schneller und dauerhafter erreicht. Aber ich musste schnell lernen, dass ich durch solche Äußerungen dreifach blasphemisch gesprochen hatte: weil ich terroristische Attacken auf die Theologie zurückgeführt hatte, durch die sie inspiriert waren; weil ich die kritische Aufmerksamkeit auf die Lage der Frauen im Islam zog; und - die schlimmste Blasphemie von allen - weil ich den muslimischen Glauben aufgegeben hatte."
Ayaan Hirsi Ali denkt in einem größeren Newsweek-Essay über die jüngsten Aufstände in der arabischen Welt, aber auch über Salman Rushdies Erinnerungen und ihren eigenen Abfall vom Glauben nach. Er brachte ihr paradoxerweise Schwierigkeiten bei den Muslimen und in der Gastgesellschaft ein: "Auf die Frage nach der schlechten Integration muslimischer Immigranten in die holländische Bürgergesellschaft empfahl ich die Emanzipation der Mädchen von einer Praxis, die Eltern dazu bringt, ihre Kinder als Teenager von der Schule zu nehmen und zu verheiraten. Durch Emanzipation würde die muslimische Integration schneller und dauerhafter erreicht. Aber ich musste schnell lernen, dass ich durch solche Äußerungen dreifach blasphemisch gesprochen hatte: weil ich terroristische Attacken auf die Theologie zurückgeführt hatte, durch die sie inspiriert waren; weil ich die kritische Aufmerksamkeit auf die Lage der Frauen im Islam zog; und - die schlimmste Blasphemie von allen - weil ich den muslimischen Glauben aufgegeben hatte."Open Democracy (UK), 18.09.2012
 Anders als etwa in Ägypten oder im Sudan hat sich in Libyen auch Protest gegen die gewaltsamen Ausschreitungen formiert, berichtet Rhiannon Smith: "Als die Neuigkeit bekannt wurde [dass der amerikanische Botschafter Christopher Stevens und drei seiner Mitarbeiter getötet worden waren], gab es eine Demonstration von Trauer und Frustration. Die sozialen Medien wurden überflutet mit Entschuldigungen, Beileidsbekundungen und Aufrufen zu Widerstand. Libyen will der Welt zeigen, dass es diese Attacken und den tragischen Verlust von Leben verurteilt. Viele fühlen sich von dem anti-Islam-Film beleidigt, aber sie wollten auch unbedingt klarstellen, dass dies keine Rechtfertigung ist für das, was darauf geschah. In Tripolis und Benghazi gingen am Mittwoch Menschen auf die Straße und hielten Transparente hoch mit Botschaften wie 'Chris Stevens war ein Freund aller Libyer' und 'Entschuldigt, Menschen aus Amerika. Dies ist nicht das Benehmen des Islam oder unseres Propheten.'"
Anders als etwa in Ägypten oder im Sudan hat sich in Libyen auch Protest gegen die gewaltsamen Ausschreitungen formiert, berichtet Rhiannon Smith: "Als die Neuigkeit bekannt wurde [dass der amerikanische Botschafter Christopher Stevens und drei seiner Mitarbeiter getötet worden waren], gab es eine Demonstration von Trauer und Frustration. Die sozialen Medien wurden überflutet mit Entschuldigungen, Beileidsbekundungen und Aufrufen zu Widerstand. Libyen will der Welt zeigen, dass es diese Attacken und den tragischen Verlust von Leben verurteilt. Viele fühlen sich von dem anti-Islam-Film beleidigt, aber sie wollten auch unbedingt klarstellen, dass dies keine Rechtfertigung ist für das, was darauf geschah. In Tripolis und Benghazi gingen am Mittwoch Menschen auf die Straße und hielten Transparente hoch mit Botschaften wie 'Chris Stevens war ein Freund aller Libyer' und 'Entschuldigt, Menschen aus Amerika. Dies ist nicht das Benehmen des Islam oder unseres Propheten.'"Magyar Narancs (Ungarn), 23.08.2012
 Die Theatersaison hat noch gar nicht begonnen, schon gibt es einen Theaterskandal. Das in ein Nazi-Theater umgewandelte Budapester Új Színház hat das letzte Theaterstück seines im Februar verstorbenen Intendanten István Csurka, "Der sechste Sarg" auf den Spielplan gesetzt (mehr dazu hier und hier). Aber gar nicht dieser Umstand bewegt so sehr die Gemüter, sondern vielmehr die Reaktion des Dirigenten Ádám Fischer, der angekündigt hat, an allen Foren im In- und Ausland gegen die Aufführung des Stücks zu protestieren. Der Budapester Oberbürgermeister István Tarlós, der die Gründung des Theaters im vergangenen Herbst genehmigt hatte, reagierte darauf mit einer Bemerkung, dass die Philosophie Richard Wagners, dessen Stücke auch Fischer dirigiert hatte, ebenfalls nicht ganz lupenrein sei. Diese und manch andere Äußerungen, das Theaterstück sei ganz und gar nicht antisemitisch, lässt der liberalen Wochenzeitung Magyar Narancs den Kragen platzen: "'Der sechste Sarg' ist vom ersten bis zum letzten Wort judenfeindlich und damit in der Tat ein großes synthetisierendes Werk, der Gipfel des Lebenswerks von István Csurka. Alles ist darin enthalten, was der Autor wusste und es zeigt auch, was für ein Dramatiker er war. Nun, er ist ein kleiner Dramatiker gewesen, und ein noch kleinerer Geist, der später, verrückt geworden, seinen Alltag nur noch dem krankhaften Antisemitismus widmete, dessen treuer Abdruck dieses Werk nun ist. Dieser Kot wird uns bald im Zentrum der Hauptstadt in den Nacken geschüttet, skrupellos und ungehindert. Was kann man dazu noch sagen? Vielleicht nur soviel, dass Herr István Tarlós, der einen geistigen Verfall aufweisende Oberbürgermeister, dessen historische Schuld es ist, in der Hauptstadt Ungarns ein Nazi-Theater eröffnet zu haben, sich endlich zum Teufel schert und keine Predigten über Wagner hält, sondern in weite Ferne zieht und jeden Tag damit beginnt, sein Volk tausendmal um Verzeihung zu bitten."
Die Theatersaison hat noch gar nicht begonnen, schon gibt es einen Theaterskandal. Das in ein Nazi-Theater umgewandelte Budapester Új Színház hat das letzte Theaterstück seines im Februar verstorbenen Intendanten István Csurka, "Der sechste Sarg" auf den Spielplan gesetzt (mehr dazu hier und hier). Aber gar nicht dieser Umstand bewegt so sehr die Gemüter, sondern vielmehr die Reaktion des Dirigenten Ádám Fischer, der angekündigt hat, an allen Foren im In- und Ausland gegen die Aufführung des Stücks zu protestieren. Der Budapester Oberbürgermeister István Tarlós, der die Gründung des Theaters im vergangenen Herbst genehmigt hatte, reagierte darauf mit einer Bemerkung, dass die Philosophie Richard Wagners, dessen Stücke auch Fischer dirigiert hatte, ebenfalls nicht ganz lupenrein sei. Diese und manch andere Äußerungen, das Theaterstück sei ganz und gar nicht antisemitisch, lässt der liberalen Wochenzeitung Magyar Narancs den Kragen platzen: "'Der sechste Sarg' ist vom ersten bis zum letzten Wort judenfeindlich und damit in der Tat ein großes synthetisierendes Werk, der Gipfel des Lebenswerks von István Csurka. Alles ist darin enthalten, was der Autor wusste und es zeigt auch, was für ein Dramatiker er war. Nun, er ist ein kleiner Dramatiker gewesen, und ein noch kleinerer Geist, der später, verrückt geworden, seinen Alltag nur noch dem krankhaften Antisemitismus widmete, dessen treuer Abdruck dieses Werk nun ist. Dieser Kot wird uns bald im Zentrum der Hauptstadt in den Nacken geschüttet, skrupellos und ungehindert. Was kann man dazu noch sagen? Vielleicht nur soviel, dass Herr István Tarlós, der einen geistigen Verfall aufweisende Oberbürgermeister, dessen historische Schuld es ist, in der Hauptstadt Ungarns ein Nazi-Theater eröffnet zu haben, sich endlich zum Teufel schert und keine Predigten über Wagner hält, sondern in weite Ferne zieht und jeden Tag damit beginnt, sein Volk tausendmal um Verzeihung zu bitten."The Nation (USA), 01.10.2012
 Thomas Meaney bespricht den historischen Essay "In the Shadow of the General - Modern France and the Myth of De Gaulle" des Oxford-Historikers Sudhir Hazareesingh. Allerdings sagt er nicht so viel über das Buch, sondern erliegt dem Mythos lieber. Wie sollte er anders angesichts solcher Episoden: "Weniger als ein Jahr nachdem Pétain seinen Frieden mit Hitler gemacht hatte, entsandte De Gaulle ein Expeditionskorps, um Saint Pierre und Miquelon, zwei Pro-Vichy-Inseln vor der Küste Neufundlands aufzubringen. Der Angriff erzürnte die Amerikaner und Kanadier, die schockiert waren, dass ihr künftiger Alliierter in ihrem Hinterhof herumpfuschte. Aber die Aktion schweißte erfolgreich die bunt gemischte Truppe der France libre zusammen und erhöhte den Druck auf die Alliierten, die die Résistance unterstützen sollten."
Thomas Meaney bespricht den historischen Essay "In the Shadow of the General - Modern France and the Myth of De Gaulle" des Oxford-Historikers Sudhir Hazareesingh. Allerdings sagt er nicht so viel über das Buch, sondern erliegt dem Mythos lieber. Wie sollte er anders angesichts solcher Episoden: "Weniger als ein Jahr nachdem Pétain seinen Frieden mit Hitler gemacht hatte, entsandte De Gaulle ein Expeditionskorps, um Saint Pierre und Miquelon, zwei Pro-Vichy-Inseln vor der Küste Neufundlands aufzubringen. Der Angriff erzürnte die Amerikaner und Kanadier, die schockiert waren, dass ihr künftiger Alliierter in ihrem Hinterhof herumpfuschte. Aber die Aktion schweißte erfolgreich die bunt gemischte Truppe der France libre zusammen und erhöhte den Druck auf die Alliierten, die die Résistance unterstützen sollten."Outlook India (Indien), 24.09.2012
 "Unsere Filmindustrie ist nicht Hollywood, wo eine Meryl Streep auch noch mit Falten und Altersflecken ihre Weltherrschaft aufrecht erhalten kann", schreibt Namrata Joshi angesichts der schwiergen Comebacks zahlreicher Bollywood-Diven in jüngerer Zeit, von denen ein Großteil klassisches Divenalter eigentlich noch gar nicht erreicht hat: "'Probleme treten dann auf, wenn du versuchst, dich den Bedürfnissen des Mainstreamkinos anzupassen', sagt Shailesh Kapoor, Vorstandsvoritzender von Ormax Media. Wenn das Rampenlicht schon gegenüber reifen Schauspielern nicht gnädig ist, so ist es gegenüber seinen alternden Hauptdarstellerinnen erst recht ungnädig. Männer sind mit dem Dilemma der eigenen Wiedererfindung und den Zwängen, sich anzupassen, erst mit knapp 50 konfroniert, man frage nur Sunny Deol oder Sanjay Dutt. Himmel, sogar Amitabh. Für Frauen aber klingeln die Alarmglocken bereits, wenn sie die 30 überschritten haben. ... Substanzielle Rollen sind schwerer zu finden. Fimemacher Onir, der 'I Am', Juhi Chawlas ersten Film nach einer langen Schaffenspause gedreht hat, fordert, dass es mehr Filme mit Rollen für ältere Darstellerinnen geben sollte."
"Unsere Filmindustrie ist nicht Hollywood, wo eine Meryl Streep auch noch mit Falten und Altersflecken ihre Weltherrschaft aufrecht erhalten kann", schreibt Namrata Joshi angesichts der schwiergen Comebacks zahlreicher Bollywood-Diven in jüngerer Zeit, von denen ein Großteil klassisches Divenalter eigentlich noch gar nicht erreicht hat: "'Probleme treten dann auf, wenn du versuchst, dich den Bedürfnissen des Mainstreamkinos anzupassen', sagt Shailesh Kapoor, Vorstandsvoritzender von Ormax Media. Wenn das Rampenlicht schon gegenüber reifen Schauspielern nicht gnädig ist, so ist es gegenüber seinen alternden Hauptdarstellerinnen erst recht ungnädig. Männer sind mit dem Dilemma der eigenen Wiedererfindung und den Zwängen, sich anzupassen, erst mit knapp 50 konfroniert, man frage nur Sunny Deol oder Sanjay Dutt. Himmel, sogar Amitabh. Für Frauen aber klingeln die Alarmglocken bereits, wenn sie die 30 überschritten haben. ... Substanzielle Rollen sind schwerer zu finden. Fimemacher Onir, der 'I Am', Juhi Chawlas ersten Film nach einer langen Schaffenspause gedreht hat, fordert, dass es mehr Filme mit Rollen für ältere Darstellerinnen geben sollte."Film Comment (USA), 11.09.2012
 Stefan Grissemann porträtiert den österreichischen Experimentalfilmemacher Peter Kubelka, dessen achtes Werk in insgesamt fast 60 Jahren, "Antiphon", kurz vor der Veröffentlichung steht (mehr): "Kubelkas hocheigenständige Filmkunst ist strikt handgemacht. Er benötigt weder Kamera noch Schneidetisch. In seinem Zuhause, einem geräumigen alten Appartement in Wiens Inneren Stadt, das mit tausenden ethnografischer Artefakte gefüllt ist, die seine Etymologie der Objekte illustrieren - winzige Skulpturen, primitive Musikinstrumente, Arbeitswerkzeug, das teilweise noch aus der frühen Steinzeit stammt -, erklärt er seinen künstlerischen Werdegang: ' Das Material selbst lehrte mich, Filme zu machen.' Er sitzt an seinem hölzernen Küchentisch und bearbeitet 35-Filmstreifen mit Schere und Kleber, als hätte die moderne Filmtechnologie am Ende doch all ihre Macht verloren und als wäre die Kunst des Kinos zu jener Art des Filmemachens zurückgekehrt, in der auch Georges Méliès seine wundersamen Filme schuf." Auf eine DVD- oder BluRay-Edition hofft man indes vergebens: "Kubelkas Entscheidung, seine Filme niemals in digitaler Form verfügbar zu machen, ist im übrigen in Stein geschrieben. Er hält das analoge Kino für schlicht nicht übertragbar." Dafür finden wir auf Youtube immerhin einen Vortrag des Filmemachers zum Thema "Warum gestalten?":
Stefan Grissemann porträtiert den österreichischen Experimentalfilmemacher Peter Kubelka, dessen achtes Werk in insgesamt fast 60 Jahren, "Antiphon", kurz vor der Veröffentlichung steht (mehr): "Kubelkas hocheigenständige Filmkunst ist strikt handgemacht. Er benötigt weder Kamera noch Schneidetisch. In seinem Zuhause, einem geräumigen alten Appartement in Wiens Inneren Stadt, das mit tausenden ethnografischer Artefakte gefüllt ist, die seine Etymologie der Objekte illustrieren - winzige Skulpturen, primitive Musikinstrumente, Arbeitswerkzeug, das teilweise noch aus der frühen Steinzeit stammt -, erklärt er seinen künstlerischen Werdegang: ' Das Material selbst lehrte mich, Filme zu machen.' Er sitzt an seinem hölzernen Küchentisch und bearbeitet 35-Filmstreifen mit Schere und Kleber, als hätte die moderne Filmtechnologie am Ende doch all ihre Macht verloren und als wäre die Kunst des Kinos zu jener Art des Filmemachens zurückgekehrt, in der auch Georges Méliès seine wundersamen Filme schuf." Auf eine DVD- oder BluRay-Edition hofft man indes vergebens: "Kubelkas Entscheidung, seine Filme niemals in digitaler Form verfügbar zu machen, ist im übrigen in Stein geschrieben. Er hält das analoge Kino für schlicht nicht übertragbar." Dafür finden wir auf Youtube immerhin einen Vortrag des Filmemachers zum Thema "Warum gestalten?": Weiteres: Kent Jones spricht mit Richard Peña, dem Leiter des New York Filmfestivals. Außerdem bespricht er ausführlich Paul Thomas Andersons neuen Film "The Master" (Pressespiegel), der gerade in Venedig Premiere feierte.
Believer (USA), 01.09.2012
 Anhand der Lebensgeschichte des legendären Surfers Eddie Aikau wirft Nicole Pasulka einen Blick auf die Widersprüche und Konflikte in der Geschichte und Gesellschaft Hawaiis, die in der Außendarstellung des Landes erfolgreich kaschiert werden. Am Bild vom "polynesischen Disneyland" hat Pasulka selbst mitgewirkt, als sie noch Audiotouren für eine Tourismusfirma schrieb: "In der Geschichte Hawaiis, die wir produzierten, ist nie etwas Schlimmes passiert - ausgenommen höchstens Pearl Harbor, aber auch das haben wir heruntergespielt. Immerhin kamen im Jahr 2010 1,2 Millionen Japaner nach Hawaii und gaben dort fast zwei Milliarden Dollar aus. Das Standard-Tourismusnarrativ klammert Epidemien, Gewalt gegen Ureinwohner und Bewegungen für staatliche Souveränität aus. Wer möchte schon daran erinnert werden, dass er in einem illegal annektierten Land Urlaub macht?"
Anhand der Lebensgeschichte des legendären Surfers Eddie Aikau wirft Nicole Pasulka einen Blick auf die Widersprüche und Konflikte in der Geschichte und Gesellschaft Hawaiis, die in der Außendarstellung des Landes erfolgreich kaschiert werden. Am Bild vom "polynesischen Disneyland" hat Pasulka selbst mitgewirkt, als sie noch Audiotouren für eine Tourismusfirma schrieb: "In der Geschichte Hawaiis, die wir produzierten, ist nie etwas Schlimmes passiert - ausgenommen höchstens Pearl Harbor, aber auch das haben wir heruntergespielt. Immerhin kamen im Jahr 2010 1,2 Millionen Japaner nach Hawaii und gaben dort fast zwei Milliarden Dollar aus. Das Standard-Tourismusnarrativ klammert Epidemien, Gewalt gegen Ureinwohner und Bewegungen für staatliche Souveränität aus. Wer möchte schon daran erinnert werden, dass er in einem illegal annektierten Land Urlaub macht?"In einem koreanischen Restaurant in Los Angeles lässt sich Andrew Simmons vom pulitzerprämierten Restaurantkritiker Jonathan Gold sieben Lektionen über das Kochen, das Essen und das Schreiben über Essen erteilen. Lektion 7: Essen ist der beste Weg, eine fremde Umgebung kennenzulernen: "Wenn du Journalist bist und versuchst, dich mit einer Stadt vertraut zu machen, werden die Leute nicht mit dir reden. Sie wollen deine Fragen nicht beantworten. Aber wenn du in einem Restaurant bist, wird bei allen das Gastfreundschafts-Gen aktiv. Das war ja sogar über Bin Laden zu lesen. Selbst wenn der israelische Premierminister in seinem Camp aufgekreuzt wäre, hätte er ihm einen Platz angeboten und Wasser und Datteln gebracht. So sind wir einfach programmiert."
Grantland (USA), 17.09.2012
 Nachdem bereits die Scrabble-Community durch einen Betrugsfall erschüttert wurde (hier der Bericht in der New York Times), hat es jetzt auch die Schachwelt erwischt: In den USA wurde ein Schüler erwischt, der auf einem zugelassenen PDA Schummel-Software installiert hatte, berichtet Dave McKenna: "Clark Smiley ist der erste überführte Spieler, der ein zugelassenes Softwareprogramm zum Schummeln nutzte. Der US-Schachverband versucht nun exakt zu rekonstruieren, wie Smiley es anstellte. Die Antwort dürfte nicht nur seine Bestrafung, sondern auch die Zukunft von Computern in Schachwettbewerben bestimmen." (Schachfreunden sei noch dieser Text aus Wired empfohlen, der erklärt, wie komplex das Spiel eigentlich ist: in einer durchschnittlichen 40-Zug-Partie gibt es mehr mögliche Positionen als Atome in unserem Universum.)
Nachdem bereits die Scrabble-Community durch einen Betrugsfall erschüttert wurde (hier der Bericht in der New York Times), hat es jetzt auch die Schachwelt erwischt: In den USA wurde ein Schüler erwischt, der auf einem zugelassenen PDA Schummel-Software installiert hatte, berichtet Dave McKenna: "Clark Smiley ist der erste überführte Spieler, der ein zugelassenes Softwareprogramm zum Schummeln nutzte. Der US-Schachverband versucht nun exakt zu rekonstruieren, wie Smiley es anstellte. Die Antwort dürfte nicht nur seine Bestrafung, sondern auch die Zukunft von Computern in Schachwettbewerben bestimmen." (Schachfreunden sei noch dieser Text aus Wired empfohlen, der erklärt, wie komplex das Spiel eigentlich ist: in einer durchschnittlichen 40-Zug-Partie gibt es mehr mögliche Positionen als Atome in unserem Universum.)Letras Libres (Spanien / Mexiko), 15.09.2012
 Am 7. Oktober wird in Venezuela gewählt. Der Publizist Moisés Naím, der Anfang der 90er Jahre venezolanischer Handels- und Industrieminister und Geschäftsführender Direktor der Weltbank war, analysiert die Schwierigkeiten, die der aussichtsreichste Oppositionskandidat Henrique Capriles im Falle eines Sieges über Hugo Chávez zu erwarten hätte: "Paradoxerweise hat ausgerechnet die starke Staatsfixierung während der Regierung von Hugo Chávez (seit 1998) zu einer extremen Schwächung des Staates geführt, der selbst grundlegende Funktionen nicht mehr erfüllen kann. Ein gravierendes Problem ist auch die völlige Unterwerfung der Judikative unter die Exekutive und das Militär, nicht einmal im Chile Pinochets war diese so weitgehend. Chile ist andererseits ein Beispiel dafür, wie es im Verlauf eines friedlichen Übergangsprozesses im Anschluss an das Ende der Diktatur gelingen konnte, einen zumindest halbwegs verlässlichen Rechtsstaat wiederherzustellen. Hoffen wir, dass Venezuela ein weiteres positives Beispiel in diesem Sinne sein wird."
Am 7. Oktober wird in Venezuela gewählt. Der Publizist Moisés Naím, der Anfang der 90er Jahre venezolanischer Handels- und Industrieminister und Geschäftsführender Direktor der Weltbank war, analysiert die Schwierigkeiten, die der aussichtsreichste Oppositionskandidat Henrique Capriles im Falle eines Sieges über Hugo Chávez zu erwarten hätte: "Paradoxerweise hat ausgerechnet die starke Staatsfixierung während der Regierung von Hugo Chávez (seit 1998) zu einer extremen Schwächung des Staates geführt, der selbst grundlegende Funktionen nicht mehr erfüllen kann. Ein gravierendes Problem ist auch die völlige Unterwerfung der Judikative unter die Exekutive und das Militär, nicht einmal im Chile Pinochets war diese so weitgehend. Chile ist andererseits ein Beispiel dafür, wie es im Verlauf eines friedlichen Übergangsprozesses im Anschluss an das Ende der Diktatur gelingen konnte, einen zumindest halbwegs verlässlichen Rechtsstaat wiederherzustellen. Hoffen wir, dass Venezuela ein weiteres positives Beispiel in diesem Sinne sein wird."Village Voice (USA), 17.09.2012
 Die New Yorker Videothek Mondo Kim's erlangte in den Neunzigern mit ihrer Sammlung von 55.000 Filmen, darunter unzähligen Raritäten, einen Ruf, der weit über Manhattan hinausging. Als das Verleihgeschäft unwirtschaftlich wurde, bot ihr Inhaber Yongman Kim seine Filmsammlung an - und fand im sizilianischen Städtchen Salemi einen Abnehmer. Karina Longworth schildert die irre Geschichte und recherchiert, was aus dem kulturellen Schatz geworden ist: "Wird in Salemi noch über die Videosammlung gesprochen? Pietro, ein Mittvierziger mit randloser Brille, schüttelt den Kopf. 'Wirklich, die haben alle vergessen.' In New York haben die Kim-Treuen nicht vergessen. 'Die Leute reden ständig über Mondo Kim's', sagt die Produzentin Rachel Fernandes. 'Es ist so etwas wie eine urban legend.'"
Die New Yorker Videothek Mondo Kim's erlangte in den Neunzigern mit ihrer Sammlung von 55.000 Filmen, darunter unzähligen Raritäten, einen Ruf, der weit über Manhattan hinausging. Als das Verleihgeschäft unwirtschaftlich wurde, bot ihr Inhaber Yongman Kim seine Filmsammlung an - und fand im sizilianischen Städtchen Salemi einen Abnehmer. Karina Longworth schildert die irre Geschichte und recherchiert, was aus dem kulturellen Schatz geworden ist: "Wird in Salemi noch über die Videosammlung gesprochen? Pietro, ein Mittvierziger mit randloser Brille, schüttelt den Kopf. 'Wirklich, die haben alle vergessen.' In New York haben die Kim-Treuen nicht vergessen. 'Die Leute reden ständig über Mondo Kim's', sagt die Produzentin Rachel Fernandes. 'Es ist so etwas wie eine urban legend.'"Elet es Irodalom (Ungarn), 14.09.2012
 In der Debatte um eine korrekte Sprache in der ungarischen Geschichtsschreibung fasst der Historiker András Gerö, der diesen Streit mit einem Vorwurf an seinen Kollegen Ignác Romsics losgetreten hatte (mehr dazu hier), die bisherigen Erkenntnisse dieser Debatte zusammen: "Die" ungarische Geschichte gibt es nicht, jedenfalls solange, wie man sich nicht auf eine gemeinsame Sprache einigen kann. "Das Bedürfnis einer scheinbar oder tatsächlich einheitlichen Narration, Interpretation, Geschichte und Sprache existiert nur im wissenschaftlichen Leben von Diktaturen - anderswo ist es eine Fiktion. Und aus diesem Grunde ist es unzeitgemäß und lebensfremd, besonders dann, wenn auch die ungarischen und europäischen geistigen Tendenzen und Kontexte von etwas anderem handeln. Vorher muss man sich also mehrmals und gründlich streiten, damit irgendwann ein sauberer und nachhaltiger - auf einem Konsens oder auf einem Meinungsunterschied basierender - Frieden entsteht. Nichts wird uns miteinander verbinden, solange wir nicht genau wissen, was uns voneinander trennt. Der erste Schritt auf diesem langen Weg ist getan worden."
In der Debatte um eine korrekte Sprache in der ungarischen Geschichtsschreibung fasst der Historiker András Gerö, der diesen Streit mit einem Vorwurf an seinen Kollegen Ignác Romsics losgetreten hatte (mehr dazu hier), die bisherigen Erkenntnisse dieser Debatte zusammen: "Die" ungarische Geschichte gibt es nicht, jedenfalls solange, wie man sich nicht auf eine gemeinsame Sprache einigen kann. "Das Bedürfnis einer scheinbar oder tatsächlich einheitlichen Narration, Interpretation, Geschichte und Sprache existiert nur im wissenschaftlichen Leben von Diktaturen - anderswo ist es eine Fiktion. Und aus diesem Grunde ist es unzeitgemäß und lebensfremd, besonders dann, wenn auch die ungarischen und europäischen geistigen Tendenzen und Kontexte von etwas anderem handeln. Vorher muss man sich also mehrmals und gründlich streiten, damit irgendwann ein sauberer und nachhaltiger - auf einem Konsens oder auf einem Meinungsunterschied basierender - Frieden entsteht. Nichts wird uns miteinander verbinden, solange wir nicht genau wissen, was uns voneinander trennt. Der erste Schritt auf diesem langen Weg ist getan worden."Während die sozialliberale Regierung von Ministerpräsident Ferenc Gyurcsány von der ungarischen Bevölkerung massiv abgelehnt und bei den Wahlen 2010 regelrecht verjagt wurde, stößt der derzeitige Demokratieabbau unter Ministerpräsident Viktor Orbán nur auf geringen Widerstand im Land. Eszter Rádai fragte die in Berlin lebende ungarische Psychologin Eszter Fischer, woran das liegen könnte: "Der Demokratieabbau in Ungarn stößt meiner Ansicht nach deshalb auf einen geringen Widerstand, weil die Menschen nicht erkannt haben, dass sie inzwischen in einer Demokratie leben. Sie haben kein Verlustgefühl, weil die Demokratie nicht zu einer alltäglichen Erfahrung wurde. [...] Das bedeutet nicht, dass die Regierung Orbán populär wäre, nur gibt es keine Alternative. Es gibt keinen Prinzen, auf den man hoffen kann, dass alles wieder gut wird, wenn er den Thron besteigt. Es gibt keine Prinzen mehr."
HVG (Ungarn), 08.09.2012
 Während sich in Ungarn eine aggressive Sprache immer mehr ausbreitet und jene, die sie verwenden, als "Helden der Wahrheit und der Eindeutigkeit" gefeiert werden, sind die Befürworter eines politisch korrekten Sprachgebrauchs in der Minderheit. Zu ihnen gehört auch der Sprachwissenschaftler László Cseresnyési, der in seinen Schriften betont, dass es eine natürliche Bestrebung der Menschen sei, "explosive Begriffe" mit alternativen Ausdrücken zu vermeiden. Zsolt Zádor fragte ihn, ob political correctness in der Sprache nicht nur eine Verschleierung, eine Verdrängung ist, weil ja, während man den Schein bewahrt, sich Abneigung oder gar Hass nicht vermindern: "Symbolische sprachliche Gesten sollten nicht überbewertet werden, aber man sollte sie auch nicht unterschätzen. Das Wesentliche an den oft beschimpften, bei uns jedoch nur in Ansätzen vorhandenen politischen Korrektheit ist die bewusste Bestrebung, den anderen mit unserer Wortwahl möglichst nicht zu beleidigen. Ich bin dagegen, dass man eine zentrale Liste von richtigen und falschen Wörtern erstellt, wie dies beispielsweise bei japanischen Fernsehsendern praktiziert wird. In den meisten Fällen wissen wir ja ganz genau, welche Ausdrücke verletzend sind. Für mich ist 'PC' eine verständnisvolle Attitüde, eine sinnvolle Toleranz, ein innerlich erlebter, bewusster Sprachgebrauch."
Während sich in Ungarn eine aggressive Sprache immer mehr ausbreitet und jene, die sie verwenden, als "Helden der Wahrheit und der Eindeutigkeit" gefeiert werden, sind die Befürworter eines politisch korrekten Sprachgebrauchs in der Minderheit. Zu ihnen gehört auch der Sprachwissenschaftler László Cseresnyési, der in seinen Schriften betont, dass es eine natürliche Bestrebung der Menschen sei, "explosive Begriffe" mit alternativen Ausdrücken zu vermeiden. Zsolt Zádor fragte ihn, ob political correctness in der Sprache nicht nur eine Verschleierung, eine Verdrängung ist, weil ja, während man den Schein bewahrt, sich Abneigung oder gar Hass nicht vermindern: "Symbolische sprachliche Gesten sollten nicht überbewertet werden, aber man sollte sie auch nicht unterschätzen. Das Wesentliche an den oft beschimpften, bei uns jedoch nur in Ansätzen vorhandenen politischen Korrektheit ist die bewusste Bestrebung, den anderen mit unserer Wortwahl möglichst nicht zu beleidigen. Ich bin dagegen, dass man eine zentrale Liste von richtigen und falschen Wörtern erstellt, wie dies beispielsweise bei japanischen Fernsehsendern praktiziert wird. In den meisten Fällen wissen wir ja ganz genau, welche Ausdrücke verletzend sind. Für mich ist 'PC' eine verständnisvolle Attitüde, eine sinnvolle Toleranz, ein innerlich erlebter, bewusster Sprachgebrauch."Guardian (UK), 15.09.2012
Zum Erscheinen der Erinnerungen (Auszug) Salman Rushdies, erzählen vor allem Freunde, wie sie damals die Fatwa gegen Rushdie, die im Iran gerade wieder bekräftigt wurde, erlebten. Der einzige, der damals auf der anderen Seite stand, Inayat Bunglawala, Gründer und Vorsitzender der Organisation Muslims4UK, würde heute kein Verbot mehr des Romans fordern, aber er hat ein warmes Gefühl, denkt er an die Demonstrationen zurück: "Sieht man zurück auf den Herbst 1988, kann man wohl ohne Übertreibung sagen, dass es die Hitze der Affäre um die Satanischen Verse war, in der erstmals eine bewusste britische muslimische Identität in UK geschmiedet wurde. Ich studierte damals im zweiten Jahr und es war ein aufregendes Gefühl, mit anderen zu marschieren und zu demonstrieren, die unterschiedlicher Herkunft waren, vom indischen Subkontinent, Nordafrika, Südostasien und anderswo, aber alle vereint im Glauben an den Islam."
Die Fragen, die damals aufgeworfen wurden, bleiben, meint Ian McEwan: "Wie geht eine offene pluralistische Gesellschaft mit den unterschiedlichen Gewissheiten verschiedener Glaubensrichtungen um? Und wie akzeptieren die Gläubigen das freie Denken anderer? Auf die erste Frage könnte man generell antworten, dass eine säkulare oder skeptische Weltsicht der beste Garant für religiöse Freiheit ist: ohne Bevorzugung alle innerhalb des Gesetzes tolerierend und beschützend. Was die zweite Frage angeht - nun, Menschen die absolut überzeugt sind von ihrem Gott, sollten darüber stehen, physische Rache zu nehmen, wenn sie beleidigt sind. Vielleicht sind die Bücherverbrenner und Plakatschwenker, paradoxerweise, geplagt von den ersten Kobolden des Zweifels?"
Die Fragen, die damals aufgeworfen wurden, bleiben, meint Ian McEwan: "Wie geht eine offene pluralistische Gesellschaft mit den unterschiedlichen Gewissheiten verschiedener Glaubensrichtungen um? Und wie akzeptieren die Gläubigen das freie Denken anderer? Auf die erste Frage könnte man generell antworten, dass eine säkulare oder skeptische Weltsicht der beste Garant für religiöse Freiheit ist: ohne Bevorzugung alle innerhalb des Gesetzes tolerierend und beschützend. Was die zweite Frage angeht - nun, Menschen die absolut überzeugt sind von ihrem Gott, sollten darüber stehen, physische Rache zu nehmen, wenn sie beleidigt sind. Vielleicht sind die Bücherverbrenner und Plakatschwenker, paradoxerweise, geplagt von den ersten Kobolden des Zweifels?"
La regle du jeu (Frankreich), 12.09.2012
Bernard-Herni Lévy hat in seinem Blog La Règle du jeu richtig recherchiert und erzählt die Geschichte einiger Währungsunionen. Allein in Europa kennt er sechs Fälle, die teilweise - wie eine skandinavische Währungsunion - gescheitert sind, zuweilen aber auch glückten. "Zwei zum Beispiel haben eine echte gemeinsame Währung geschaffen, nach Jahren der Krisen, der Rückschläge, der vorläufigen Rücknahmen und dank mutiger Führer, die verstanden hatten, dass eine Währung nur auf einem Budget, einem Steuersystem, einem Arbeitsrecht, gemeinsamen sozialstaatlichen Regeln, kurz einer wirklich abgestimmten Politik beruhen kann: Dies ist die Geschichte der neuen Mark, die fast vierzig Jahre nach dem Zollverein von 1834 Gestalt annahm und die Gulden, Thaler, Kronenthaler und Mark der hanseatischen Städte ersetzen. Und es ist die Geschichte des Dollars, von dem man kaum mehr in Erinnerung hat, dass er 120 Jahre brauchte um sich durchzusetzen - und dass die Voraussetzung dafür eine Vergemeinsamung der Schulden war. Die Lehre daraus ist unerbittlich: Ohne Zusammenschluss keine gemeinsame Währung."
New York Magazine (USA), 16.09.2012
Kathryn Schulz besucht den Autor Michael Chabon und spricht mit ihm über seinen neuen Roman "Telegraph Avenue", der von der Freundschaft und Liebe zweier Männer handelt, die für nicht Schwule so schwer auszudrücken ist: "Chabon beneidet Frauen für ihre relativ größere emotionale Freiheit, sagt er. Und er glaubt, dass 'viele der Dinge, die Männer fühlen - Verwirrung, Frustration, Mangel an emotionaler Bindung und Erfüllung - damit zu tun hat, dass die akzeptierten Ausdrucksmöglichkeiten so dürftig sind'. Mit meinem Buch, sagt er, 'frage ich letztendlich: Was bedeutet es für zwei Männer, sich zu lieben? Lieben sich männliche Freunde? Und wenn sie sich lieben, was für eine Art von Liebe ist das? Sagen sie, dass sie sich lieben? Wissen sie überhaupt, dass sie sich lieben?'"
Wired | Film Comment | Believer | Grantland | Letras Libres | Village Voice | Elet es Irodalom | HVG | Guardian | Merkur | La regle du jeu | New York Magazine | Vanity Fair | Polityka | Newsweek | Open Democracy | Magyar Narancs | The Nation | Outlook India
Kommentieren












