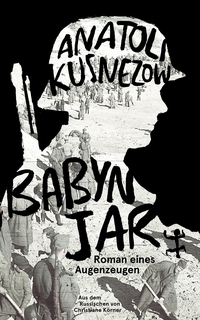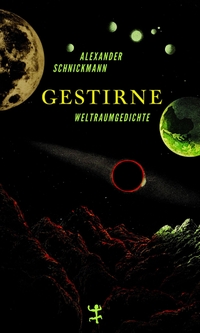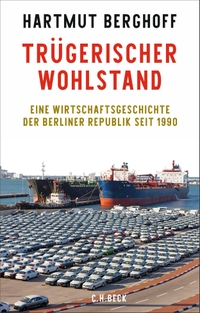Magazinrundschau
Zwei Formen derselben Psychose
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
Vanity Fair (USA), 31.03.2019
 Karan Mahajan erzählt in einer großen Reportage, wie Ajay, Atul und Rajesh Gupta, drei märchenhaft reiche indische Brüder, Südafrika korrumpierten, was für den Reporter auch ein kleines persönliches Problem darstellte, weil Minenarbeiter ihn für einen der Brüder halten. Ausgangspunkt der Geschichte ist ein riesiger Skandal, der 2016 öffentlich wurde: "Ein Regierungsbeamter bezeugte, dass die Guptas ihm die Position des Finanzministers angeboten hätten; die drei Brüder, so stellte sich heraus, hatten praktisch die Kontrolle über den Staatsapparat übernommen. Es ist bis heute eine der kühnsten und lukrativsten Betrügereien des Jahrhunderts. Aufgrund ihrer engen Beziehungen zu Präsident Jacob Zuma und mit Hilfe führender internationaler Unternehmen wie KPMG, McKinsey und SAP haben die Guptas möglicherweise die Staatskasse von bis zu 7 Milliarden Dollar aufgebraucht. Zuma musste zurücktreten. McKinsey bot eine außergewöhnliche öffentliche Entschuldigung für seine Rolle in dem Skandal an. Die Guptas flohen nach Dubai. Und die Mine, die die Brüder in einem korrupten Geschäft erworben hatten, das von der Regierung vermittelt und finanziert wurde, geriet in Konkurs. ... Es war ein moderner Coup d'état, der mit Bestechung statt mit Kugeln betrieben wurde. Er zeigte, wie ein ganzes Land von ausländischen Einflüsse gesteuert werden kann, ohne dass ein einziger Schuss fällt - vor allem, wenn dieses Land von einem spaltenden Präsidenten regiert wird, der darin geschult ist, rassische Ressentiments zu schüren, bereit ist, seine eigenen Geheimdienstchefs zu feuern, um seine Geschäftsinteressen zu schützen, und der bereit ist, seine gewählte Position zu nutzen, um sich mit widerwärtigen Investoren zu bereichern."
Karan Mahajan erzählt in einer großen Reportage, wie Ajay, Atul und Rajesh Gupta, drei märchenhaft reiche indische Brüder, Südafrika korrumpierten, was für den Reporter auch ein kleines persönliches Problem darstellte, weil Minenarbeiter ihn für einen der Brüder halten. Ausgangspunkt der Geschichte ist ein riesiger Skandal, der 2016 öffentlich wurde: "Ein Regierungsbeamter bezeugte, dass die Guptas ihm die Position des Finanzministers angeboten hätten; die drei Brüder, so stellte sich heraus, hatten praktisch die Kontrolle über den Staatsapparat übernommen. Es ist bis heute eine der kühnsten und lukrativsten Betrügereien des Jahrhunderts. Aufgrund ihrer engen Beziehungen zu Präsident Jacob Zuma und mit Hilfe führender internationaler Unternehmen wie KPMG, McKinsey und SAP haben die Guptas möglicherweise die Staatskasse von bis zu 7 Milliarden Dollar aufgebraucht. Zuma musste zurücktreten. McKinsey bot eine außergewöhnliche öffentliche Entschuldigung für seine Rolle in dem Skandal an. Die Guptas flohen nach Dubai. Und die Mine, die die Brüder in einem korrupten Geschäft erworben hatten, das von der Regierung vermittelt und finanziert wurde, geriet in Konkurs. ... Es war ein moderner Coup d'état, der mit Bestechung statt mit Kugeln betrieben wurde. Er zeigte, wie ein ganzes Land von ausländischen Einflüsse gesteuert werden kann, ohne dass ein einziger Schuss fällt - vor allem, wenn dieses Land von einem spaltenden Präsidenten regiert wird, der darin geschult ist, rassische Ressentiments zu schüren, bereit ist, seine eigenen Geheimdienstchefs zu feuern, um seine Geschäftsinteressen zu schützen, und der bereit ist, seine gewählte Position zu nutzen, um sich mit widerwärtigen Investoren zu bereichern."Simon van Zuylen-Wood befasst sich mit dem Kampf, den Facebook gegen Trolle und Rassisten führt. "Eine Ironie der Bemühungen, die Plattform zu säubern, liegt darin, dass es sich um ein dem Format inhärentes Problem handelt. Wenn Facebook eine wohlwollende Regierung sein will, warum konzentriert es sich dann auf Polizeiarbeit? Sollte es nicht auch Anreize für gutes Verhalten geben? Im November veröffentlichte Facebook eine Studie von Matt Katsaros und drei Wissenschaftlern, die dieser Frage nachgeht. FB-User, die Nacktbilder oder Hassreden posten, erhalten eine kurze, automatisierte Nachricht, die sie über die Regelverletzung und die Löschung ihrer Inhalte informiert. Katsaros und seine Co-Autoren befragten fast 55.000 Benutzer, die diese Nachricht erhalten hatten. Zweiundfünfzig Prozent fühlten sich nicht fair behandelt, während 57 Prozent sagten, es sei unwahrscheinlich, dass Facebook ihre Perspektive verstehe. Bei denen, die sich fair behandelt fühlten, verringerte sich die Wahrscheinlichkeit erneuter Verstöße. Facebook sollte sich weniger auf die Bestrafung konzentrieren als auf ein System der Verfahrensgerechtigkeit, das die User respektieren und dem sie vertrauen können." Ein schöner Ansatz, aber auch ein bisschen scheinheilig, denn van Zuylen-Wood weiß sicher auch, dass "Verfahrensgerechtigkeit" immer subjektiv ist.
Eurozine (Österreich), 11.03.2019
 Agata Araszkiewicz und Agata Czarnacka blicken in einem aus Esprit übernommen Text auf die Situation der Frauen in Polen, die sich nicht erst unter der nationalkonservativen PiS-Regierung gravierend verschlechtert hat: "Tatsächlich sind die politischen Auseinandersetzungen um Frauenrechte das wichtigste Merkmal der polnischen Transformation. Die Transformation - in Bezug auf individuelle Rechte und bürgerliche Freiheiten, vor allem über den eigenen Körper - basierte in der Hauptsache auf zwei Entscheidungen: Die Religion in die Schule zurückzubringen und Abtreibungen zu verbieten, die in den 42 Jahren der Volksrepublik von 1947 bis 1989 voll zugänglich war. Die Frauenrechte auf dem Altar eines Nichtangriffspakts mit der Kirche zu opfern, die ein wichtiger sozialer Akteur im Kampf für Demokratie unter dem Kommunismus war, wurde zu einem Wesenszug der polnischen Modernisierung. Wie schon die Kulturtheoretiker Jan Sowa und Przemysław Czapliński schrieben, wird die Modernisierung häufig als infrastrukturelle oder technologische Verbesserung verstanden, ohne von einem fortschrittlichen Verständnis der Menschenrechte begleitet zu sein (vor allem nicht der Rechte von Frauen und Minderheiten). Die Freiheit des Einzelnen verkümmert - moralisch und exitenziell."
Agata Araszkiewicz und Agata Czarnacka blicken in einem aus Esprit übernommen Text auf die Situation der Frauen in Polen, die sich nicht erst unter der nationalkonservativen PiS-Regierung gravierend verschlechtert hat: "Tatsächlich sind die politischen Auseinandersetzungen um Frauenrechte das wichtigste Merkmal der polnischen Transformation. Die Transformation - in Bezug auf individuelle Rechte und bürgerliche Freiheiten, vor allem über den eigenen Körper - basierte in der Hauptsache auf zwei Entscheidungen: Die Religion in die Schule zurückzubringen und Abtreibungen zu verbieten, die in den 42 Jahren der Volksrepublik von 1947 bis 1989 voll zugänglich war. Die Frauenrechte auf dem Altar eines Nichtangriffspakts mit der Kirche zu opfern, die ein wichtiger sozialer Akteur im Kampf für Demokratie unter dem Kommunismus war, wurde zu einem Wesenszug der polnischen Modernisierung. Wie schon die Kulturtheoretiker Jan Sowa und Przemysław Czapliński schrieben, wird die Modernisierung häufig als infrastrukturelle oder technologische Verbesserung verstanden, ohne von einem fortschrittlichen Verständnis der Menschenrechte begleitet zu sein (vor allem nicht der Rechte von Frauen und Minderheiten). Die Freiheit des Einzelnen verkümmert - moralisch und exitenziell."Außerdem: Man könnte zwar glatt glauben, dass viele Russen, Ungarn und Polen gerade ganz verrückt nach Abschottung in jeder Richtung sind, doch Julia Sonnevend meint, dass jedem Osteuropäer eine Art postsowjetische Angst vor Grenzen und Autoritäten in die DNS geschrieben sei.
Guardian (UK), 11.03.2019
livemint (USA), 21.02.2019
 Was Peter Beinart im Guardian beschreibt, ist allerdings nur die halbe Wahrheit: Universalistisch ist die Linke vielleicht bei Christen und Juden. Was die Unterdrückung von Frauen im Islam angeht, lässt sie sich dagegen oft nur allzu gern von konservativen muslimischen Führern beruhigen. Salil Tripathi erinnert daran, wie eine kleine Gruppe indischer Frauen es 1989 wagte, Salman Rushdie zu verteidigen, dessen "Satanische Verse" auch in Indien verboten worden waren. Unterstützt wurden sie dabei von zwei britischen Frauenorganisationen, den Women Against Fundamentalism (WAF) und den Southall Black Sisters (SBS). Zu letzten gehört die ehemalige Leiterin der "Gender Unit" von Amnesty International, Gita Sahgal, die auch die Doku "Hullaballoo Over The Satanic Verses" (mehr hier) gedreht hatte. "Die Kampagne für Rushdie war extrem wichtig, sagt Sahgal. 'Er war als Schriftsteller von enormer Bedeutung. Ich verschlang seine Bücher. Er erzählte die Geschichte von Indien, Pakistan, Bangladesch und Großbritannien auf eine neue Weise, die wir sofort verstanden. Er war in lokalen Kämpfen um den Antirassismus verwurzelt und führte heftige Debatten mit einigen der anspruchsvolleren jungen schwarzen Filmemacher. Alles, was er sagte, sprach sehr direkt zu mir. Er ist die große literarische Figur und der öffentliche Intellektuelle unserer Generation.' Für SBS wurde die Rushdie-Affäre zu einem bemerkenswerten Wendepunkt. Bis zur Fatwa hatte die SBS ihre schwarze, weltliche und feministische Identität als selbstverständlich angesehen. [SBS-Mitglied Pragna] Patel sagt: 'Die Affäre hat es uns ermöglicht, Verbindungen zu knüpfen, die über die Grenzen von Klasse, Ethnizität, Kaste und Religion hinaus gingen.' Als die Medien authentische Stimmen der Minderheiten verstehen wollten, sprachen Journalisten zwangsläufig mit selbsternannten Führern, die oft die fundamentalistischsten unter ihnen waren, sagt Patel. Der Betrieb arbeitete gerne mit ihnen zusammen."
Was Peter Beinart im Guardian beschreibt, ist allerdings nur die halbe Wahrheit: Universalistisch ist die Linke vielleicht bei Christen und Juden. Was die Unterdrückung von Frauen im Islam angeht, lässt sie sich dagegen oft nur allzu gern von konservativen muslimischen Führern beruhigen. Salil Tripathi erinnert daran, wie eine kleine Gruppe indischer Frauen es 1989 wagte, Salman Rushdie zu verteidigen, dessen "Satanische Verse" auch in Indien verboten worden waren. Unterstützt wurden sie dabei von zwei britischen Frauenorganisationen, den Women Against Fundamentalism (WAF) und den Southall Black Sisters (SBS). Zu letzten gehört die ehemalige Leiterin der "Gender Unit" von Amnesty International, Gita Sahgal, die auch die Doku "Hullaballoo Over The Satanic Verses" (mehr hier) gedreht hatte. "Die Kampagne für Rushdie war extrem wichtig, sagt Sahgal. 'Er war als Schriftsteller von enormer Bedeutung. Ich verschlang seine Bücher. Er erzählte die Geschichte von Indien, Pakistan, Bangladesch und Großbritannien auf eine neue Weise, die wir sofort verstanden. Er war in lokalen Kämpfen um den Antirassismus verwurzelt und führte heftige Debatten mit einigen der anspruchsvolleren jungen schwarzen Filmemacher. Alles, was er sagte, sprach sehr direkt zu mir. Er ist die große literarische Figur und der öffentliche Intellektuelle unserer Generation.' Für SBS wurde die Rushdie-Affäre zu einem bemerkenswerten Wendepunkt. Bis zur Fatwa hatte die SBS ihre schwarze, weltliche und feministische Identität als selbstverständlich angesehen. [SBS-Mitglied Pragna] Patel sagt: 'Die Affäre hat es uns ermöglicht, Verbindungen zu knüpfen, die über die Grenzen von Klasse, Ethnizität, Kaste und Religion hinaus gingen.' Als die Medien authentische Stimmen der Minderheiten verstehen wollten, sprachen Journalisten zwangsläufig mit selbsternannten Führern, die oft die fundamentalistischsten unter ihnen waren, sagt Patel. Der Betrieb arbeitete gerne mit ihnen zusammen."New York Review of Books (USA), 21.03.2019
 Henry Louis Gates jr. unterhält sich mit dem nigerianischen Schriftsteller und Nobelpreisträger Wole Soyinka über Obama, Trump, Südafrika, die Rolle der Frauen in Afrika und den auch in Nigeria überhand nehmenden religiösen Fundamentalismus. Hier sieht Soyinka auch einen Fehler in der Afrikapolitik des von ihm sonst sehr geschätzten Barack Obama: "Sein Engagement für die Gleichberechtigung der Kulturen führte ihn hier manchmal auf den falschen Weg. Seine Erklärung von Kairo zum Beispiel hielt ich für eine Katastrophe im Hinblick auf die Befreiung der Menschheit, als er es - nicht unbedingt billigte, aber doch unterstützte -, dass jede Kultur das Recht habe, Frauen zur Verschleierung zu zwingen. Diese Art von Sprache machte den Begriff der Menschheit zu einem relativen Konzept. Für mich gibt es eine Menschheit oder nicht. Keine Kultur hat das Recht, ihre Weiblichkeit herabzusetzen. Auch wenn man nichts dagegen tun kann, darf man zumindest nie eine Erklärung abgeben, die irgendeine Form des kulturellen Relativismus unterstützt, nicht wenn es um die Würde und die Grundrechte der Menschheit geht."
Henry Louis Gates jr. unterhält sich mit dem nigerianischen Schriftsteller und Nobelpreisträger Wole Soyinka über Obama, Trump, Südafrika, die Rolle der Frauen in Afrika und den auch in Nigeria überhand nehmenden religiösen Fundamentalismus. Hier sieht Soyinka auch einen Fehler in der Afrikapolitik des von ihm sonst sehr geschätzten Barack Obama: "Sein Engagement für die Gleichberechtigung der Kulturen führte ihn hier manchmal auf den falschen Weg. Seine Erklärung von Kairo zum Beispiel hielt ich für eine Katastrophe im Hinblick auf die Befreiung der Menschheit, als er es - nicht unbedingt billigte, aber doch unterstützte -, dass jede Kultur das Recht habe, Frauen zur Verschleierung zu zwingen. Diese Art von Sprache machte den Begriff der Menschheit zu einem relativen Konzept. Für mich gibt es eine Menschheit oder nicht. Keine Kultur hat das Recht, ihre Weiblichkeit herabzusetzen. Auch wenn man nichts dagegen tun kann, darf man zumindest nie eine Erklärung abgeben, die irgendeine Form des kulturellen Relativismus unterstützt, nicht wenn es um die Würde und die Grundrechte der Menschheit geht."Paul Starr nimmt noch einmal die Konterkritik gegen Jill Abramsons Medienkritik auf und weist auf die Stärken von "Merchants of Truth" hin, entdeckt aber auch eine bisher eher unterbelichtete Schwäche des Buches: "Der größte Fehler von Abramsons Buch ist, dass es ein allzu beruhigendes Bild des Journalismus bietet. Während ihrer Arbeit daran konnte sie die New York Times und die Washington Post bei einem finanziellen Aufschwung, BuzzFeed und Vice bei einem Aufschwung ihrer redaktionellen Standards beobachten. Die Dinge verbessern sich, so die Tendenz des Buches. In Wahrheit ist die Geschichte dunkler. Die Zeitungen im Land befinden sich weiter im freien Fall, und die digitalen Medien sind kein Ersatz. Seit 2004, so eine Studie von Penny Abernathy von der University of North Carolina, mussten etwa 20 Prozent der Zeitungen schließen, während viele der Überlebenden zu dem geworden sind, was Ken Doctor von Harvards NiemanLab NINOs (newspapers in name only) nennt: Werbedienstleister mit nur wenig lokaler Berichterstattung. Private Equity-Firmen haben viele von ihnen aufgekauft, um die letzten Gewinne aus ihnen zu saugen. Das neue Jahr brachte zudem Entlassungen bei digitalen Nachrichtendiensten wie BuzzFeed und Vice. Auch wenn die Times und die Post den digitalen Wandel erfolgreich meistern, gehören sie zu einer kleinen Gruppe nationaler Nachrichtenunternehmen, die groß genug sind, nennenswerte Aboeinnahmen zu generieren. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass der digitale Markt den lokalen oder regionalen Journalismus auf eine dem Print vergleichbare Weise tragen kann." Und Abramsons Bild der Nachrichten ist für Starr auch deshalb zu zahm, weil es die radikale Transformation der Rechten und die sozialen Medien nicht thematisiere. Zur Ergänzung von Abramsons Buch empfiehlt er die Lektüre von "Network Propaganda: Manipulation, Disinformation and Radicalization in American Politics" von Yochai Benkler, Robert Faris und Hal Roberts. Die Autoren, so Starr, beleuchten das neue "Media Ökosystem", indem sie zeigen, wie politische Nachrichten zwischen 2015 und 2018 verlinkt, geliked, geteilt und Falschinformationen verbreitet wurden.
Weitere Artikel: Amy Knight beschäftigt sich mit zwei Dokumentarfilmen und einem Buch über die Ermordung des Putin-Kritikers Boris Nemzow. Claire Messud stellt die mexikanische Autorin Valeria Luiselli vor.
Novinky.cz (Tschechien), 12.03.2019
New Yorker (USA), 18.03.2019
 Für die aktuelle Mode- und Design-Ausgabe des New Yorker checkt Rebecca Mead die neuen Wandfarben der Dekokönige von Farrow & Ball. Schon die Namen sind schräg: "Elephant's Breath, gewöhnlich als Taupe bezeichnet, verkauft sich besser als weniger originell benannte Grautöne. Farrow & Ball lassen sich von der Natur inspirieren. Toter Lachs ist ein dunkelrosa Braun. Mizzle, ein Graugrün, hat seinen Namen von einem umgangssprachlichen Begriff für die bekannte britische Wetterlage zwischen Nebel und Nieselregen. Ein beliebter Trick von Farrow & Ball ist es, ein einfaches Wort zu nehmen und es ins Französische zu übersetzen: Ein Braunton, der das Designteam an ein Paar Hosen erinnerte, wurde zu Pantalon, und ein knackiges Weiß heißt Chemise. Ein muffiges Blau ist De Nimes, nach der französischen Stadt, in der Denim erfunden wurde. Andere Namen sind pervertiert: Ein cremefarbener Farbton wird als geschwärzt bezeichnet. Die Fans von Farrow & Ball schwärmen für die beispiellose Farbtiefe und das Schillern der Farben je nach Lichtverhältnissen. Wem die Unterscheidungsfähigkeit abgeht, dem bleibt der außergewöhnliche Preis. Farrow & Ball Farben kosten ca. 110 Dollar die Gallone, fast doppelt so viel wie gewöhnliche Farbe … Es ist wie eine Designer-Handtasche für Ihr Haus (und genau wie manche Leute Prada-Kopien kaufen, gibt es Hausbesitzer, die mit einer Farbprobe von Farrow & Ball in den Baumarkt gehen, um die Farbe zu kopieren. Was an Farbtiefe verloren geht, wird an Dicke der Brieftasche gewonnen.) Als David Cameron in seinem Garten einen Schuppen bauen ließ, in dem er seine Memoiren schreiben wollte, ließ er ihn mit einem Farrow & Ball Farbton namens Mouse's Back streichen. Der Schuppen kostete dreißigtausend Dollar. Hätten Farben von Farrow & Ball im 18. Jahrhundert in Frankreich existiert, hätte Marie Antoinette das Petit Trianon damit verschönert."
Für die aktuelle Mode- und Design-Ausgabe des New Yorker checkt Rebecca Mead die neuen Wandfarben der Dekokönige von Farrow & Ball. Schon die Namen sind schräg: "Elephant's Breath, gewöhnlich als Taupe bezeichnet, verkauft sich besser als weniger originell benannte Grautöne. Farrow & Ball lassen sich von der Natur inspirieren. Toter Lachs ist ein dunkelrosa Braun. Mizzle, ein Graugrün, hat seinen Namen von einem umgangssprachlichen Begriff für die bekannte britische Wetterlage zwischen Nebel und Nieselregen. Ein beliebter Trick von Farrow & Ball ist es, ein einfaches Wort zu nehmen und es ins Französische zu übersetzen: Ein Braunton, der das Designteam an ein Paar Hosen erinnerte, wurde zu Pantalon, und ein knackiges Weiß heißt Chemise. Ein muffiges Blau ist De Nimes, nach der französischen Stadt, in der Denim erfunden wurde. Andere Namen sind pervertiert: Ein cremefarbener Farbton wird als geschwärzt bezeichnet. Die Fans von Farrow & Ball schwärmen für die beispiellose Farbtiefe und das Schillern der Farben je nach Lichtverhältnissen. Wem die Unterscheidungsfähigkeit abgeht, dem bleibt der außergewöhnliche Preis. Farrow & Ball Farben kosten ca. 110 Dollar die Gallone, fast doppelt so viel wie gewöhnliche Farbe … Es ist wie eine Designer-Handtasche für Ihr Haus (und genau wie manche Leute Prada-Kopien kaufen, gibt es Hausbesitzer, die mit einer Farbprobe von Farrow & Ball in den Baumarkt gehen, um die Farbe zu kopieren. Was an Farbtiefe verloren geht, wird an Dicke der Brieftasche gewonnen.) Als David Cameron in seinem Garten einen Schuppen bauen ließ, in dem er seine Memoiren schreiben wollte, ließ er ihn mit einem Farrow & Ball Farbton namens Mouse's Back streichen. Der Schuppen kostete dreißigtausend Dollar. Hätten Farben von Farrow & Ball im 18. Jahrhundert in Frankreich existiert, hätte Marie Antoinette das Petit Trianon damit verschönert."Außerdem: Doreen St. Felix porträtiert den Fashion-Designer Virgil Abloh und seine Mode für Männer. Jia Tolentino stellt die Athleisure-Modemarke "Outdoor Voices" vor. Leo Robson denkt über einen alternativen Literaturkanon mit John Williams an der Spitze nach. Hua Hsu hört Songs von Helado Negro. Und Anthony Lane empfiehlt statt des neuesten Marvel-Films Yuri Norsteins 1979 entstandenen Trickfilm "Tale of Tales":
Le Monde diplomatique (Deutschland / Frankreich), 11.03.2019
 Die Politikwissenschaftlerin Julia Buxton kann sich nicht vorstellen, dass Venezuelas Opposition über den Sturz von Präsident Nicolás Maduro hinaus Einigkeit in den eigenen Reihen herstellen könnte. Die Parteien sind zersplittert und zerstritten, schreibt sie. Juan Guaidós Voluntad Popular gehöre zu den kleineren Parteien und genieße wegen ihrer Kompormisslosigkeit, ihrer Nähe zu den USA und ihrer elitären Verfasstheit wenig Rückhalt in der Bevölkerung: "Die Unfähigkeit der Opposition, sich zu einigen, ist Teil ihrer grundsätzlichen Schwäche: Sie hat kein klares politisches Projekt, das die Mehrheit der Venezolaner überzeugen könnte. Der Plan País, der in den USA ausgearbeitet wurde und sich auf Leopoldo López' Buch 'Venezuela Energética' stützt, beschreibt zwar detailliert die Missstände der venezolanischen Ökonomie; über die technische Umsetzung der Pläne zur Wiederbelebung der nationalen Wirtschaft gibt er aber wenig Auskunft. Eine Umstrukturierung von Venezuelas Öl-, Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik durch die von Guaidó ohne weitere Diskussionen ernannten Personen aus dem Umfeld der Voluntad Popular wird - ob Maduro im Amt bleibt oder nicht - die Opposition zersplittern. Da Maduro nach wie vor einen Teil der Bevölkerung hinter sich hat, verhindern das Fortbestehen der inneren Spaltungen, der Hang zum Personalismus und eine Politik des 'Jeder für sich und dem Sieger alles' innerhalb der Opposition eine friedliche Einigung über die Zukunft Venezuelas."
Die Politikwissenschaftlerin Julia Buxton kann sich nicht vorstellen, dass Venezuelas Opposition über den Sturz von Präsident Nicolás Maduro hinaus Einigkeit in den eigenen Reihen herstellen könnte. Die Parteien sind zersplittert und zerstritten, schreibt sie. Juan Guaidós Voluntad Popular gehöre zu den kleineren Parteien und genieße wegen ihrer Kompormisslosigkeit, ihrer Nähe zu den USA und ihrer elitären Verfasstheit wenig Rückhalt in der Bevölkerung: "Die Unfähigkeit der Opposition, sich zu einigen, ist Teil ihrer grundsätzlichen Schwäche: Sie hat kein klares politisches Projekt, das die Mehrheit der Venezolaner überzeugen könnte. Der Plan País, der in den USA ausgearbeitet wurde und sich auf Leopoldo López' Buch 'Venezuela Energética' stützt, beschreibt zwar detailliert die Missstände der venezolanischen Ökonomie; über die technische Umsetzung der Pläne zur Wiederbelebung der nationalen Wirtschaft gibt er aber wenig Auskunft. Eine Umstrukturierung von Venezuelas Öl-, Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik durch die von Guaidó ohne weitere Diskussionen ernannten Personen aus dem Umfeld der Voluntad Popular wird - ob Maduro im Amt bleibt oder nicht - die Opposition zersplittern. Da Maduro nach wie vor einen Teil der Bevölkerung hinter sich hat, verhindern das Fortbestehen der inneren Spaltungen, der Hang zum Personalismus und eine Politik des 'Jeder für sich und dem Sieger alles' innerhalb der Opposition eine friedliche Einigung über die Zukunft Venezuelas."
Außerdem porträtiert Eric Alterman Elliott Abrams, Donald Trumps Sonderbeauftragten für die "Wiederherstellung der Demokratie in Venezuela", als amoralischen Erzschurken: "Mit Ausnahme von Henry Kissinger und Dick Cheney lässt sich schwerlich ein US-Amtsträger finden, der mehr zum Einsatz von Folter und Massenmord im Namen der 'Demokratie' beigetragen hat als Elliott Abrams."
American Scholar (USA), 04.03.2019
 Theodore Gioia macht eine seltsame Beobachtung: In den letzten 25 Jahren wurde klassische Musik zum Markenzeichen des Bösen, des Serienkillers, des Monsters im Hollywoodfilm: "'Du magst Beethoven nicht?' fragt Norman Stansfield in Luc Bessons Film 'Léon: Der Profi' einen zitternden Mann, der er über klassische Ouvertüren verhört, nachdem er zwei seiner Mitbewohner mit einer Schrotflinte abgeschlachtet hat. 'Du bist ein Mozart-Fan?' Die Frage soll das Innenleben eines gestörten Geistes aufzeigen. Der Täter hat die geistige Fähigkeit, musikalische Unterscheidungen zu treffen (Mozart vs. Beethoven), aber keine moralischen. Sein Intellekt - so die Logik dahinter - führt ihn zum Laster, verleitet ihn, die Kunst über die Ethik zu stellen. Das Böse ist ein Nebenprodukt der Intelligenz. Die Implikation ist, dass ästhetische Raffinesse und psychopathische Gewalt derselben Mentalität entspringen, einer dekadenten Hyperintelligenz, die so kultiviert ist, dass sie Mord als ebenso raffiniertes Vergnügen empfindet wie ein Barockcello. Das Abschlachten von Zivilisten und die Würdigung von Vivaldi werden als zwei Formen derselben Psychose ausgestellt".
Theodore Gioia macht eine seltsame Beobachtung: In den letzten 25 Jahren wurde klassische Musik zum Markenzeichen des Bösen, des Serienkillers, des Monsters im Hollywoodfilm: "'Du magst Beethoven nicht?' fragt Norman Stansfield in Luc Bessons Film 'Léon: Der Profi' einen zitternden Mann, der er über klassische Ouvertüren verhört, nachdem er zwei seiner Mitbewohner mit einer Schrotflinte abgeschlachtet hat. 'Du bist ein Mozart-Fan?' Die Frage soll das Innenleben eines gestörten Geistes aufzeigen. Der Täter hat die geistige Fähigkeit, musikalische Unterscheidungen zu treffen (Mozart vs. Beethoven), aber keine moralischen. Sein Intellekt - so die Logik dahinter - führt ihn zum Laster, verleitet ihn, die Kunst über die Ethik zu stellen. Das Böse ist ein Nebenprodukt der Intelligenz. Die Implikation ist, dass ästhetische Raffinesse und psychopathische Gewalt derselben Mentalität entspringen, einer dekadenten Hyperintelligenz, die so kultiviert ist, dass sie Mord als ebenso raffiniertes Vergnügen empfindet wie ein Barockcello. Das Abschlachten von Zivilisten und die Würdigung von Vivaldi werden als zwei Formen derselben Psychose ausgestellt".Elet es Irodalom (Ungarn), 08.03.2019
 Erinnerungspolitik a la Viktor Orban erkennt der Kunsthistoriker József Mélyi anhand der in den letzten zehn Jahren in Budapest aufgestellten Skulpturen und Statuen: "Die öffentlichen Plätze der Budapester Innenstadt tragen bereits eindeutig die Spuren der populistischen Politik. Diese Politik behauptet nichts eindeutig: es entsteht kein neues Mahnmal für die Zwischenkriegszeit, weil sie dann sagen müsste, welche Werte sie vertritt. Sie selbst setzt keine erinnerungspolitischen Akzente im öffentlichen Raum, sie lässt es eher den Vertretern der Vorkriegszeit diese indirekt anzudeuten. Sie schafft nichts Neues, sondern rahmt um, packt ein und vernebelt."
Erinnerungspolitik a la Viktor Orban erkennt der Kunsthistoriker József Mélyi anhand der in den letzten zehn Jahren in Budapest aufgestellten Skulpturen und Statuen: "Die öffentlichen Plätze der Budapester Innenstadt tragen bereits eindeutig die Spuren der populistischen Politik. Diese Politik behauptet nichts eindeutig: es entsteht kein neues Mahnmal für die Zwischenkriegszeit, weil sie dann sagen müsste, welche Werte sie vertritt. Sie selbst setzt keine erinnerungspolitischen Akzente im öffentlichen Raum, sie lässt es eher den Vertretern der Vorkriegszeit diese indirekt anzudeuten. Sie schafft nichts Neues, sondern rahmt um, packt ein und vernebelt."New York Magazine (USA), 04.03.2019
 Peter Bogdanovich war einst der vielleicht am höchsten gehandelte Regisseur am Himmel von New Hollywood - bis einige Flops und taktisch unkluge Entscheidungen seine Karriere de facto zum Erliegen brachten. Auch ein Meister der epischen Interviews mit alternden Hollywood-Größen ist er gewesen - im Herbst seines Lebens ist er nun selbst Gegenstand eines solchen, an Anekdoten und Sottisen reichen Gesprächs, in dem Hollywood einmal mehr als Haifischbecken voller Verrat, Verletzungen und Ehebrüchen erscheint. Unter anderem geht es um Dorothy Stratton, die 1980 von ihrem Ehemann ermordet wurde: Das frühere Playmate spielte in Bogdanovichs "They All Laughed" mit und hatte zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Regisseur eine schon länger andauernde Affäre. Bogdanovich berichtet: "Ich war noch nie so dermaßen am Boden zerstört. Wissen Sie, niemand aus Hollywood hat mich angerufen, als Dorothy ermordet wurde. Niemand, außer den Leuten, die direkt am Film beteiligt waren und sie kannten. Niemand rief mich an außer Cary Grant. Cary war sehr freundlich. ... Später rief ich Bob Fosse an. 'Stimmt das, dass Du einen Film über Dorothy drehst', fragte ich. Er bejahte das, worauf ich ihn fragte: 'Und warum tust Du das?' Er dann: 'Weil das eine gute Geschichte ist.' Und ich: 'Woher zur Hölle weißt Du denn, was hier die Geschichte ist? Ich weiß nicht, was hier die Geschichte ist.' 'Naja, es geht hier nicht um Dich, sondern um sie.' Und ich: 'Das wäre mir völlig egal, wenn es um mich ginge. Völlig egal. Lass es mich mal so ausdrücken, Bob: Wenn Dir das passiert wäre, würde ich keinen Film darüber drehen.' ... Ich musste den Film dann später sehen, weil Nelly darin dargestellt wird. Für mich verwendeten sie einen anderen Namen, also konnte ich nichts dagegen tun. Ich schaute ihn mir aus rechtlichen Gründen an und es war schrecklich. Ich saß da bei Warner alleine im Vorführraum und in der ersten Szene als meine Figur unter anderem Namen auf der Leinwand erscheint, sagt sie: 'Nun, weißt Du denn irgendwas von mir?' Und ich denke mir nur so: 'Okay, Bob, verstanden. Du bist auch nur ein verdammtes Arschloch.' Eifersüchtig, neidisch, zur Hölle mit ihnen allen."
Peter Bogdanovich war einst der vielleicht am höchsten gehandelte Regisseur am Himmel von New Hollywood - bis einige Flops und taktisch unkluge Entscheidungen seine Karriere de facto zum Erliegen brachten. Auch ein Meister der epischen Interviews mit alternden Hollywood-Größen ist er gewesen - im Herbst seines Lebens ist er nun selbst Gegenstand eines solchen, an Anekdoten und Sottisen reichen Gesprächs, in dem Hollywood einmal mehr als Haifischbecken voller Verrat, Verletzungen und Ehebrüchen erscheint. Unter anderem geht es um Dorothy Stratton, die 1980 von ihrem Ehemann ermordet wurde: Das frühere Playmate spielte in Bogdanovichs "They All Laughed" mit und hatte zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Regisseur eine schon länger andauernde Affäre. Bogdanovich berichtet: "Ich war noch nie so dermaßen am Boden zerstört. Wissen Sie, niemand aus Hollywood hat mich angerufen, als Dorothy ermordet wurde. Niemand, außer den Leuten, die direkt am Film beteiligt waren und sie kannten. Niemand rief mich an außer Cary Grant. Cary war sehr freundlich. ... Später rief ich Bob Fosse an. 'Stimmt das, dass Du einen Film über Dorothy drehst', fragte ich. Er bejahte das, worauf ich ihn fragte: 'Und warum tust Du das?' Er dann: 'Weil das eine gute Geschichte ist.' Und ich: 'Woher zur Hölle weißt Du denn, was hier die Geschichte ist? Ich weiß nicht, was hier die Geschichte ist.' 'Naja, es geht hier nicht um Dich, sondern um sie.' Und ich: 'Das wäre mir völlig egal, wenn es um mich ginge. Völlig egal. Lass es mich mal so ausdrücken, Bob: Wenn Dir das passiert wäre, würde ich keinen Film darüber drehen.' ... Ich musste den Film dann später sehen, weil Nelly darin dargestellt wird. Für mich verwendeten sie einen anderen Namen, also konnte ich nichts dagegen tun. Ich schaute ihn mir aus rechtlichen Gründen an und es war schrecklich. Ich saß da bei Warner alleine im Vorführraum und in der ersten Szene als meine Figur unter anderem Namen auf der Leinwand erscheint, sagt sie: 'Nun, weißt Du denn irgendwas von mir?' Und ich denke mir nur so: 'Okay, Bob, verstanden. Du bist auch nur ein verdammtes Arschloch.' Eifersüchtig, neidisch, zur Hölle mit ihnen allen."Außerdem in der aktuellen Ausgabe: Simon van Zuylen-Wood fragt sich, warum sich in Brooklyn und Queens jeder Hipster mittlerweile als Sozialist bezeichnet. Tatsächlich "hat die radikale Linke seit den späten 60er und frühen 70ern keinen solchen Moment mehr erlebt", erklärt der demokratisch-sozialistische Historiker Michael Kazin im flankierenden Interview. "Vielleicht hat dieser Moment sogar noch mehr Potential. Diese frühere Phase war von der Black-Power-Bewegung, der Anti-Kriegs-Bewegung und den Anfängen der schwulen und lesbischen Bewegung bestimmt. Insbesondere die letzten beiden Bewegungen sind bis heute gut aufgestellt. Aber all diese Bewegungen waren eher auf sich bezogene Fragmente als Bestandteil einer größeren, selbstbewussten Linken. Im Gegensatz dazu ist es heute vielversprechend, dass die Linke derzeit offenbar einen Weg findet, sich auf ökonomische Themen zu konzentrieren - den Sozialstaat ausbauen, mehr Gleichberechtigung -, Ziele also, die einen größeren Kreis an Leuten erreichen können."