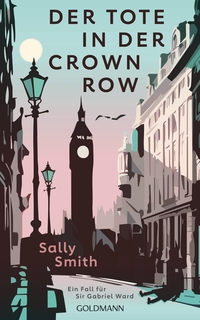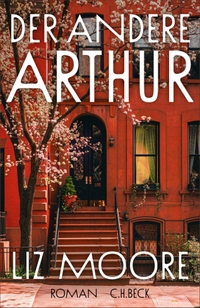Magazinrundschau
Landschaft des Verstehens
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
19.06.2018. Jetzt wird schon mit Hilfe der Virtual Reality Jagd auf Flüchtlinge gemacht, ächzt Wired. Die Republik recherchiert, wie der FC Kreml für sich die Fußball-WM klarmachte. In Magyar Narancs spürt Imre Bartók seinem Widerwillen gegen die Ordnung nach. Der Guardian ermittelt in der Welt der Kunstfälscher. Die New York Times reitet mit John Kidd, dem Gaucho der James-Joyce-Exegese, gegen die Gauleiter der Wirtschaftlichkeit.
New York Times | Wired | Guardian | Intercept | Tablet | Magyar Narancs | Eurozine | New Yorker | Republik | London Review of Books | La regle du jeu
New York Times (USA), 17.06.2018
 Jack Hitt erzählt die bizarre Geschichte des Bostoner Joyce-Experten John Kidd, der auszog, die ultimative Edition des "Ulysses" zu erschaffen - und sich im Klein-Klein eines Akademikerstreits verhedderte, um dann wie vom Erdboden zu verschwinden. Auch wenn Gerüchte intriganter Kollegen Kidd bereits für tot erklärten, fand der Reporter ihn quicklebendig in Rio de Janeiro: "Ich fragte ihn erneut zum perfekten 'Ulysses'. Er war so nah dran. In den 1960er Jahren und noch einmal in den 80ern. Was wurde aus seiner Arbeit in Boston? Warum können wir das Ding nicht einfach herausbringen, selbst, wenn es nicht ganz perfekt ist? Kidd erzählte mir eine Parabel. 'Es gibt die Gauchos und die Gauleiter, meinte er. Es handelt sich um eine gemischte Metapher, aber eine, die Kidds Weltsicht und die der Joyce-Gelehrten ganz gut einfängt. Gauchos waren argentinische Cowboys, Gauleiter waren Gemeinde-Bürokraten im Nationalsozialismus, gefährliche Appartschiks also. Die Gauchos reiten kühn durch die Landschaft des Verstehens. 'Sie schweifen durch die Pampa', so Kidd. Sie kümmern sich um ein riesiges Gebiet, mit dessen Weite sie vertraut sind. Zur gleichen Zeit am Rand der Pampas, in der Zivilisation, da sind die Gauleiter. Sie sind überall, geschäftig, übermächtig. Die Gauchos sind nur wenige, Bilderstürmer wie Kidd oder der vereinzelte Joyce-Fanatiker wie Jorn Barger, ein Universalgelehrter, der viele brillante Analysen zu Joyce auf seinem Weblog veröffentlichte. Aber all das zählt nicht, meint Kidd. Am Ende siegen stets die Gauleiter. Und weshalb? Wegen ihrer verbissenen Sorge um eine 'verwaltungsmäßige Wirtschaftlichkeit'."
Jack Hitt erzählt die bizarre Geschichte des Bostoner Joyce-Experten John Kidd, der auszog, die ultimative Edition des "Ulysses" zu erschaffen - und sich im Klein-Klein eines Akademikerstreits verhedderte, um dann wie vom Erdboden zu verschwinden. Auch wenn Gerüchte intriganter Kollegen Kidd bereits für tot erklärten, fand der Reporter ihn quicklebendig in Rio de Janeiro: "Ich fragte ihn erneut zum perfekten 'Ulysses'. Er war so nah dran. In den 1960er Jahren und noch einmal in den 80ern. Was wurde aus seiner Arbeit in Boston? Warum können wir das Ding nicht einfach herausbringen, selbst, wenn es nicht ganz perfekt ist? Kidd erzählte mir eine Parabel. 'Es gibt die Gauchos und die Gauleiter, meinte er. Es handelt sich um eine gemischte Metapher, aber eine, die Kidds Weltsicht und die der Joyce-Gelehrten ganz gut einfängt. Gauchos waren argentinische Cowboys, Gauleiter waren Gemeinde-Bürokraten im Nationalsozialismus, gefährliche Appartschiks also. Die Gauchos reiten kühn durch die Landschaft des Verstehens. 'Sie schweifen durch die Pampa', so Kidd. Sie kümmern sich um ein riesiges Gebiet, mit dessen Weite sie vertraut sind. Zur gleichen Zeit am Rand der Pampas, in der Zivilisation, da sind die Gauleiter. Sie sind überall, geschäftig, übermächtig. Die Gauchos sind nur wenige, Bilderstürmer wie Kidd oder der vereinzelte Joyce-Fanatiker wie Jorn Barger, ein Universalgelehrter, der viele brillante Analysen zu Joyce auf seinem Weblog veröffentlichte. Aber all das zählt nicht, meint Kidd. Am Ende siegen stets die Gauleiter. Und weshalb? Wegen ihrer verbissenen Sorge um eine 'verwaltungsmäßige Wirtschaftlichkeit'."In der Book Review der New York Times zollt Alan Rusbridger einem Urgestein des Journalismus Tribut. Die Autobiografie des investigativen Reporters Seymour Hersh vom New Yorker hält er für ein eigenes Reportageglanzstück: "Die beharrliche Recherche wird oft als Schuhsohlen-Journalismus bezeichnet - sich die Hacken ablaufen, statt zu googlen. Im Fall von Hersh bedeutete das lange Stunden in Bibliotheken zuzubringen oder auch in letzter Minute in ein Kaff zu fliegen, um einen widerborstigen Zeugen zu jagen. Es hieß, mitten in der Nacht an fremde Türen zu klopfen, zu lernen, Dokumente auf dem Kopf zu lesen, während man vorgab, sich Notizen zu machen, und pensionierte Generäle zu bearbeiten, Empathie zu zeigen, Vertrauen zu gewinnen … Es war hart zu sehen, wie Hershs Berichte von 2014 und 2017 über chemische Kriegsführung in Damaskus von dem britischen Blogger Eliot Higgins auseinandergenommen wurden, der Hershs Beschränkung auf einige wenige ungenannte Quellen kritisierte. Higgins gehört zu einer neuen Art Reporter, enzyklopädisch informiert über die Waffensysteme im Syrien-Konflikt, mit Videomaterial, allerhand Quellen und Satellitenfotos ausgestattet. Hersh nimmt solche Herausforderungen an und spricht von der 'Wahrheit, wie ich sie vorfand'. Die Erschöpfung des 80-Jährigen ist zu spüren, wenn er sagt: 'Ich erlaube der Geschichte gerne, meine jüngere Arbeit zu beurteilen' … Wir brauchen Reporter wie Hersh, Skeptiker, die an nichts einfach so glauben, die den schweren Weg gehen, um unter die Oberfläche von Glanz und Schrott, Täuschung und Manipulation zublicken. 'Wenn deine Mutter sagt, sie liebt dich, überprüf es', nach diesem Motto handelte Hersh … Werden Nachrichtenportale irgendwann noch einmal in der Lage sein, ihren Reportern die Resourcen und die Zeit zur Verfügung zu stellen, um die Art von Arbeit zu machen, wie Hersh sie in seinen besten Zeiten so großartig erbrachte?"
Intercept (USA), 27.05.2018
 In seinem Buch "Mistaken Identity: Race and Class in the Age of Trump" kritisiert der Politologe Asad Haider die unter Linken so beliebte Identitätspolitik, weil sie soziale Bewegungen gegen Unterdrückung eher behindert als fördert. Im Interview mit Rashmee Kumar erklärt er das genauer: Schon der Begriff der Rasse sei ein Produkt des Rassismus, nicht umgekehrt, und er diente im 18. Jahrhundert in Virginia dazu, schwarze und weiße Arbeiter auseinanderzudividieren: "Die erste Kategorie von Rasse, die der weißen Rasse, wurde erfunden, um afrikanische Zwangsarbeiter aus einer Kategorie auszuschließen, in die europäische Zwangsarbeiter eingeordnet wurden: die Knechtschaft der Weißen sollte ein Ende haben können, die Versklavung der Schwarzen sollte lebenslänglich sein. Das ist der Beginn der Einteilung von Menschen in rassische Kategorien in den USA. Rassismus begründete in diesem Fall die Einführung verschiedener Formen der wirtschaftlichen Ausbeutung und wurde schließlich zu einer Form der sozialen Kontrolle, die die Ausgebeuteten durch die Einführung von Hierarchien und Privilegien für einige Menschen spaltete. Dies hinderte sie daran, ein gemeinsames Interesse [zwischen europäischen und afrikanischen Zwangsarbeitern] zu erkennen und eine gemeinsame Front gegen diejenigen aufzubauen, die sie ausbeuten."
In seinem Buch "Mistaken Identity: Race and Class in the Age of Trump" kritisiert der Politologe Asad Haider die unter Linken so beliebte Identitätspolitik, weil sie soziale Bewegungen gegen Unterdrückung eher behindert als fördert. Im Interview mit Rashmee Kumar erklärt er das genauer: Schon der Begriff der Rasse sei ein Produkt des Rassismus, nicht umgekehrt, und er diente im 18. Jahrhundert in Virginia dazu, schwarze und weiße Arbeiter auseinanderzudividieren: "Die erste Kategorie von Rasse, die der weißen Rasse, wurde erfunden, um afrikanische Zwangsarbeiter aus einer Kategorie auszuschließen, in die europäische Zwangsarbeiter eingeordnet wurden: die Knechtschaft der Weißen sollte ein Ende haben können, die Versklavung der Schwarzen sollte lebenslänglich sein. Das ist der Beginn der Einteilung von Menschen in rassische Kategorien in den USA. Rassismus begründete in diesem Fall die Einführung verschiedener Formen der wirtschaftlichen Ausbeutung und wurde schließlich zu einer Form der sozialen Kontrolle, die die Ausgebeuteten durch die Einführung von Hierarchien und Privilegien für einige Menschen spaltete. Dies hinderte sie daran, ein gemeinsames Interesse [zwischen europäischen und afrikanischen Zwangsarbeitern] zu erkennen und eine gemeinsame Front gegen diejenigen aufzubauen, die sie ausbeuten."Tablet (USA), 17.06.2018
Magyar Narancs (Ungarn), 18.06.2018
 Máté Pálos unterhält sich mit dem Schriftsteller Imre Bartók über seinen jüngsten Roman "Jerikó épül" (Jericho wird erbaut), in dem sich Erinnerung, Fiktion und Reflexion stark verweben, über den Trend zur Autofiktion und dessen Galionsfigur Karl Ove Knausgard: "Die Memoiren-Literatur hat eine riesige Tradition, sie ist nicht erst das Produkt der 2010er Jahre. Freilich ist es vorstellbar, dass die Leser nach der wahren Wirklichkeit verlangen in einer Zeit, als diese sich verflüchtigt. Die Persönlichkeit des Schriftstellers und die manische Detailhaftigkeit sollen die Erfahrung verifizieren. Knausgard setzt ganz auf Direktheit, darum ist es einfach, eine Verbindung aufzubauen: Es berührt einen, wenn er ehrlich zugibt, wie sehr er bei einem Rendezvous pinkeln musste, es ihm aber peinlich war auf die Toilette zu gehen - über so etwas schreibt auch Bergman in seiner Autobiografie. Das ist die Strategie der Sitcoms. Bei Knausgard wird dies auf die Spitze getrieben. Es entfaltet eine eigene ästhetische Qualität und hat doch seine Grenzen. Mich interessieren anstelle der Komposition solcher Situationen eher die strukturellen Fragen: was wirkte auf mich als Kind, was und wie hatte (es) eine prägende Kraft auf die Persönlichkeit, worin wurzelt fehlendes Vertrauen, das Fürchten, oder wie entsteht Widerwillen gegenüber jeglicher institutionellen Ordnung."
Máté Pálos unterhält sich mit dem Schriftsteller Imre Bartók über seinen jüngsten Roman "Jerikó épül" (Jericho wird erbaut), in dem sich Erinnerung, Fiktion und Reflexion stark verweben, über den Trend zur Autofiktion und dessen Galionsfigur Karl Ove Knausgard: "Die Memoiren-Literatur hat eine riesige Tradition, sie ist nicht erst das Produkt der 2010er Jahre. Freilich ist es vorstellbar, dass die Leser nach der wahren Wirklichkeit verlangen in einer Zeit, als diese sich verflüchtigt. Die Persönlichkeit des Schriftstellers und die manische Detailhaftigkeit sollen die Erfahrung verifizieren. Knausgard setzt ganz auf Direktheit, darum ist es einfach, eine Verbindung aufzubauen: Es berührt einen, wenn er ehrlich zugibt, wie sehr er bei einem Rendezvous pinkeln musste, es ihm aber peinlich war auf die Toilette zu gehen - über so etwas schreibt auch Bergman in seiner Autobiografie. Das ist die Strategie der Sitcoms. Bei Knausgard wird dies auf die Spitze getrieben. Es entfaltet eine eigene ästhetische Qualität und hat doch seine Grenzen. Mich interessieren anstelle der Komposition solcher Situationen eher die strukturellen Fragen: was wirkte auf mich als Kind, was und wie hatte (es) eine prägende Kraft auf die Persönlichkeit, worin wurzelt fehlendes Vertrauen, das Fürchten, oder wie entsteht Widerwillen gegenüber jeglicher institutionellen Ordnung."Eurozine (Österreich), 08.06.2018
 Ende Mai war der russische Journalist Arkadi Babtschenko in die Schlagzeilen geraten, weil er seine angebliche Ermordung durch den russischen Geheimdienst inszeniert hatte. Ob der Mordplan wirklich existierte, wissen wir nicht. Was wir aber wissen ist, dass Babtschenko immer wieder furchtlos von Russlands Kriegen erzählt hat. Eurozine hat jetzt als Hintergrundinformation ein Interview mit Babtschenko ins Englische übersetzt, das dieser 2008 dem belgischen Magazin La Revue Nouvelle gegeben hatte. Darin spricht er über das, was ihn am meisten geprägt hat: seine Erfahrungen als russischer Soldat im Tschetschenienkrieg: "Die Wahrheit ist, dass Krieg wirklich eine Droge ist, ein Gift, Mist, der in dein Gehirn kriecht, ein Betäubungsmittel. Was auch immer du tust, du darfst nicht davon kosten, denn sobald du das tust, ist dein ganzes Wesen verseucht. Wir haben noch nichts erfunden, das diese Krankheit heilt ... Krieg ist überall eine Droge: Irak, Algerien, Falkland, Afghanistan, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg - alles die gleichen Alpträume. Ich weiß, dass diese Kriege anders sind, aber die Albträume, die den Schlaf ehemaliger Soldaten heimsuchen, sind dieselben: Sie wissen, dass sie töten werden, sie haben Schmetterlinge im Bauch, sie wachen schwitzend auf, sie rufen im Schlaf. In Irland saß ich bei einem Literaturfestival neben einem amerikanischen Ex-Soldaten, der im Irakkrieg war und später Schriftsteller wurde. Als er 'Abu Ghraib' sagte, hörte ich 'Chernokosovo'."
Ende Mai war der russische Journalist Arkadi Babtschenko in die Schlagzeilen geraten, weil er seine angebliche Ermordung durch den russischen Geheimdienst inszeniert hatte. Ob der Mordplan wirklich existierte, wissen wir nicht. Was wir aber wissen ist, dass Babtschenko immer wieder furchtlos von Russlands Kriegen erzählt hat. Eurozine hat jetzt als Hintergrundinformation ein Interview mit Babtschenko ins Englische übersetzt, das dieser 2008 dem belgischen Magazin La Revue Nouvelle gegeben hatte. Darin spricht er über das, was ihn am meisten geprägt hat: seine Erfahrungen als russischer Soldat im Tschetschenienkrieg: "Die Wahrheit ist, dass Krieg wirklich eine Droge ist, ein Gift, Mist, der in dein Gehirn kriecht, ein Betäubungsmittel. Was auch immer du tust, du darfst nicht davon kosten, denn sobald du das tust, ist dein ganzes Wesen verseucht. Wir haben noch nichts erfunden, das diese Krankheit heilt ... Krieg ist überall eine Droge: Irak, Algerien, Falkland, Afghanistan, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg - alles die gleichen Alpträume. Ich weiß, dass diese Kriege anders sind, aber die Albträume, die den Schlaf ehemaliger Soldaten heimsuchen, sind dieselben: Sie wissen, dass sie töten werden, sie haben Schmetterlinge im Bauch, sie wachen schwitzend auf, sie rufen im Schlaf. In Irland saß ich bei einem Literaturfestival neben einem amerikanischen Ex-Soldaten, der im Irakkrieg war und später Schriftsteller wurde. Als er 'Abu Ghraib' sagte, hörte ich 'Chernokosovo'."New Yorker (USA), 19.06.2018
 In der neuen Ausgabe des New Yorker ruft John Lee Anderson die Revolution in Mexiko aus, wo mit Andrés Manuel López Obrador ein neuer eigenwilliger Linkspolitiker gute Chancen auf einen Wahlsieg am 1. Juli hat. Seine Popularität verdankt er vor allem Donald Trump: "Offizielle Stimmen aus dem Regierungslager warnten ihre Kollegen in Washington, dass Trumps offensives Verhalten eine neue, feindselige Regierung in Mexiko ermöglichen könnte, ein Sicherheitsproblem gleich nebenan … In seinen Kampagnen spricht López Obrador allerdings oft vom mexicanismo, sein Äquivalent zu America first. Beobachter sagen, im Wettkampf der beiden Länder tendiert López Obrador dazu, nach innen zu schauen. Mexikos Militärs und Justizbehörden mussten in der Vergangenheit oft dazu überredet werden, mit den USA zusammenzuarbeiten, und López Obrador wird da wohl eher weniger Druck machen. Die USA haben die Regierungspartei dazu bewegt, Mexikos südliche Grenzen gegen Migranten aus Zentralamerika dichtzumachen. López Obrador hat angekündigt, die Einwanderungsbehörde nach Tijuana zu verlegen. 'Die USA wollen, dass wir die Drecksarbeit für sie machen', meint er. Trump möchte aus NAFTA aussteigen, López Obrador setzt auf Selbstversorgung und wird das befürworten. In seiner Kampagne heißt es, er möchte Mexikos Potenzial entwickeln, sodass 'keine Drohung, keine Mauer und keine Tyrannei eines fremden Staates die Mexikaner davon abhalten kann, in ihrem eigenen Land glücklich zu sein'."
In der neuen Ausgabe des New Yorker ruft John Lee Anderson die Revolution in Mexiko aus, wo mit Andrés Manuel López Obrador ein neuer eigenwilliger Linkspolitiker gute Chancen auf einen Wahlsieg am 1. Juli hat. Seine Popularität verdankt er vor allem Donald Trump: "Offizielle Stimmen aus dem Regierungslager warnten ihre Kollegen in Washington, dass Trumps offensives Verhalten eine neue, feindselige Regierung in Mexiko ermöglichen könnte, ein Sicherheitsproblem gleich nebenan … In seinen Kampagnen spricht López Obrador allerdings oft vom mexicanismo, sein Äquivalent zu America first. Beobachter sagen, im Wettkampf der beiden Länder tendiert López Obrador dazu, nach innen zu schauen. Mexikos Militärs und Justizbehörden mussten in der Vergangenheit oft dazu überredet werden, mit den USA zusammenzuarbeiten, und López Obrador wird da wohl eher weniger Druck machen. Die USA haben die Regierungspartei dazu bewegt, Mexikos südliche Grenzen gegen Migranten aus Zentralamerika dichtzumachen. López Obrador hat angekündigt, die Einwanderungsbehörde nach Tijuana zu verlegen. 'Die USA wollen, dass wir die Drecksarbeit für sie machen', meint er. Trump möchte aus NAFTA aussteigen, López Obrador setzt auf Selbstversorgung und wird das befürworten. In seiner Kampagne heißt es, er möchte Mexikos Potenzial entwickeln, sodass 'keine Drohung, keine Mauer und keine Tyrannei eines fremden Staates die Mexikaner davon abhalten kann, in ihrem eigenen Land glücklich zu sein'."Außerdem: Ed Caesar weint der britischen PR-Agentur Bell Pottinger keine Träne nach, die vor allem für Oligarchen und Diktatoren von Assad bis Lukaschenko arbeitete. Zum Verhängnis wurde ihr, dass sie im Auftrag des indischen Gupta-Konzern in Südafrika die gesellschaftlichen Konflikte anheizte: "Die Kampagne, dachte Tony Gupta, würde nicht nur dem Land nützen, sondern auch dem Unternehmen seiner Familie, wenn die Brüder nicht mehr als Oligarchen erschienen, sondern als Außenseiter, die der weißen Vorherrschaft entgegenträten." Amanda Petrusich besucht das jetzt der Öffentlichkeit zugängliche Anwesen des Musikers Prince. Und David Denby sieht Leonard Bernstein mit den Augen seiner Tochter - in der Buchkritik.
Republik (Schweiz), 18.06.2018
London Review of Books (UK), 18.06.2018
 Nicht nur die Putinisten können Korruption, wirft David Runciman ein, auch die Franzosen beherrschen das Metier. Großmeister ist natürlich Michel Platini, der das Votum für Katar klargemacht hat. Laut Runciman waren die um die WM 2022 konkurrierenden Amerikaner davon erbost, dass sie die notorischen Funktionäre wie Jack Warner aus Trinidad haben hochgehen lassen: "Michel Platini, der stellvertretende Chef der Fifa, war vor der Abstimmung 2010 zum Essen im Elysée-Palast mit Präsident Sarkozy und den Abgesandten der königlichen Familie aus Katar. Sarkozy ließ die Katarer wissen, dass der Preis für Platinis Stimme die Unterstützung für seinen Fußballverein sei, der damals in finanziellen Schwierigkeiten war: Paris Saint-Germain. Wunschgemäß kauften die Katarer den Club und investierten in ihn mehrere hundert Millionen (einschließlich die 200 Millionen Pfund, die es kostete, Neymar zu kaufen, den teuersten Spieler der Welt). Katar kaufte auch für über 500 Millionen Pfund pro Jahr die Fernsehrechte für die Spiele der französischen Ligue 1, und Qatar Airways bestellte bei Airbus in Toulouse fünfzig A320. Für die französische Ökonomie in der Region betrug allein der Wert dieses Deals 15 Milliarden Pfund."
Nicht nur die Putinisten können Korruption, wirft David Runciman ein, auch die Franzosen beherrschen das Metier. Großmeister ist natürlich Michel Platini, der das Votum für Katar klargemacht hat. Laut Runciman waren die um die WM 2022 konkurrierenden Amerikaner davon erbost, dass sie die notorischen Funktionäre wie Jack Warner aus Trinidad haben hochgehen lassen: "Michel Platini, der stellvertretende Chef der Fifa, war vor der Abstimmung 2010 zum Essen im Elysée-Palast mit Präsident Sarkozy und den Abgesandten der königlichen Familie aus Katar. Sarkozy ließ die Katarer wissen, dass der Preis für Platinis Stimme die Unterstützung für seinen Fußballverein sei, der damals in finanziellen Schwierigkeiten war: Paris Saint-Germain. Wunschgemäß kauften die Katarer den Club und investierten in ihn mehrere hundert Millionen (einschließlich die 200 Millionen Pfund, die es kostete, Neymar zu kaufen, den teuersten Spieler der Welt). Katar kaufte auch für über 500 Millionen Pfund pro Jahr die Fernsehrechte für die Spiele der französischen Ligue 1, und Qatar Airways bestellte bei Airbus in Toulouse fünfzig A320. Für die französische Ökonomie in der Region betrug allein der Wert dieses Deals 15 Milliarden Pfund."Weiteres: Rosemary Hill sinniert über die Verbindung von Romantik und Wissenschaft bei Lord Byron und seiner Tochter Ada Lovelace. Pankaj Mishra wünscht sich, Amerikas Intellektuelle hätten sich schon über ökonomische Ungleichheit oder die Macht der Konzerne so empört wie über Donald Trump.
La regle du jeu (Frankreich), 15.06.2018
 Dominique Godrèche unterhält sich mit dem Anthropologen Marc Augé über seine Anthropologie des Augenblicks "Bonheurs du jour. Darin geht es weniger um das Glück als solches, dessen Definitionsversuche er für ambitiös und naiv hält, sondern um jene kurzen, einprägsamen Glücksmomente, die er als Glücksgefühle trotz alledem bezeichnet. Diese intensiven Momente, die sich im Gedächtnis verankern, kommen in bestimmten Momenten wieder zum Ausdruck und markieren die Erinnerung. Wenn man etwa im Krankenhaus liegt, denkt man bedauernd an die Zeit, in der man rausgehen und irgendwo einen Kaffee trinken konnte. Einfache Dinge, aber man empfindet doch den Preis, sobald man sie entbehrt, und dass sie zum Gang der Zeit in Beziehung stehen - in der Erinnerung oder im Blick auf die Zukunft - oder zum Raum, sobald man sich an bestimmten Orten befindet. Das scheint mir viel wichtiger zu sein, als all die Studien über Bedingungen des Glücks in den Untersuchungen der UNO."
Dominique Godrèche unterhält sich mit dem Anthropologen Marc Augé über seine Anthropologie des Augenblicks "Bonheurs du jour. Darin geht es weniger um das Glück als solches, dessen Definitionsversuche er für ambitiös und naiv hält, sondern um jene kurzen, einprägsamen Glücksmomente, die er als Glücksgefühle trotz alledem bezeichnet. Diese intensiven Momente, die sich im Gedächtnis verankern, kommen in bestimmten Momenten wieder zum Ausdruck und markieren die Erinnerung. Wenn man etwa im Krankenhaus liegt, denkt man bedauernd an die Zeit, in der man rausgehen und irgendwo einen Kaffee trinken konnte. Einfache Dinge, aber man empfindet doch den Preis, sobald man sie entbehrt, und dass sie zum Gang der Zeit in Beziehung stehen - in der Erinnerung oder im Blick auf die Zukunft - oder zum Raum, sobald man sich an bestimmten Orten befindet. Das scheint mir viel wichtiger zu sein, als all die Studien über Bedingungen des Glücks in den Untersuchungen der UNO."Wired (USA), 11.06.2018
 Palmer Luckey ist der Mann hinter Oculus Rift - ein Gamer, der sich immer stärker in seine Spielwelten versenken wollte und daher ein Virtual-Reality-System entwickelte, das ihm Facebook für viel Geld abgekauft hat. Seitdem machte der gerade mal 25-jährige Neu-Milliardär eher politisch von sich reden: Als Unterstützer der Alt-Right und von Trump, dem er nun beim Bau der Mauer an der Grenze zwischen den USA und Mexiko mit einem Virtual- und Augmented-Reality-System seines Start-Ups Anduril unter die Arme greifen will. Steven Levy hat sich das System übergestülpt und fand sich "im Nu in einer digitalen Welt wieder, die das, was ich eben noch vor Augen hatte, exakt simuliert." Mittels Kameras und eingeblendeten Hinweisen gestattet es das System jedoch, an all jene Orte zu zoomen, an denen sich gerade verdächtige Bewegungen abspielen - und dabei vorab darüber zu informieren, wie wahrscheinlich es ist, dass es sich dabei um einen Menschen oder um ein Tier handelt. "Das System, das ich teste, ist Luckeys Lösungsvorschlag dafür, wie die USA illegale Grenzübertritte registrieren sollte. Sie verschmilzt Virtual-Reality mit Überwachungstools zu einer digitalen Mauer, die nicht so sehr eine Barriere darstellt, sondern vielmehr ein Netz aus allgegenwärtigen Augen, die smart genug sind, um zu wissen, was sie sehen. ... Doch wie sollte man mit den auf diese Weise festgesetzten Leuten verfahren? Was ist mit den Kindern und Eltern, die jetzt auseinander gerissen werden, wenn sie die Grenze überschreiten? Dies sind gesellschaftliche und politische Fragen, keine technologischen Spezifikationen. Doch es verhält sich zunehmend so, dass die Leute, die neue Technologien bauen damit politische Konsequenzen. Auch wenn TechFirmen zuletzt ziemlich einstecken mussten, sind auch jene, die heute besonders in der Kritik stehen, einst aus glühendem Idealismus heraus gegründet worden. Wir träumten einst von einer Zeit, in der ultra-vernetzte und unendliche Möglichkeiten erschließende Technologie jene Probleme lösen würde, derentwegen Leute aus ihren Ländern fliehen oder die terroristische oder militärische Angriffe begünstigen. Doch die Probleme hörten nicht auf. Heute scheint es offensichtlich, dass Technologie uns niemals zu besseren Menschen machen würde. Wir sind noch immer so fehlerbehaftet wie früher. Stattdessen mischt jene Technologie, deren Versprechungen einst so reich waren, heute in allzumenschlichen Zusammenstößen mit - angeführt von einer Firma, die nach einem rächenden Schwert benannt ist."
Palmer Luckey ist der Mann hinter Oculus Rift - ein Gamer, der sich immer stärker in seine Spielwelten versenken wollte und daher ein Virtual-Reality-System entwickelte, das ihm Facebook für viel Geld abgekauft hat. Seitdem machte der gerade mal 25-jährige Neu-Milliardär eher politisch von sich reden: Als Unterstützer der Alt-Right und von Trump, dem er nun beim Bau der Mauer an der Grenze zwischen den USA und Mexiko mit einem Virtual- und Augmented-Reality-System seines Start-Ups Anduril unter die Arme greifen will. Steven Levy hat sich das System übergestülpt und fand sich "im Nu in einer digitalen Welt wieder, die das, was ich eben noch vor Augen hatte, exakt simuliert." Mittels Kameras und eingeblendeten Hinweisen gestattet es das System jedoch, an all jene Orte zu zoomen, an denen sich gerade verdächtige Bewegungen abspielen - und dabei vorab darüber zu informieren, wie wahrscheinlich es ist, dass es sich dabei um einen Menschen oder um ein Tier handelt. "Das System, das ich teste, ist Luckeys Lösungsvorschlag dafür, wie die USA illegale Grenzübertritte registrieren sollte. Sie verschmilzt Virtual-Reality mit Überwachungstools zu einer digitalen Mauer, die nicht so sehr eine Barriere darstellt, sondern vielmehr ein Netz aus allgegenwärtigen Augen, die smart genug sind, um zu wissen, was sie sehen. ... Doch wie sollte man mit den auf diese Weise festgesetzten Leuten verfahren? Was ist mit den Kindern und Eltern, die jetzt auseinander gerissen werden, wenn sie die Grenze überschreiten? Dies sind gesellschaftliche und politische Fragen, keine technologischen Spezifikationen. Doch es verhält sich zunehmend so, dass die Leute, die neue Technologien bauen damit politische Konsequenzen. Auch wenn TechFirmen zuletzt ziemlich einstecken mussten, sind auch jene, die heute besonders in der Kritik stehen, einst aus glühendem Idealismus heraus gegründet worden. Wir träumten einst von einer Zeit, in der ultra-vernetzte und unendliche Möglichkeiten erschließende Technologie jene Probleme lösen würde, derentwegen Leute aus ihren Ländern fliehen oder die terroristische oder militärische Angriffe begünstigen. Doch die Probleme hörten nicht auf. Heute scheint es offensichtlich, dass Technologie uns niemals zu besseren Menschen machen würde. Wir sind noch immer so fehlerbehaftet wie früher. Stattdessen mischt jene Technologie, deren Versprechungen einst so reich waren, heute in allzumenschlichen Zusammenstößen mit - angeführt von einer Firma, die nach einem rächenden Schwert benannt ist."Guardian (UK), 19.06.2018
New York Times | Wired | Guardian | Intercept | Tablet | Magyar Narancs | Eurozine | New Yorker | Republik | London Review of Books | La regle du jeu
Kommentieren