Magazinrundschau
Meistens zeichne ich mit dem Daumen
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
30.06.2009. In der französischen Zeitschrift Books erklärt der Philosoph Joaquin Rodriguez Lopez: Das Internet wird unsere Hirne verwandeln. Im Spectator stellt David Hockney seine IPhone-Bilder vor. In der New York Review of Books fordert der Historiker Timothy Snyder einen neuen Blick auf den Holocaust, der nicht in Auschwitz, sondern in den Wäldern Osteuropas begann. In Literaturen erzählt Aleksandar Hemon, wie man eine Lesung vor sechs Zuhörern in einen Erfolg verwandelt. Dawn stellt den Michael Jackson in jedem Pakistani vor. Kein Ritalin für Kinder!, fordert der Sonderpädagogik-Professor Georg Feuser in der Weltwoche. Die NYT begleitet die schwarze Mittelschicht in Detroit bei ihrem Abstieg.
Books | El Pais Semanal | Prospect | Tygodnik Powszechny | Economist | Weltwoche | Spectator | Frontline | Point | New York Times | New York Review of Books | Literaturen | New Republic | Dawn | Polityka | The Nation | Lettre International | Guardian
Books (Frankreich), 25.06.2009
 Die Literaturzeitschrift Books druckt - zusammen mit dem Nouvel Obs einen Auszug aus dem neuen Buch des spanischen Philosophen Joaquin Rodriguez Lopez, "Edicion 2.0. Socrates en el hiperespacio" (Melusina 2008). Lopez vergleicht den Dialog zwischen Platon und Sokrates, in dem es um Sokrates' Sorge angesichts der Ablösung der rein sprachlichen Wissensvermittlung durch die Einführung der Schrift geht, mit neuen Formen der Wissensvermittlung durch das Internet. Und er untersucht die häufig gestellte Frage: Macht das Internet doof? "Tatsächlich sind die drei Hauptpunkte jedes ernstzunehmenden Artikels heutzutage die gleichen wie bei Sokrates: Gedächtnis, Weitergabe von Wissen und Natur des Wissens. So wie sich Sokrates gegen den geschriebenen Text sperrte, sperren wir uns gegen das Auftauchen des Cyberspace und seiner massenhaften Verwendung. (...) Doch genau wie Sokrates haben wir nicht genügend Abstand, um die laufende Entwicklung wirklich zu verstehen. Der große Philosoph konnte und oder wollte die Überlegenheit der Schrift über das Mündliche nicht erkennen und noch weniger die erheblichen kognitiven Veränderungen voraussehen, die die Erfindung des griechischen Alphabets mit sich brachte; auch uns bleiben nur unser Verdacht und unsere Spekulationen. (...) Dabei ist es sehr wahrscheinlich, dass unser Gehirn im Begriff steht, eine genauso bedeutsame Veränderung zu erfahren wie die aus der Antike bekannte; unsere armen analogen Hirne sind vielleicht dabei, sich in digitale Hirne zu verwandeln."
Die Literaturzeitschrift Books druckt - zusammen mit dem Nouvel Obs einen Auszug aus dem neuen Buch des spanischen Philosophen Joaquin Rodriguez Lopez, "Edicion 2.0. Socrates en el hiperespacio" (Melusina 2008). Lopez vergleicht den Dialog zwischen Platon und Sokrates, in dem es um Sokrates' Sorge angesichts der Ablösung der rein sprachlichen Wissensvermittlung durch die Einführung der Schrift geht, mit neuen Formen der Wissensvermittlung durch das Internet. Und er untersucht die häufig gestellte Frage: Macht das Internet doof? "Tatsächlich sind die drei Hauptpunkte jedes ernstzunehmenden Artikels heutzutage die gleichen wie bei Sokrates: Gedächtnis, Weitergabe von Wissen und Natur des Wissens. So wie sich Sokrates gegen den geschriebenen Text sperrte, sperren wir uns gegen das Auftauchen des Cyberspace und seiner massenhaften Verwendung. (...) Doch genau wie Sokrates haben wir nicht genügend Abstand, um die laufende Entwicklung wirklich zu verstehen. Der große Philosoph konnte und oder wollte die Überlegenheit der Schrift über das Mündliche nicht erkennen und noch weniger die erheblichen kognitiven Veränderungen voraussehen, die die Erfindung des griechischen Alphabets mit sich brachte; auch uns bleiben nur unser Verdacht und unsere Spekulationen. (...) Dabei ist es sehr wahrscheinlich, dass unser Gehirn im Begriff steht, eine genauso bedeutsame Veränderung zu erfahren wie die aus der Antike bekannte; unsere armen analogen Hirne sind vielleicht dabei, sich in digitale Hirne zu verwandeln."New York Review of Books (USA), 16.07.2009
Der in Yale lehrende Historiker Timothy Snyder spricht sich für eine ganz neue Betrachtung des Holocausts aus, denn Auschwitz als sein Symbol verschließe den Blick davor, dass bis 1943, als die meisten westeuropäischen Juden in die Konzentrationslagern deportiert wurden, bereits zwei Drittel aller Juden in Europa tot waren: "Der zweite bedeutende Teil des Holocaust ist der Massenmord durch Kugeln im östlichen Polen und in der Sowjetunion. Es begann mit den Erschießungen jüdischer Männer im Juni 1941 durch SS-Einsatzgruppen, weitete sich im Juli auf die Ermordung jüdischer Frauen und Kinder aus und zielte im August und September auf die Auslöschung ganzer jüdischer Gemeinden. Am Ende des Jahres 1941 hatten die Deutschen (zusammen mit lokalen Helfern und rumänischen Truppen) eine Million Juden in der Sowjetunion und den baltischen Ländern ermordet. Dies entspricht der Zahl aller Juden, die während des gesamten Krieges in Auschwitz ermordet wurden. Bis Ende 1942 hatten die Deutschen noch einmal 700.000 Juden erschossen, und die jüdische Bevölkerung in der besetzten Sowjetunion aufgehört zu existieren."
Außerdem in dieser Sommerausgabe: J.M. Coetzee - "Summertime" - und Claire Messud - "Land Divers" - haben Erzählungen geschickt. Michael Chabon erkundet die "Wildnis der Kindheit" in den Ostküsten-Städten der USA. Besprochen werden Leslie Gelbs Analyse von Barack Obamas Außenpolitik "Power Rules" und Martin Wolfs bereits 2007 geschriebenes, aber offenbar nicht obsolet gewordenes Buch "Fixing Global Finance" sowie die Bostoner Renaissance-Ausstellung zu "Tizian, Tintoretto, Veronese", die im September auch nach Paris kommt.
Außerdem in dieser Sommerausgabe: J.M. Coetzee - "Summertime" - und Claire Messud - "Land Divers" - haben Erzählungen geschickt. Michael Chabon erkundet die "Wildnis der Kindheit" in den Ostküsten-Städten der USA. Besprochen werden Leslie Gelbs Analyse von Barack Obamas Außenpolitik "Power Rules" und Martin Wolfs bereits 2007 geschriebenes, aber offenbar nicht obsolet gewordenes Buch "Fixing Global Finance" sowie die Bostoner Renaissance-Ausstellung zu "Tizian, Tintoretto, Veronese", die im September auch nach Paris kommt.
Literaturen (Deutschland), 01.07.2009
 Frauke Meyer-Gosau schreibt über Aleksandar Hemons von der Kritik gefeierten Roman "Lazarus". In Chicago hat sie auch den Autor getroffen, der freilich eher aus den Niederungen als von den Höhepunkten seiner Aktivitäten als Autor berichtet: "Doch Aleksandar Hemon will lieber von einer 'Lazarus'-Lesung in Kalifornien erzählen, zu der genau sechs Zuhörer erschienen: drei seiner Freunde, eine Holocaust-Forscherin von der Universität und zwei alte Damen, die eigentlich zur Präsentation eines Kochbuchs wollten, doch zu höflich waren, wieder aufzustehen. 'In Deutschland stellt dich ein renommierter Kritiker vor, du brauchst nur zu lesen und dessen Fragen zu beantworten - er steht mit seinem Namen für die Qualität des Buches, und die Leute kaufen es. In Amerika dagegen musst du alles allein machen: die Leute für dich und das Buch interessieren, nett und lustig sein und sie zum Kaufen animieren. - Die beiden Damen, die das Kochbuch kennenlernen wollten, haben 'Lazarus' dann übrigens gekauft.' Also doch ein Erfolg? Hemon grinst und spießt ein Pfannkuchenstück auf."
Frauke Meyer-Gosau schreibt über Aleksandar Hemons von der Kritik gefeierten Roman "Lazarus". In Chicago hat sie auch den Autor getroffen, der freilich eher aus den Niederungen als von den Höhepunkten seiner Aktivitäten als Autor berichtet: "Doch Aleksandar Hemon will lieber von einer 'Lazarus'-Lesung in Kalifornien erzählen, zu der genau sechs Zuhörer erschienen: drei seiner Freunde, eine Holocaust-Forscherin von der Universität und zwei alte Damen, die eigentlich zur Präsentation eines Kochbuchs wollten, doch zu höflich waren, wieder aufzustehen. 'In Deutschland stellt dich ein renommierter Kritiker vor, du brauchst nur zu lesen und dessen Fragen zu beantworten - er steht mit seinem Namen für die Qualität des Buches, und die Leute kaufen es. In Amerika dagegen musst du alles allein machen: die Leute für dich und das Buch interessieren, nett und lustig sein und sie zum Kaufen animieren. - Die beiden Damen, die das Kochbuch kennenlernen wollten, haben 'Lazarus' dann übrigens gekauft.' Also doch ein Erfolg? Hemon grinst und spießt ein Pfannkuchenstück auf." Weitere Artikel: Eva Menasse befasst sich mit einer ganzen Reihe komischer "jüdischer" Romane. Die Schriftstellerin Silke Scheuermann, derzeit Stipendiatin der Villa Massimo, ist "Mitten in" Rom unterwegs. In der Krimi-Kolumne liest Frauke Meyer-Gosau Petros Markaris' neuen Kriminalroman "Die Kinderfrau". In der Rubrik "Was liest..." kommt Antje Ravic Strubel über einer Pizza unter anderem auf Julie Elias und James Baldwin zu sprechen. Aram Lintzel nähert sich dem Niedlichkeits-Fanatismus der Seite Cuteoverload.com. Als "Bücher des Monats" werden Martin Gecks Kurz-Essay-Band "Wenn der Buckelwal in die Oper geht" und Ma Jians Reisebericht "Red Dust. Drei Jahre unterwegs in China" vorgestellt.
New Republic (USA), 15.07.2009
 Hooman Majd, Autor eines Buchs über Achmadinedschad, erzählt von dem Wahlkampf Mussawis (dessen Vergangenheit er nicht idealisiert) - und vom Erkenntnisprozess, den er und Millionen seiner Landsleute nach den Wahlen durchmachten: "Es dauerte vielleicht einen Tag, dann fiel es mir und all den anderen betrogenen Iranern wie Schuppen von den Augen: Natürlich hätten sie niemals irgendjemand anders als Achmadinedschad gewinnen lassen. Darum war sein Wahlkampf so blutleer, darum schien er so wenig über die Terraingewinne der Gegenkandidaten besorgt. Dies war nie vorher geschehen. Die Wahlen im Iran waren immer einigermaßen korrekt. Genau dreißig Jahre sind seit der Revolution vergangen. Die Leute waren nicht wütend über Achmadinedschads Wahlsieg. Sie sind wütend, weil das letzte, was ihnen blieb - das letzte Spurenelement von Demokratie - jetzt bedeutungslos ist."
Hooman Majd, Autor eines Buchs über Achmadinedschad, erzählt von dem Wahlkampf Mussawis (dessen Vergangenheit er nicht idealisiert) - und vom Erkenntnisprozess, den er und Millionen seiner Landsleute nach den Wahlen durchmachten: "Es dauerte vielleicht einen Tag, dann fiel es mir und all den anderen betrogenen Iranern wie Schuppen von den Augen: Natürlich hätten sie niemals irgendjemand anders als Achmadinedschad gewinnen lassen. Darum war sein Wahlkampf so blutleer, darum schien er so wenig über die Terraingewinne der Gegenkandidaten besorgt. Dies war nie vorher geschehen. Die Wahlen im Iran waren immer einigermaßen korrekt. Genau dreißig Jahre sind seit der Revolution vergangen. Die Leute waren nicht wütend über Achmadinedschads Wahlsieg. Sie sind wütend, weil das letzte, was ihnen blieb - das letzte Spurenelement von Demokratie - jetzt bedeutungslos ist." Außerdem verweist Abbas Milani (mehr hier) auf die politisch-religiösen Wurzeln der Demokratiebewegung, und Eli Lake erzählt, "was unsere Spione nicht wissen".
Dawn (Pakistan), 26.06.2009
Michael Jackson hatte riesigen Einfluss auf die pakistanische Jugend - nicht nur als er selbst, sondern auch in diversen Anverwandlungen, schreibt Huma Yusuf. "Man muss den Pakistanis vergeben, dass sie Michael Jackson verinnerlicht haben, schließlich haben sie immer eine doppelte Dosis Jackson bekommen. Der originale MJ schlug uns in seinen Bann, er verzaubert uns mit seinen Musikvideos und magischen Beats. Aber wir haben ihn wirklich zu einem von uns gemacht, nachdem Bollywood sich das beste, was Jackson zu bieten hatte, angeeignet und ihn damit so desi gemacht hatte wie Tee, Samosa und arrangierte Ehen. (...) Meiner Ansicht nach erhärtete Jackson seinen Status als Superstar, als Amitabh Bachchan einen silbernen Handschuh überstreifte, den Moonwalk versuchte (bei Minute 2.44) und die Damen warnte, 'dance dikhaon ga aisa, Michael Jackson ke jaisa'. 1989 nahm Sridevis MJs 'Bad' und machte es 'badder' mit 'Main Hoon Bad Girl'. 'Thriller' war nie mehr dasselbe, nachdem das tamilische Kino sich rotem Leder zugewandt und ein Goli in das Herz dessen gejagt hatte, was Jacko zum Größten von allen machte."
Polityka (Polen), 29.06.2009
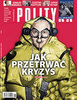 Zehn Jahre nach dem Tod des Theaterregisseurs Jerzy Grotowski erzählt der Theaterwissenschaftler und Grotowski-Forscher Leszek Kolankiewicz im Interview (hier auf Deutsch), warum es praktisch unmöglich geworden ist, einen neuen Zugang zum Werk Grotowskis zu finden: Der Erbe, Thomas Richards, hat den Zugang zum Nachlass stark eingeschränkt. Grotowski selbst hat das so gewollt: "Diese Kontrolle resultierte wohl aus seinem Charakter, aus dem Bedürfnis, zu dominieren und die Dinge im Griff zu behalten. Es hing auch mit seinen gnostischen Neigungen zusammen. Im Innersten seiner Seele war Grotowski der Meinung, dass die Geschichte eine Abfolge von Inkarnationen des Bösen ist und dass wir nur dann irgendeinen Freiheitsraum erobern, wenn es uns gelingt, Herr über die Geschichte, zumindest über unsere persönliche, zu werden. Darüber hinaus verband sich bei Grotowski der Gnostiker mit dem Künstler – jemandem, der leicht einer Inflation des Ich unterliegt. Im Ergebnis behauptete er gegen Ende seines Lebens, über die Geschichte triumphiert zu haben. Um diesen Triumph vollständig zu machen, hat er nicht nur Aufzeichnungen seiner öffentlichen Auftritte untersagt, sondern er kontrollierte auch die Publikationen und Übersetzungen seiner Texte, sogar die Publikationen und Übersetzungen von Büchern, die von seinen Mitarbeitern geschrieben waren."
Zehn Jahre nach dem Tod des Theaterregisseurs Jerzy Grotowski erzählt der Theaterwissenschaftler und Grotowski-Forscher Leszek Kolankiewicz im Interview (hier auf Deutsch), warum es praktisch unmöglich geworden ist, einen neuen Zugang zum Werk Grotowskis zu finden: Der Erbe, Thomas Richards, hat den Zugang zum Nachlass stark eingeschränkt. Grotowski selbst hat das so gewollt: "Diese Kontrolle resultierte wohl aus seinem Charakter, aus dem Bedürfnis, zu dominieren und die Dinge im Griff zu behalten. Es hing auch mit seinen gnostischen Neigungen zusammen. Im Innersten seiner Seele war Grotowski der Meinung, dass die Geschichte eine Abfolge von Inkarnationen des Bösen ist und dass wir nur dann irgendeinen Freiheitsraum erobern, wenn es uns gelingt, Herr über die Geschichte, zumindest über unsere persönliche, zu werden. Darüber hinaus verband sich bei Grotowski der Gnostiker mit dem Künstler – jemandem, der leicht einer Inflation des Ich unterliegt. Im Ergebnis behauptete er gegen Ende seines Lebens, über die Geschichte triumphiert zu haben. Um diesen Triumph vollständig zu machen, hat er nicht nur Aufzeichnungen seiner öffentlichen Auftritte untersagt, sondern er kontrollierte auch die Publikationen und Übersetzungen seiner Texte, sogar die Publikationen und Übersetzungen von Büchern, die von seinen Mitarbeitern geschrieben waren."The Nation (USA), 13.07.2009
 Der Musikwissenschaftler David Schiff bespricht den vierten Band von Henry-Louis de la Granges (mehr hier) gigantischer Biografie über Gustav Mahler (über 1700 Seiten für die letzten vier Jahre des Konponisten), geht aber kaum darauf ein. Zitierenswert an seinem Artikel ist der erste Absatz, der ziemlich genau das heutige Mahler-Bild auf den Punkt bringt: "Gesättigt mit Lacrimosa-Melodien, Trauermarschrhythmen und dem geisterhaften Umtata tragischer Walzer trauern die Sinfonien und Lieder Gustav Mahlers prophetisch um die Opfer der Katastrophen des 20. Jahrhunderts - die der Komponist wegen seines frühen Todes gar nicht miterleben und vielleicht nicht einmal vorausahnen konnte. So zumindest klingt sein Werk heute für uns, in deren Geist es sich vermischt mit Musik über jene Katastrophen von Komponisten, die er beeinflusste: Alban Berg, Dmitri Schostakowitsch, Benjamin Britten, Leonard Bernstein."
Der Musikwissenschaftler David Schiff bespricht den vierten Band von Henry-Louis de la Granges (mehr hier) gigantischer Biografie über Gustav Mahler (über 1700 Seiten für die letzten vier Jahre des Konponisten), geht aber kaum darauf ein. Zitierenswert an seinem Artikel ist der erste Absatz, der ziemlich genau das heutige Mahler-Bild auf den Punkt bringt: "Gesättigt mit Lacrimosa-Melodien, Trauermarschrhythmen und dem geisterhaften Umtata tragischer Walzer trauern die Sinfonien und Lieder Gustav Mahlers prophetisch um die Opfer der Katastrophen des 20. Jahrhunderts - die der Komponist wegen seines frühen Todes gar nicht miterleben und vielleicht nicht einmal vorausahnen konnte. So zumindest klingt sein Werk heute für uns, in deren Geist es sich vermischt mit Musik über jene Katastrophen von Komponisten, die er beeinflusste: Alban Berg, Dmitri Schostakowitsch, Benjamin Britten, Leonard Bernstein." Außerdem in einer insgesamt interessanten Nummer: Die Schriftstellerin Katha Pollitt findet es doch etwas erstaunlich, dass Barack Obama in der Passage seiner Kairoer Rede über Freuenrechte ausschließlich über das Recht sprach, Kopftuch zu tragen, aber nicht über das Recht es abzulegen. Der iranische Journalist Babak Sarfaraz (Pseudonym) macht sich noch einmal Gedanken über die Khamenei-Rede vom 19. Juni. Und der Kritiker Benjamin Lytal stellt in seinem sehr ausführlichen Artikel Hans Fallada vor.
Lettre International (Deutschland), 01.07.2009
 Ein Schwerpunkt der Lettre ist der Avantgarde gewidmet. Eduardo Subirats beschreibt in seiner Kritik der Avantgarde, wie sie die Autonomie der Kunst beseitigt hat, um jene "in die absolute Wahrheit der industriellen Produktion und des kapitalistischen Spektakels" zu integrieren: "Deshalb verteidigten die Futuristen den industriellen Krieg; deshalb stellte sich Dsiga Wertow in den Dienst der Propaganda des sowjetischen Staates; deshalb ordnete Le Corbusier die architektonische Form den Bedürfnissen der industriellen Produktion und Expansion in der Dritten Welt unter... Die Dialektik der Avantgarden kulminierte in einem instrumentellen Formbegriff, dem sogenannten Funktionalismus, der zum totalen Ordnungsprinzip erhoben wurde. Damit erfüllte sie das romantische Ideal des totalen Kunstwerks und kehrte zugleich seinen Sinn um. Ihr Ziel war nun nicht die Integration der Künste, um den künstlerischen Ausdruck einer Epoche zu erreichen, sondern ihre Eingliederung in eine neue universelle, antiästhetische Semantik. Die letzte politische Konsequenz der Dialektik der Avantgarden ist totalitär." (Hier das spanische Original)
Ein Schwerpunkt der Lettre ist der Avantgarde gewidmet. Eduardo Subirats beschreibt in seiner Kritik der Avantgarde, wie sie die Autonomie der Kunst beseitigt hat, um jene "in die absolute Wahrheit der industriellen Produktion und des kapitalistischen Spektakels" zu integrieren: "Deshalb verteidigten die Futuristen den industriellen Krieg; deshalb stellte sich Dsiga Wertow in den Dienst der Propaganda des sowjetischen Staates; deshalb ordnete Le Corbusier die architektonische Form den Bedürfnissen der industriellen Produktion und Expansion in der Dritten Welt unter... Die Dialektik der Avantgarden kulminierte in einem instrumentellen Formbegriff, dem sogenannten Funktionalismus, der zum totalen Ordnungsprinzip erhoben wurde. Damit erfüllte sie das romantische Ideal des totalen Kunstwerks und kehrte zugleich seinen Sinn um. Ihr Ziel war nun nicht die Integration der Künste, um den künstlerischen Ausdruck einer Epoche zu erreichen, sondern ihre Eingliederung in eine neue universelle, antiästhetische Semantik. Die letzte politische Konsequenz der Dialektik der Avantgarden ist totalitär." (Hier das spanische Original)Außerdem: Tzvetan Todorov untersucht das Verhältnis der Avantgarde zur Diktatur (Auszug) und beschreibt auch, wie ihr Fundamentalismus und der Wille, aus dem Nichts zu schaffen, auch den Majakowski und Marinetti zusammengeführt hat: "Die beiden werden sich am 20. Juni 1925 in Paris erneut treffen und zusammen essen. Ihre Dolmetscherin ist beunruhigt: Worüber könnten ein Bolschewik und ein Faschist reden? Das Treffen verläuft jedoch offenbar in einer vollkommen freundschaftlichen Atmosphäre."
Und Philip Gourevitch berichtet aus Ruanda über die schwierige Versöhnungspolitik fünfzehn Jahre nach dem Völkermord. Begegnet ist er etwa dem genocidaire Jean Girumuhatse, der von einem Gacaca-Gericht zu elf Jahren Gefängnis verurteilt worden war und nun in sein Dorf zurückgekehrt ist. (Auszug auf Deutsch, hier das Original aus dem New Yorker als pdf)
Guardian (UK), 25.06.2009
 James Buchan empfiehlt, noch einmal Ahmad Kasravis Buch "History of the Iranian Constitutional Revolution" von 1921 zu lesen, das daran erinnert, wie hart und lang die Iraner schon gegen ihre Kleriker für Demokratie kämpfen, nämlich seit 1905, als eine Volksbewegung versuchte, die Monarchie zu stürzen: "In diesem dicken Buch, erzählt Kasravi auf 905 Seiten in der besten persisichen Ausgabe, wie die 1905 spontan gebildete Allianz aus Klerus und Bazar, Handwerkern und Intellektuellen wieder auseinander fiel, als den schiitischen Klerikern die Konsequenzen aufklärerischer Ideen bewusst wurden. Sie waren schockiert, als sie erfuhren, dass Selbstbestimmung auch das Recht miteinschloss, nicht zu beten, und Gleichheit sich auch auf Juden, Christen und Zoroastrier bezog. Kurz gesagt, das neue Parlament würde nicht nur göttliches Recht interpretieren und einführen, sondern tatsächlich Muslimen ein neues Recht geben."
James Buchan empfiehlt, noch einmal Ahmad Kasravis Buch "History of the Iranian Constitutional Revolution" von 1921 zu lesen, das daran erinnert, wie hart und lang die Iraner schon gegen ihre Kleriker für Demokratie kämpfen, nämlich seit 1905, als eine Volksbewegung versuchte, die Monarchie zu stürzen: "In diesem dicken Buch, erzählt Kasravi auf 905 Seiten in der besten persisichen Ausgabe, wie die 1905 spontan gebildete Allianz aus Klerus und Bazar, Handwerkern und Intellektuellen wieder auseinander fiel, als den schiitischen Klerikern die Konsequenzen aufklärerischer Ideen bewusst wurden. Sie waren schockiert, als sie erfuhren, dass Selbstbestimmung auch das Recht miteinschloss, nicht zu beten, und Gleichheit sich auch auf Juden, Christen und Zoroastrier bezog. Kurz gesagt, das neue Parlament würde nicht nur göttliches Recht interpretieren und einführen, sondern tatsächlich Muslimen ein neues Recht geben."John Harris trauert Lester Bangs, Greil Marcus und anderen großen Musik-Autoren hinterher, die leider von niemandem beerbt wurden. Was aber nicht am Internet und seinen unprofessionellen Bloggern liege: "Dieser Wandel ist, glaube ich, Ausdruck der großen kulturellen Beruhigung, die mit dem Ende des Kalten Kriegs einsetzte, als selbst die interessanteren Aspekte der Pop-Kultur ihren aufständischen Auftrag zu verlieren begannen. Die Tage, da Musik die soziopolitischen Strömungen ihrer Zeit gänzlich verkörpern konnte - da also Rock im Wesentlichen die Pop-Kultur war -, sind vorbei, vielleicht für immer. Die Art neurotischer Großmäuler, die nicht nur Lennon, Bowie, Rotten und andere hervorgebracht hat, sondern auch die edelsten Schreiber von Creem und NME, scheint ziemlich ausgestorben zu sein."
Weiteres: Die pakistansiche Autorin Kamila Shamsie bricht eine Lanze für Google, das sie unter anderem gelehrt hat, wie Nagasaki vor dem Atombomben-Abwurf aussah, wie amerikanische Truppen in Afghanistan kämpfen und wie man eine AK-47 auseinander nimmt. Und Hari Kunzru wandert etwas schwermütig durch die Ausstellung "Radical Nature" im Londoner Barbican Museum.
El Pais Semanal (Spanien), 28.06.2009
Auch Javier Cercas macht sich Gedanken über das Zeitungssterben: "Die Zeitungen sind in der Krise, heißt es, so wie das ganze Land, sie werden verschwinden, oder wenigstens wird es sie so, wie wir sie kennen, nicht mehr geben, sie werden künftig reine Luxusartikel sein - vor allem die Journalisten selbst sagen das. Keine Ahnung - ich weiß nur, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, eines Tages auf die Straße zu gehen und die Zeitung nicht kaufen zu können. Ich zwinge mich mit einer gewaltigen Anstrengung dazu, es mir trotzdem vorzustellen, und ich sehe mich dabei auf einen Schlag uralt werden und habe das Gefühl, dass das dann zwar nicht das Ende der Welt ist, dass es aber, wenigstens für uns alle, deren Verstand einst mithilfe der Zeitung ins Erwachsenenalter eingetreten ist und die wir, als Schriftsteller, eigentlich viel mehr als durch Homer, Dante oder Shakespeare durch die Zeitungslektüre beeinflusst wurden, das Ende unserer Welt bedeutet."
Prospect (UK), 01.07.2009
 Ähnlich wie hierzulande ARD und ZDF ist auch die britische BBC als steuerfinanzierter Sender unter Druck. Nicht zuletzt in der Frage, wie sehr sie sich im Internet engagieren darf, ohne den Wettbewerb zu gefährden. Im hoch interessanten exklusiven Prospect-Online-Gespräch schildert BBC-Generaldirektor Mark Thompson die Lage so: "Alle waren von der Geschwindigkeit überrascht, mit der die BBC die neuen Strukturen wie Internet, Handy, On-Demand und so weiter zu nutzen verstand - und auch vom vergleichsweise großen Erfolg, mit dem wir es taten. Das liegt zum Teil daran, dass die Lizenzbeträge im digitalen Kontext ein erfolgreiches Businessmodell sind, während andere Refinanzierungsformen sich als extrem problematisch erweisen. Tatsächlich sind die Lizenzgebühren heute im Digitalzeitalter eine so sinnvolle Sache wie nie zuvor in der BBC-Geschichte.... Wenn Sie sich die erfolgreichsten und meistbesuchten Websites in Großbritannien ansehen, dann sind wir hinter Google und Microsoft die Nummer drei. Wir sind der einzige britische Name bis weit jenseits der Top Ten."
Ähnlich wie hierzulande ARD und ZDF ist auch die britische BBC als steuerfinanzierter Sender unter Druck. Nicht zuletzt in der Frage, wie sehr sie sich im Internet engagieren darf, ohne den Wettbewerb zu gefährden. Im hoch interessanten exklusiven Prospect-Online-Gespräch schildert BBC-Generaldirektor Mark Thompson die Lage so: "Alle waren von der Geschwindigkeit überrascht, mit der die BBC die neuen Strukturen wie Internet, Handy, On-Demand und so weiter zu nutzen verstand - und auch vom vergleichsweise großen Erfolg, mit dem wir es taten. Das liegt zum Teil daran, dass die Lizenzbeträge im digitalen Kontext ein erfolgreiches Businessmodell sind, während andere Refinanzierungsformen sich als extrem problematisch erweisen. Tatsächlich sind die Lizenzgebühren heute im Digitalzeitalter eine so sinnvolle Sache wie nie zuvor in der BBC-Geschichte.... Wenn Sie sich die erfolgreichsten und meistbesuchten Websites in Großbritannien ansehen, dann sind wir hinter Google und Microsoft die Nummer drei. Wir sind der einzige britische Name bis weit jenseits der Top Ten." Weiteres: John Lloyd hat die eigentliche Titelgeschichte über die verzwickte Lage der BBC verfasst. Kamran Nazeer erkennt in neuen Romanen aus den USA viel ostküstenclicquenhafte Selbstbezüglichkeit - lobt aber Tod Wodicka sehr, der damit nichts zu tun hat. Die Autorin Monica Ali erzählt, wie sie für ihren neuen Roman "In the Kitchen" ausgiebig in Londoner Hotels recherchierte. Einen rachegeschichtengesättigten Cannes-Jahrgang resümiert Mark Cousins. Tom Chatfield stellt den chinesischen Suchmaschinen-Riesen Baidu vor. Edward Marriott lässt sich von Mike Brearley, Ex-Kapitän der englischen Cricket-Nationalmannschaft, heute Psychoanalytiker, erklären, warum es sowohl Cricket als auch die Psychoanalyse in unserer tempoversessenen Gegenwart schwer haben.
Tygodnik Powszechny (Polen), 28.06.2009
 Oft werde er im Ausland gefragt, wie es in Polen um den Nationalismus steht, schreibt der Publizist Ryszard Holzer. Dabei werde der Begriff in die Nähe von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit u.ä. gerückt, und auch in Polen selbst werde er eher pejorativ verstanden. Doch Holzer gesteht: "Ich bin ein Nationalist. Denn es geht mich wirklich etwas an, welche Rolle meine Nation und mein Staat in 50, 60 oder 70 Jahren in der Welt spielen wird - in Zeiten also, die ich selbst bei größtem medizinischen Fortschritt nicht erleben werde. Und das begreife ich als Nationalismus: eine so tiefe Identifikation mit der eigenen Nation und dem Staat, dass man einen Teil der persönlichen Ambitionen und Träume auf die Gemeinschaft überträgt."
Oft werde er im Ausland gefragt, wie es in Polen um den Nationalismus steht, schreibt der Publizist Ryszard Holzer. Dabei werde der Begriff in die Nähe von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit u.ä. gerückt, und auch in Polen selbst werde er eher pejorativ verstanden. Doch Holzer gesteht: "Ich bin ein Nationalist. Denn es geht mich wirklich etwas an, welche Rolle meine Nation und mein Staat in 50, 60 oder 70 Jahren in der Welt spielen wird - in Zeiten also, die ich selbst bei größtem medizinischen Fortschritt nicht erleben werde. Und das begreife ich als Nationalismus: eine so tiefe Identifikation mit der eigenen Nation und dem Staat, dass man einen Teil der persönlichen Ambitionen und Träume auf die Gemeinschaft überträgt."Joachim Trenkner fuhr ins deutsch-polnische Grenzland und sieht eine schleichende Revolution - fernab politischer Diskussionen Berlins und Warschaus reift das Bewusstsein für Gemeinsamkeiten, und auch über die teilende Geschichte wird anders gesprochen. "Hausherr zu sein bedeutet auch, die dunklen Kapitel seiner Wohnorte zu kennen", zitiert er den Journalisten und Aktivisten Robert Ryss. "Beschämende oder kontroverse Themen sollten lieber mit eigenen Händen entdeckt werden, weil es sonst jemand auswärtiges macht, vielleicht mit bösen Absichten. Über dunkle Kapitel der Geschichte zu sprechen, schwächt nicht unsere Identität oder unseren Patriotismus, sondern stärkt sie", sagt der Chefredakteur einer Lokalzeitung.
Economist (UK), 26.06.2009
 Das neue Akropolis-Museum in Athen ist ein starkes Argument für die Rückkehr der Elgin-Marbles an Griechenland. Aber nicht stark genug, meint der Economist, der stattdessen vorschlägt, dass Griechenland die jüngsten internationalen Bemühungen um verstärkte Leih- und Austauschaktionen akzeptieren sollte: "Die Alternative ist die zwischen einer freien Zirkulation der Schätze und einem Patt, bei dem jedes Museum das an sich krallt, was es als sein Eigentum behauptet. Statt große Töne zu spucken sollte der griechische Kulturminister das Britische Museum herausfordern und eine Ausleihe fordern. Die nervösen Briten müssten sich darauf wenigstens teilweise einlassen und zum Beispiel ein Stück des Parthenon-Frieses nach Athen schicken. Rücken die Griechen es nicht wieder raus: Na gut. Falls aber doch, dann ließe sich das Leihprogramm ausweiten."
Das neue Akropolis-Museum in Athen ist ein starkes Argument für die Rückkehr der Elgin-Marbles an Griechenland. Aber nicht stark genug, meint der Economist, der stattdessen vorschlägt, dass Griechenland die jüngsten internationalen Bemühungen um verstärkte Leih- und Austauschaktionen akzeptieren sollte: "Die Alternative ist die zwischen einer freien Zirkulation der Schätze und einem Patt, bei dem jedes Museum das an sich krallt, was es als sein Eigentum behauptet. Statt große Töne zu spucken sollte der griechische Kulturminister das Britische Museum herausfordern und eine Ausleihe fordern. Die nervösen Briten müssten sich darauf wenigstens teilweise einlassen und zum Beispiel ein Stück des Parthenon-Frieses nach Athen schicken. Rücken die Griechen es nicht wieder raus: Na gut. Falls aber doch, dann ließe sich das Leihprogramm ausweiten." Besprochen werden neue Bücher zur Finanzkrise, ein Band, in dem sich Werner Herzog an die Dreharbeiten zu "Fitzcarraldo" erinnert. Der Nachruf gilt Lord Ralf Dahrendorf. Auf der Titelseite ist übrigens unter der Überschrift "Die geheimnisvolle Frau Merkel" die deutsche Bundeskanzlerin zu sehen - der Artikel dazu ist hier, außerdem noch eine Analyse mit dem Titel "Die Botschaft heißt: Merkel".
Weltwoche (Schweiz), 25.06.2009
 Das Ruhigstellen besonders quirliger Kindern mittels Ritalin ist ein Verbrechen, ruft der Sonderpädagogik-Professor Georg Feuser im Interview: "Ich hatte an einem Freitag Eltern in meinem Büro sitzen, die fragten: 'Was sollen wir machen, der Lehrer hat gesagt, wenn unser Kind am Montag nicht Ritalin nimmt, fliegt es aus der Schule." So weit geht das. Es gibt Stimmen aus der neurowissenschaftlichen Forschung, die warnen. Kinderhirne sind in Entwicklung. Eine Langzeitbehandlung könnte Defizite im dopaminergen System zur Folge haben, und es könnte eine massive Zunahme von Parkinson-Erkrankungen resultieren. Von 1990 bis 1997 ist die Produktion von Ritalin von 2,8 auf 13,5 Tonnen pro Jahr gestiegen. Das ist eines der einträglichsten Geschäfte für die Pharmaindustrie. Rechnen Sie das mal in Gewinnmargen um! Heute werden schon ein, zwei oder drei Kinder pro Primarklasse mit Ritalin versorgt. Damit ist eine ungeheure Geschäftemacherei verbunden. Und dies vor dem Hintergrund, dass man noch nahezu nichts Zuverlässiges weiß. Die massenhafte Verordnung von Ritalin gehört aus meiner Sicht verboten. Es ist ein Verbrechen an der Menschheit."
Das Ruhigstellen besonders quirliger Kindern mittels Ritalin ist ein Verbrechen, ruft der Sonderpädagogik-Professor Georg Feuser im Interview: "Ich hatte an einem Freitag Eltern in meinem Büro sitzen, die fragten: 'Was sollen wir machen, der Lehrer hat gesagt, wenn unser Kind am Montag nicht Ritalin nimmt, fliegt es aus der Schule." So weit geht das. Es gibt Stimmen aus der neurowissenschaftlichen Forschung, die warnen. Kinderhirne sind in Entwicklung. Eine Langzeitbehandlung könnte Defizite im dopaminergen System zur Folge haben, und es könnte eine massive Zunahme von Parkinson-Erkrankungen resultieren. Von 1990 bis 1997 ist die Produktion von Ritalin von 2,8 auf 13,5 Tonnen pro Jahr gestiegen. Das ist eines der einträglichsten Geschäfte für die Pharmaindustrie. Rechnen Sie das mal in Gewinnmargen um! Heute werden schon ein, zwei oder drei Kinder pro Primarklasse mit Ritalin versorgt. Damit ist eine ungeheure Geschäftemacherei verbunden. Und dies vor dem Hintergrund, dass man noch nahezu nichts Zuverlässiges weiß. Die massenhafte Verordnung von Ritalin gehört aus meiner Sicht verboten. Es ist ein Verbrechen an der Menschheit."Spectator (UK), 26.06.2009
 Der britische Maler David Hockney lebte lange Zeit in Kalifornien, vor einigen Jahren ist er allerdings wieder nach Yorkshire zurückgekehrt, genauer gesagt nach Bridlington. Dort hat ihn Martin Gayford nach seinen neuen iPhone-Bildern befragt und Folgendes herausgefunden: "Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich die Technik entwickelt hatte", sagt Hockney. "Meistens zeichne ich mit dem Daumen. Ich habe gemerkt dass das großartige Vorteile bietet. Die Technik lässt einen mutig werden, und das ist ziemlich toll." Am schönsten sei das Licht ihn Bridlington "von 5.15 Uhr, wenn die Sonne schon ein bisschen draußen ist und die ersten Schatten erscheinen, bis ungefähr 8.30 Uhr. Die meisten Leute verschlafen das. Ich wache beim ersten Licht des Tages auf und mache kleine Zeichnungen von der Dämmerung, während ich noch im Bett bin." Hier ein Beispiel von Hockneys iPhone-Frühsport. Hockney male aber auch noch konventionell, schreibt Gayford, und zwar mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Ein Bild pro Tag sei keine Seltenheit.
Der britische Maler David Hockney lebte lange Zeit in Kalifornien, vor einigen Jahren ist er allerdings wieder nach Yorkshire zurückgekehrt, genauer gesagt nach Bridlington. Dort hat ihn Martin Gayford nach seinen neuen iPhone-Bildern befragt und Folgendes herausgefunden: "Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich die Technik entwickelt hatte", sagt Hockney. "Meistens zeichne ich mit dem Daumen. Ich habe gemerkt dass das großartige Vorteile bietet. Die Technik lässt einen mutig werden, und das ist ziemlich toll." Am schönsten sei das Licht ihn Bridlington "von 5.15 Uhr, wenn die Sonne schon ein bisschen draußen ist und die ersten Schatten erscheinen, bis ungefähr 8.30 Uhr. Die meisten Leute verschlafen das. Ich wache beim ersten Licht des Tages auf und mache kleine Zeichnungen von der Dämmerung, während ich noch im Bett bin." Hier ein Beispiel von Hockneys iPhone-Frühsport. Hockney male aber auch noch konventionell, schreibt Gayford, und zwar mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Ein Bild pro Tag sei keine Seltenheit. Frontline (Indien), 20.06.2009
 Was 1986 als eine Initiative gegen die unwürdige Praxis begann, die indischen Dalit Toiletten per Hand entleeren zu lassen, hat sich zur gesamtindischen Bewegung der Safai Karamchari Andolan (SKA) entwickelt, berichtet Ajoy Ashirwad Mahaprashasta. Im Mai dieses Jahres errang SKA ein wegweisendes Gerichtsurteil, als der Oberste Gerichtshof entschied, die Bundesbehörden für das - inzwischen offiziell verbotene (mehr hier) - manuelle Toilettenleeren haftbar zu machen. "Mangels einer starken Arbeiterbewegung im Land, erweist sich die SKA als großer Motor für die Dalits, sich zusammenzuschließen und ihre Stimme zu erheben gegen die Unterdrückung, die ihnen mit ihren Jobs zuteil wurden, die die Gesellschaft als Arbeit bezeichnet. Bezwada Wilson, eine Vertreterin der SKA sagt: 'Wir halten die manuelle Entsorgung von Exkrementen nicht für eine Arbeit. Es ist eine Frage der Würde. Keine mir bekannte Zivilisation hat eine solche Aufgabe einer bestimmten Gemeinschaft zugewiesen, wie dies in Indien der Fall ist. Wir wollen nicht nur diese Praxis bekämpfen, sondern auch das Kastendenken in der indischen Gesellschaft.'"
Was 1986 als eine Initiative gegen die unwürdige Praxis begann, die indischen Dalit Toiletten per Hand entleeren zu lassen, hat sich zur gesamtindischen Bewegung der Safai Karamchari Andolan (SKA) entwickelt, berichtet Ajoy Ashirwad Mahaprashasta. Im Mai dieses Jahres errang SKA ein wegweisendes Gerichtsurteil, als der Oberste Gerichtshof entschied, die Bundesbehörden für das - inzwischen offiziell verbotene (mehr hier) - manuelle Toilettenleeren haftbar zu machen. "Mangels einer starken Arbeiterbewegung im Land, erweist sich die SKA als großer Motor für die Dalits, sich zusammenzuschließen und ihre Stimme zu erheben gegen die Unterdrückung, die ihnen mit ihren Jobs zuteil wurden, die die Gesellschaft als Arbeit bezeichnet. Bezwada Wilson, eine Vertreterin der SKA sagt: 'Wir halten die manuelle Entsorgung von Exkrementen nicht für eine Arbeit. Es ist eine Frage der Würde. Keine mir bekannte Zivilisation hat eine solche Aufgabe einer bestimmten Gemeinschaft zugewiesen, wie dies in Indien der Fall ist. Wir wollen nicht nur diese Praxis bekämpfen, sondern auch das Kastendenken in der indischen Gesellschaft.'" Point (Frankreich), 25.06.2009
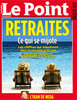 Mit dem Mantra "Egal, was passiert" buchstabiert Bernard-Henri Levy in seinen Bloc-notes die Konsequenzen durch, die die Proteste in Teheran haben werden. "Egal, was passiert, in Teheran wird nichts mehr sein wie vorher. (...) Egal, was passiert, das Volk weiß von nun an, dass es das Volk ist und keine Macht der Welt lässt sich gegen das Volk aufrecht halten. Egal, was passiert, in der Hitze der friedlichen Demonstrationen hat sich ein politischer Körper gebildet, und selbst wenn er zu flüstern und zu stagnieren scheint, selbst wenn die Mörder meinen, jubilieren zu können, ist er ein neuer Akteur, der die Bühne betreten hat und ohne den es keine Fortschreibung der Geschichte des Landes geben wird. (…) Egal, was passiert, der Kaiser ist nackt. Egal, was passiert, das Regime der Ayatollahs ist über kurz oder lang dazu verurteilt, Kompromisse einzugehen oder zu verschwinden. (...) Die Erde in Teheran bebt, und das ist, jede Wette, erst der Anfang."
Mit dem Mantra "Egal, was passiert" buchstabiert Bernard-Henri Levy in seinen Bloc-notes die Konsequenzen durch, die die Proteste in Teheran haben werden. "Egal, was passiert, in Teheran wird nichts mehr sein wie vorher. (...) Egal, was passiert, das Volk weiß von nun an, dass es das Volk ist und keine Macht der Welt lässt sich gegen das Volk aufrecht halten. Egal, was passiert, in der Hitze der friedlichen Demonstrationen hat sich ein politischer Körper gebildet, und selbst wenn er zu flüstern und zu stagnieren scheint, selbst wenn die Mörder meinen, jubilieren zu können, ist er ein neuer Akteur, der die Bühne betreten hat und ohne den es keine Fortschreibung der Geschichte des Landes geben wird. (…) Egal, was passiert, der Kaiser ist nackt. Egal, was passiert, das Regime der Ayatollahs ist über kurz oder lang dazu verurteilt, Kompromisse einzugehen oder zu verschwinden. (...) Die Erde in Teheran bebt, und das ist, jede Wette, erst der Anfang."New York Times (USA), 28.06.2009
 Für eine dieser monumentalen Reportagen, die sich die amerikanischen Medien bewundernswerter Weise immer noch leisten, trifft Jonathan Mahler einige General-Motors-Arbeiter in der zerfallenden Stadt Detroit. Meistens sind sie schwarz, und ihre eigenen Existenzen stehen so sehr auf dem Spiel wie die der Firma: "Autoarbeiter stellen immer noch den größten Anteil an der verbliebenen schwarzen Mittelschicht, aber ihre Anzahl sinkt schnell. Im letzten Jahr wurden 20.000 schwarze Autoarbeiter der Big Three entweder entlassen oder abgefunden. Wenn die Übriggebliebenen ihre Jobs verlieren und ihre Häuser zwangsvollstreckt werden - Detroit hat hier eine der höchsten Raten -, müssen sie anderswo hinziehen, auf der Suche nach einem neuen Job. Dann sind die Tage dieser Stadt wirklich gezählt."
Für eine dieser monumentalen Reportagen, die sich die amerikanischen Medien bewundernswerter Weise immer noch leisten, trifft Jonathan Mahler einige General-Motors-Arbeiter in der zerfallenden Stadt Detroit. Meistens sind sie schwarz, und ihre eigenen Existenzen stehen so sehr auf dem Spiel wie die der Firma: "Autoarbeiter stellen immer noch den größten Anteil an der verbliebenen schwarzen Mittelschicht, aber ihre Anzahl sinkt schnell. Im letzten Jahr wurden 20.000 schwarze Autoarbeiter der Big Three entweder entlassen oder abgefunden. Wenn die Übriggebliebenen ihre Jobs verlieren und ihre Häuser zwangsvollstreckt werden - Detroit hat hier eine der höchsten Raten -, müssen sie anderswo hinziehen, auf der Suche nach einem neuen Job. Dann sind die Tage dieser Stadt wirklich gezählt."
Books | El Pais Semanal | Prospect | Tygodnik Powszechny | Economist | Weltwoche | Spectator | Frontline | Point | New York Times | New York Review of Books | Literaturen | New Republic | Dawn | Polityka | The Nation | Lettre International | Guardian
Kommentieren












