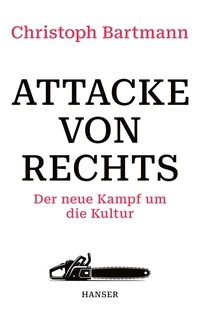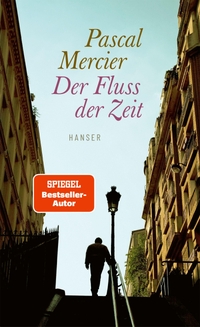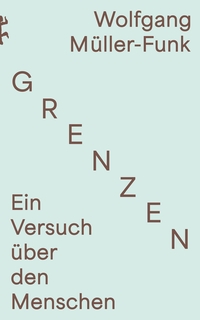Magazinrundschau
Paul Berman: reactionary turn in der intellektuellen Welt
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
New Republic (USA), 28.05.2007
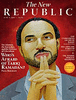 Paul Berman publiziert einen riesenhaften Essay über Tariq Ramadan. Er stellt all die Fragen, die Ian Buruma nicht oder nur oberflächlich in seinem Ramadan-Porträt für die New York Times gestellt hat. Berman hat nicht mit Ramadan gesprochen, aber er hat seine Bücher gelesen. Mit großer Geduld und Genauigkeit (ausgedruckt hat der Artikel 47 Seiten!) geht er Hinweisen, Widersprüchen und Interpretationsmöglichkeiten nach. Am Ende kommt er auch auf die vom Perlentaucher und signandsight.com lancierte Bruckner-Buruma-Debatte zu sprechen. Berman konstatiert einen "reactionary turn in der intellektuellen Welt" und spricht damit einige Autoren an, die gegen Ayaan Hirsi Ali polemisierten: "Eine Kampagne wie die gegen Hirsi Ali hätte noch vor ein paar Jahren niemals stattfinden können. Eine anhaltende Attacke auf eine authentische liberale Dissidentin, die gegen Ungerechtigkeiten in abgelegenen Teilen der Welt und sogar den Hinterhöfen Westeuropas protestiert, eine anhaltende Attacke, die fast schon die Erwähnung der Unterdrückung von Frauen und den Kampf für Frauenrechte aus der Diskussion ausradiert - nein, das hätte noch gestern nicht passieren können, außer bei der extremen Rechten. Das ist ein neues Ereignis."
Paul Berman publiziert einen riesenhaften Essay über Tariq Ramadan. Er stellt all die Fragen, die Ian Buruma nicht oder nur oberflächlich in seinem Ramadan-Porträt für die New York Times gestellt hat. Berman hat nicht mit Ramadan gesprochen, aber er hat seine Bücher gelesen. Mit großer Geduld und Genauigkeit (ausgedruckt hat der Artikel 47 Seiten!) geht er Hinweisen, Widersprüchen und Interpretationsmöglichkeiten nach. Am Ende kommt er auch auf die vom Perlentaucher und signandsight.com lancierte Bruckner-Buruma-Debatte zu sprechen. Berman konstatiert einen "reactionary turn in der intellektuellen Welt" und spricht damit einige Autoren an, die gegen Ayaan Hirsi Ali polemisierten: "Eine Kampagne wie die gegen Hirsi Ali hätte noch vor ein paar Jahren niemals stattfinden können. Eine anhaltende Attacke auf eine authentische liberale Dissidentin, die gegen Ungerechtigkeiten in abgelegenen Teilen der Welt und sogar den Hinterhöfen Westeuropas protestiert, eine anhaltende Attacke, die fast schon die Erwähnung der Unterdrückung von Frauen und den Kampf für Frauenrechte aus der Diskussion ausradiert - nein, das hätte noch gestern nicht passieren können, außer bei der extremen Rechten. Das ist ein neues Ereignis."Trouw (Niederlande), 26.05.2007
 "Neigen Frauen stärker als Männer zum Desperadotum?" fragt die Soziologin Jolande Withuis in ihrem Essay "Leiden, streiten, heilig werden" über radikale Musliminnen. Deren Motivation sieht sie im Versprechen völliger Hingabe. "Der Glaube bietet radikalen Musliminnen eine 'totale' Identität, die sich nicht auf bestimmte Gelegenheiten beschränkt und die schwerer wiegt als alles andere. Das verlangt Anstrengung und Verzicht, bietet im Gegenzug aber auch Befriedigung und Seelenruhe. Langweilige oder lästige Vorschriften - sich bedecken, nicht alles essen dürfen - werden zu einer Quelle des Selbstbewusstseins. Es geht ihnen wie einer Magersüchtigen, die Befriedigung aus der Überwindung ihres Hungers zieht, auch wenn sie damit ihrer Gesundheit schadet. So beschäftigen sich diese Frauen bis zur Lächerlichkeit mit der Frage, welche Dinge 'haram' oder 'halal' sind - das füllt ihre Zeit und gibt ihnen das wohltuende Gefühl eines sinnvollen Lebens."
"Neigen Frauen stärker als Männer zum Desperadotum?" fragt die Soziologin Jolande Withuis in ihrem Essay "Leiden, streiten, heilig werden" über radikale Musliminnen. Deren Motivation sieht sie im Versprechen völliger Hingabe. "Der Glaube bietet radikalen Musliminnen eine 'totale' Identität, die sich nicht auf bestimmte Gelegenheiten beschränkt und die schwerer wiegt als alles andere. Das verlangt Anstrengung und Verzicht, bietet im Gegenzug aber auch Befriedigung und Seelenruhe. Langweilige oder lästige Vorschriften - sich bedecken, nicht alles essen dürfen - werden zu einer Quelle des Selbstbewusstseins. Es geht ihnen wie einer Magersüchtigen, die Befriedigung aus der Überwindung ihres Hungers zieht, auch wenn sie damit ihrer Gesundheit schadet. So beschäftigen sich diese Frauen bis zur Lächerlichkeit mit der Frage, welche Dinge 'haram' oder 'halal' sind - das füllt ihre Zeit und gibt ihnen das wohltuende Gefühl eines sinnvollen Lebens." Außerdem: Onno Blom (mehr hier) porträtiert den Schriftsteller und frischgebackenen Preisträger des "P.C. Hooftprijs" Maarten Biesheuvel, in dessen Nachbarschaft er aufwuchs. "Biesheuvel war bei uns Schulkindern eine Berühmtheit. Wenn er gute Laune hatte, konnte eigentlich alles passieren. Er konnte auf der Straße laut ein Lied von Schumann anstimmen oder sich auf die Motorhaube eines Autos legen um zu horchen 'ob es die Zylinder noch tun'. Eines Tages kam er uns entgegen und fragte mit seiner typisch nasalen Stimme höflich, ob uns der Sinn nach 'einem Glas Ranja' stünde. Das ließen wir uns nicht zweimal fragen, es hieß nämlich, dass der Schriftsteller und seine Frau eine Ziege besäßen, die bei ihnen im Wohnzimmer lebe. Biesheuvel sagte nur 'Kommt mit, ich stelle Euch ihr vor.'"
New Yorker (USA), 04.06.2007
 Peter Schjeldahl hat sich die Neo-Rauch-Ausstellung im New Yorker Metropolitan Museum of Art angesehen und versucht, aus den Bildern schlau zu werden. Meisterlich gemalt, gewiss. Aber gibt es irgendeine Bedeutung? "Die stilistischen Echos in den Bildern zu entziffern, bringt nicht viel. Je näher man die gelehrten Anspielungen in der Ausstellung betrachtet (zum Beispiel die Attitüden und Dresscodes aus der deutschen Romantik des 19. Jahrhunderts, die einige Figuren in den Gemälden an den Tag legen), desto tiefer die Enttäuschung beim Versuch, ihnen Sinn abzugewinnen. Wenn Rauchs Werk alptraumhaft ist, wie manche Kritiker behaupten, dann nicht wegen der Dramen, die es erzählt, sondern weil es sich über jede Art des Verstehens lustig macht. Es ist nicht rätselhaft, denn Rätsel implizieren Lösungen. Eher sagt es, dass wir vieles wissen, aber dass dieses Wissen fruchtlos ist. In diesem Sinne versetzt dieses Werk uns einen sehr zeitgenössischen Stich." Viel Rauch um nichts, sozusagen?
Peter Schjeldahl hat sich die Neo-Rauch-Ausstellung im New Yorker Metropolitan Museum of Art angesehen und versucht, aus den Bildern schlau zu werden. Meisterlich gemalt, gewiss. Aber gibt es irgendeine Bedeutung? "Die stilistischen Echos in den Bildern zu entziffern, bringt nicht viel. Je näher man die gelehrten Anspielungen in der Ausstellung betrachtet (zum Beispiel die Attitüden und Dresscodes aus der deutschen Romantik des 19. Jahrhunderts, die einige Figuren in den Gemälden an den Tag legen), desto tiefer die Enttäuschung beim Versuch, ihnen Sinn abzugewinnen. Wenn Rauchs Werk alptraumhaft ist, wie manche Kritiker behaupten, dann nicht wegen der Dramen, die es erzählt, sondern weil es sich über jede Art des Verstehens lustig macht. Es ist nicht rätselhaft, denn Rätsel implizieren Lösungen. Eher sagt es, dass wir vieles wissen, aber dass dieses Wissen fruchtlos ist. In diesem Sinne versetzt dieses Werk uns einen sehr zeitgenössischen Stich." Viel Rauch um nichts, sozusagen? Weitere Artikel: Jeffrey Gobin beschreibt die Verwirrung bei den Republikanern im Weißen Haus. Zu lesen sind unter der Überschrift "Wie ich den Krieg verbrachte. Ein Rekrut in der Waffen-SS" 13 Seiten Günter Grass. Gary Giddins porträtiert den Jazz-Pianisten Hank Jones. Louis Menand bespricht Michael Ondaatjes Roman "Divisadero". Anthony Lane sah im Kino "Knocked Up" von Judd Apatow und befindet, dass die beste Vorstellung im dritten Teil der Piraten-Serie "Pirates of the Caribbean: Am Ende der Welt" ein Affe gibt. Lesen dürfen wir außerdem die Erzählung "Faith" von William Trevor und Lyrik von David Baker, Elizabeth Macklin und Marvin Bell.
Literaturen (Deutschland), 01.06.2007
 Der Schwerpunkt des Juni-Hefts von Literaturen ist dem Thema "Italienische Reise" gewidmet. Online ist dazu ein Interview mit dem Literaturwissenschaftler Dieter Richter zu lesen, in dem er über die Wahrnehmung der Großstadt Neapel bei Italienreisenden des 18. und 19. Jahrhunderts spricht: "Neapel war immer die schönste Stadt Italiens, einige hielten sie sogar für die schönste Stadt der Welt; gleichzeitig hatte sie eine unheimliche und dämonische Seite. Die Kurtisanen in Neapel galten als die verführerischsten, noch in Reiseberichten des 19. Jahrhunderts kann man lesen, die Frauen seien den Fremden gegenüber 'geneigter'. In Marquis de Sades 'Juliette' reist eine kleine Gruppe durch Kampanien, und eine der Damen setzt die langweiligen Landschaften des Nordens gegen die 'wunderwürdige' und 'verbrecherische' Natur der Vesuv-Gegend. Die kampanische Natur evoziert die Leidenschaften, das gesellschaftlich Verdrängte. August von Platen hat es sehr genossen, dass er in Neapel Knaben und Männer finden konnte, ohne bestraft zu werden."
Der Schwerpunkt des Juni-Hefts von Literaturen ist dem Thema "Italienische Reise" gewidmet. Online ist dazu ein Interview mit dem Literaturwissenschaftler Dieter Richter zu lesen, in dem er über die Wahrnehmung der Großstadt Neapel bei Italienreisenden des 18. und 19. Jahrhunderts spricht: "Neapel war immer die schönste Stadt Italiens, einige hielten sie sogar für die schönste Stadt der Welt; gleichzeitig hatte sie eine unheimliche und dämonische Seite. Die Kurtisanen in Neapel galten als die verführerischsten, noch in Reiseberichten des 19. Jahrhunderts kann man lesen, die Frauen seien den Fremden gegenüber 'geneigter'. In Marquis de Sades 'Juliette' reist eine kleine Gruppe durch Kampanien, und eine der Damen setzt die langweiligen Landschaften des Nordens gegen die 'wunderwürdige' und 'verbrecherische' Natur der Vesuv-Gegend. Die kampanische Natur evoziert die Leidenschaften, das gesellschaftlich Verdrängte. August von Platen hat es sehr genossen, dass er in Neapel Knaben und Männer finden konnte, ohne bestraft zu werden."Franz Schuh liest für seine Kriminal-Kolumne Max Bronskis "München Blues" - und auch wenn der Rezensent München nicht mag, "Bronski ist ein witziger Autor. Er hat Einfälle, die nicht mit sich selbst protzen, sondern tatsächlich ein Licht auf Sachverhalte und Lebensumstände werfen". Der Schriftsteller Feridun Zaimoglu berichtet auf der Beiseite enthusiasmiert von Roberto Bolanos Roman "Chilenisches Nachtstück", ein Buch, das er so sehr liebt, dass er es "beißen möchte, um es zu schmecken und zu spüren". Manuela Reichart stellt die erst sehr schöne, dann etwas ermüdende Literaturverfilmung "Valley of Flowers" vor. In seiner Netzkarte hat sich Aram Lintzel mit der Wikipedia-Parodie stupidipedia.org nicht sonderlich amüsiert. Hilal Sezgin bespricht die von Christina von Braun und Bettina Mathes verfasste kulturwissenschaftliche Studie über das Kopftuch mit dem Titel "Verschleierte Wirklichkeit". In seiner Kritik zu zwei neuen Büchern über die Gegenwartskunst bedauert Wolfgang Ullrich, dass deren Autoren Jörg Heiser und Piroschka Dossi nicht kapiert haben, dass der Preis längst konstitutiver Bestandteil des Gegenwartskunstwerks ist.
Guardian (UK), 26.05.2007
 Naseem Khan hat Tariq Ramadans Buch über Mohammed, "The Messenger", gelesen und scheint zufrieden. Nur gelegentlich vermisst er klare Aussagen: "Für meinen Geschmack ist er zu subtil und kryptisch, wenn es darum geht, ein Licht auf gegenwärtige muslimische Fragen zu werfen. Die Tatsache, dass Mohammed den Schleier allein für seine Frauen und nicht als generelles Edikt vorschrieb, wird erwähnt, aber nicht ausgeführt. Und aus regelmäßigen Bemerkungen über rechtschaffene Frauen, die in der Öffentlichkeit aktiv sind, müssen Leser ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Dschihad ist streng als innerer Kampf definiert, während qital (der bewaffnete Widerstand gegen Unterdrückung) als eine zweite Form des Dschihad identifiziert wird. Beide jedoch, argumentiert Ramadan, 'können, wenn man den Verführungen des eigenen Selbst und der Neigung des Menschen zum Krieg widersteht, zum Frieden führen'."
Naseem Khan hat Tariq Ramadans Buch über Mohammed, "The Messenger", gelesen und scheint zufrieden. Nur gelegentlich vermisst er klare Aussagen: "Für meinen Geschmack ist er zu subtil und kryptisch, wenn es darum geht, ein Licht auf gegenwärtige muslimische Fragen zu werfen. Die Tatsache, dass Mohammed den Schleier allein für seine Frauen und nicht als generelles Edikt vorschrieb, wird erwähnt, aber nicht ausgeführt. Und aus regelmäßigen Bemerkungen über rechtschaffene Frauen, die in der Öffentlichkeit aktiv sind, müssen Leser ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Dschihad ist streng als innerer Kampf definiert, während qital (der bewaffnete Widerstand gegen Unterdrückung) als eine zweite Form des Dschihad identifiziert wird. Beide jedoch, argumentiert Ramadan, 'können, wenn man den Verführungen des eigenen Selbst und der Neigung des Menschen zum Krieg widersteht, zum Frieden führen'." Al Ahram Weekly (Ägypten), 25.05.2007
 Nachdem sie für ihre zahlreichen Attentate mehrere Jahren im Gefängnis gesessen hatten, gaben führende Mitglieder der islamistischen Al-Gamaa Al-Islamiya (die einst Sadat ermorden ließ) ihr politisches Debüt. Abdel-Moneim Said blickt befremdet auf die Vorstellungen der Partei von der Demokratie, die kein politisches System der Gewaltenteilung sei, sondern vor allem zur öffentliche Kontrolle darüber dienen soll, dass die Scharia auch richtig angewendet wird. Auch sonst vermisst Said einiges im Programm der Partei: "Wozu sie bisher noch überhaupt nicht Stellung bezogen bezogen hat, sind die Probleme des Landes. Al-Gamaa hat nichts zu Bildung, Gesundheit oder Verwaltung zu sagen. Soll das Land eher zentral oder dezentral geführt werden? Wir können wir unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöhen? Die Mitglieder von Al-Gamaa sind besessen davon, den islamischen Dresscode enzuhalten, die Kopten unter Druck zu setzen und gegen den Westen zu kämpfen. Haben sie nicht mehr zu sagen?"
Nachdem sie für ihre zahlreichen Attentate mehrere Jahren im Gefängnis gesessen hatten, gaben führende Mitglieder der islamistischen Al-Gamaa Al-Islamiya (die einst Sadat ermorden ließ) ihr politisches Debüt. Abdel-Moneim Said blickt befremdet auf die Vorstellungen der Partei von der Demokratie, die kein politisches System der Gewaltenteilung sei, sondern vor allem zur öffentliche Kontrolle darüber dienen soll, dass die Scharia auch richtig angewendet wird. Auch sonst vermisst Said einiges im Programm der Partei: "Wozu sie bisher noch überhaupt nicht Stellung bezogen bezogen hat, sind die Probleme des Landes. Al-Gamaa hat nichts zu Bildung, Gesundheit oder Verwaltung zu sagen. Soll das Land eher zentral oder dezentral geführt werden? Wir können wir unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöhen? Die Mitglieder von Al-Gamaa sind besessen davon, den islamischen Dresscode enzuhalten, die Kopten unter Druck zu setzen und gegen den Westen zu kämpfen. Haben sie nicht mehr zu sagen?"Nehad Selaiha stellt einen sehr interessanten Theaterautor vor, "Mustafa Saad, der einzige Theaterautor, den ich kenne, dessen Stücke einzig und allein den Zweck haben, seine Theorie, was Theater sein und tun soll, zu dramatisieren. Sein 'Masrah Al-Istifham' (Theatre of Enquiry), dessen gerade gespieltes Stück '3-1' die elfte und extremste Illustration seiner Theorie ist, begreift das Theater als gemeinsame Aktivität. Die Zuschauer sollen zum kritischen Denken bewegt werden, sie sollen das, was sie sehen, hinterfragen und ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. In seinen Anmerkungen zu dem Stück schreibt Saad: 'Nach Jahren der Untersuchung und Befragung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass unser Problem in der arabischen Welt (ob als Subjekte oder Herrscher) nicht das Fehlen guter Theorien ist oder ihr Missbrauch, sondern die Art, wie wir durch unsere Erziehung programmiert sind immer nur zu wiederholen, was Tradition und Autoritäten uns beigebracht haben. Deshalb tendieren wir dazu, in Klischees zu sprechen, unsere Probleme einfach nur zu wiederholen, statt sie zu analysieren und selbst eine Lösung zu finden."
Economist (UK), 25.05.2007
 Auch wenn Michael Moore eine populistische Nervensäge ist - die Diskussion um das amerikanische Gesundheitssystem könnte er mit seinem jüngsten Film "Sicko" wieder anheizen, räumt der Economist ein und resümiert noch einmal Moores jüngste Aktionen: "Wie man es von ihm kennt, hat Michael Moore wieder Publicity-Coups gelandet, auf die der Zirkusmann P.T. Barnum stolz gewesen wäre. Er nahm für seinen Film Männer, die bei den Aufräumarbeiten auf Ground Zero geholfen hatten, hinterher aber keine Gesundheitsversorgung erhielten, nach Kuba. Zuerst versuchte er, ihnen in der Militärbasis von Guantanamo Bay Hilfe zu beschaffen - schließlich rühmen sich die Offiziellen damit, dass die Al-Quaida-Häftlinge gesundheitlich hervorragend versorgt werden, und auch noch umsonst. Er wurde zurückgewiesen und ging mit der Gruppe dann nach Havanna, wo die kubanischen Behörden nur zu gerne fast unentgeltliche Hilfe boten."
Auch wenn Michael Moore eine populistische Nervensäge ist - die Diskussion um das amerikanische Gesundheitssystem könnte er mit seinem jüngsten Film "Sicko" wieder anheizen, räumt der Economist ein und resümiert noch einmal Moores jüngste Aktionen: "Wie man es von ihm kennt, hat Michael Moore wieder Publicity-Coups gelandet, auf die der Zirkusmann P.T. Barnum stolz gewesen wäre. Er nahm für seinen Film Männer, die bei den Aufräumarbeiten auf Ground Zero geholfen hatten, hinterher aber keine Gesundheitsversorgung erhielten, nach Kuba. Zuerst versuchte er, ihnen in der Militärbasis von Guantanamo Bay Hilfe zu beschaffen - schließlich rühmen sich die Offiziellen damit, dass die Al-Quaida-Häftlinge gesundheitlich hervorragend versorgt werden, und auch noch umsonst. Er wurde zurückgewiesen und ging mit der Gruppe dann nach Havanna, wo die kubanischen Behörden nur zu gerne fast unentgeltliche Hilfe boten."Weitere Artikel: Besprochen wird eine Biografie des italienischen Freiheitshelden Giuseppe Garibaldi. Vorgestellt werden neue Forschungsergebnisse zum Thema Synästhesie. Nicht schlecht staunt der Economist über neue statistische Zahlen, die die ungeheure Beliebtheit von Scrapbooks (Einklebebüchern) in den USA demonstrieren. Außerdem berichtet er darüber, dass die Scheidungsrate in den gehobenen Schichten der USA sinkt, während sie am unteren Ende der Gesellschaft steigt. Der Titelschwerpunkt widmet sich dem israelisch-palästinensischen Sechstagekrieg, der sich jetzt zum vierzigsten Mal jährt: Ein Artikel befasst sich mit "Israels verschenktem Sieg", ein anderer fragt nach der Lage "Vierzig Jahre danach".
Point (Frankreich), 24.05.2007
Bernard Kouchner, der Gründer von Medecins sans frontieres, als Außenminister - das ist als hätte man einen Neuen Philsophen auf den Posten gesetzt. In seinem Bloc-notes setzt Bernard-Henri Levy darum seine Hoffnungen auf den neuen Mann: "Und wenn er nur eine Sache fertigbringen würde, wenn er die Islamisten von Khartum zur Vernunft bringen und ihre chinesischen Alliierten einknicken lassen würde, indem er sie mit einem Boykott der Olympischen Spiele von 2008 bedrohen würde - er hätte schon gewonnen."
Weltwoche (Schweiz), 24.05.2007
 Franziska K. Müller hat sich im eigentlich exklusiven Nobelinternat Le Rosey am Genfersee umgetan. Hier wird den Erbfolgern der Aga Khans, al-Fayeds oder Rockefellers Fleiß, Disziplin und tadelloses Benehmen beigebracht, damit sie nicht in der Glamourgosse enden, wie Paris Hilton. "Jugendlichem Sturm und Drang beugt die Internatsleitung mit einem lückenlosen Beschäftigungsprogramm vor, kritischen Gedanken zum Weltgeschehen mit dem Verzicht auf Tageszeitungen, Fernsehen und politische Diskussionen. Mit 'Underground' bringen die flausenlosen Teenager allenfalls die unterirdische Kirche in Verbindung. Kämpfen sie für nichts? Doch: für Gleichberechtigung in der Nutella-Frage. Der süße Brotaufstrich war bisher den Mädchen vorbehalten. Und dafür, dass in naher Zukunft nicht mehr die Schüler, sondern das Personal die Mahlzeiten serviert."
Franziska K. Müller hat sich im eigentlich exklusiven Nobelinternat Le Rosey am Genfersee umgetan. Hier wird den Erbfolgern der Aga Khans, al-Fayeds oder Rockefellers Fleiß, Disziplin und tadelloses Benehmen beigebracht, damit sie nicht in der Glamourgosse enden, wie Paris Hilton. "Jugendlichem Sturm und Drang beugt die Internatsleitung mit einem lückenlosen Beschäftigungsprogramm vor, kritischen Gedanken zum Weltgeschehen mit dem Verzicht auf Tageszeitungen, Fernsehen und politische Diskussionen. Mit 'Underground' bringen die flausenlosen Teenager allenfalls die unterirdische Kirche in Verbindung. Kämpfen sie für nichts? Doch: für Gleichberechtigung in der Nutella-Frage. Der süße Brotaufstrich war bisher den Mädchen vorbehalten. Und dafür, dass in naher Zukunft nicht mehr die Schüler, sondern das Personal die Mahlzeiten serviert."Als so "temperamentvoll wie sachkundig" lobt der Historiker Hans-Ulrich Wehler das neue Buch "Die Antwort" von Alice Schwarzer und möchte doch einmal würdigen, wie wichtig Schwarzer für die deutsche Geschichte gewesen ist: "Ohne diese ganz individuelle Motorik, ja sei's drum, ohne diese Leidenschaft, im offenen Streit für ihre gerechte Sache unentwegt voranzugehen, hätte der Frauenbewegung, aber auch den Entscheidungsgremien der Parteipolitik ein wesentlicher Impuls gefehlt."
al-Sharq al-Awsat (Saudi Arabien / Vereinigtes Königreich), 23.05.2007
Außerdem: Angesichts Nicolas Sarkozys Ankündigung, die 1968er hinter sich lassen zu wollen, erinnert Muhammad al-Mazdiwi daran, dass es erst die Veränderungen von 1968 waren, welche die Wahl eines ungarischen Immigrantenkindes in das französische Präsidentenamt möglich machten.
Tygodnik Powszechny (Polen), 22.05.2007
 Peter Esterhazy, dessen polnische Ausgabe seines Romans "Harmonia caelestis" auf ein breites Medienecho stieß, knirscht beim Interview mit den Zähnen, wenn es um nationale Identitäten geht. "Was es heißt, ein Ungar zu sein? Wenn ich diese Frage höre, schlage ich mit dem Kopf gegen die Wand. Aus der Sicht eines Franzosen kann man diese Frage gar nicht stellen. Es ist aber eine sehr deutsche und wohl auch polnische Frage". Europa ist ihm da viel näher. "Das europäische Denken ist ein aristokratisches - die noblen Familien leben in einem übernationalen Raum, so wie die jüdischen Familien auch. Man denkt einfach nicht in einem nationalen Rahmen."
Peter Esterhazy, dessen polnische Ausgabe seines Romans "Harmonia caelestis" auf ein breites Medienecho stieß, knirscht beim Interview mit den Zähnen, wenn es um nationale Identitäten geht. "Was es heißt, ein Ungar zu sein? Wenn ich diese Frage höre, schlage ich mit dem Kopf gegen die Wand. Aus der Sicht eines Franzosen kann man diese Frage gar nicht stellen. Es ist aber eine sehr deutsche und wohl auch polnische Frage". Europa ist ihm da viel näher. "Das europäische Denken ist ein aristokratisches - die noblen Familien leben in einem übernationalen Raum, so wie die jüdischen Familien auch. Man denkt einfach nicht in einem nationalen Rahmen."Der Theaterregisseur Jan Klata hat Timothy Whites Bob-Marley-Biografie mit Bewunderung gelesen. "Dieses Buch ist suspekt. Ich lese es und verliere mich im Dickicht widersprüchlicher Fakten. Ich kämpfe mich durch ein Gestrüpp irrelevanter Informationen von großer Bedeutung. Dieses Buch ist das Ergebnis jahrelanger fanatischer Arbeit. Je mehr White über Bob Marley schreibt, um so komplexer scheint dieser beseelte Künstler, der wie ein Prophet sang, aber nicht wie ein Prophet lebte." Klata unterstreicht auch die Rolle der Rastafari-Religion im Leben des Musikers: "Wer wissen will, was die Bibel mit seiner Musik zu tun hat, sollte sie einfach hören. Er soll hören, wie die Mauern von Jericho fallen."
Merkur (Deutschland), 01.06.2007
 Autor Martin Kloke zeichnet nach, wie die deutsche Linke vor vierzig Jahren, im Jahr 1967, von der Geschichte verabschiedete und mit dem Sechs-Tage-Krieg antiisraelisch wurde - trotz aller arabischen Vernichtungsdrohungen. Bis heute habe sich die Linke von diesem Antiisraelismus nicht frei gemacht, meint Kloke, der einen fortgesetzten Trend ausmacht, nämlich "den einer Schuld aufrechnenden und abwehrenden Umwegkommunikation, bei der die traditionelle Judenfeindschaft von antiisraelischen Ressentiments abgelöst worden ist. Wie ein Mantra wird hierzulande immer wieder die Frage beschworen, ob und wie viel Kritik an Israel 'erlaubt' sei. Aufmerksame Zeitungsleser wissen, dass es in Deutschland seit Jahrzehnten kein Tabu mehr ist, Israel und die israelische Regierung zu kritisieren. Ministerpräsident Scharon wurde bis zu seinem Schlaganfall Ende 2005 scharf kritisiert - zum Teil noch heftiger als seine Vorgänger Menahem Begin und Benjamin Netanjahu in den achtziger und neunziger Jahren. Die Schlüsselfrage lautet daher nicht, ob Israelkritik hierzulande erlaubt ist, sondern ob Medien, Politiker und Kulturschaffende ein faires oder aber verzerrtes Israelbild zeichnen."
Autor Martin Kloke zeichnet nach, wie die deutsche Linke vor vierzig Jahren, im Jahr 1967, von der Geschichte verabschiedete und mit dem Sechs-Tage-Krieg antiisraelisch wurde - trotz aller arabischen Vernichtungsdrohungen. Bis heute habe sich die Linke von diesem Antiisraelismus nicht frei gemacht, meint Kloke, der einen fortgesetzten Trend ausmacht, nämlich "den einer Schuld aufrechnenden und abwehrenden Umwegkommunikation, bei der die traditionelle Judenfeindschaft von antiisraelischen Ressentiments abgelöst worden ist. Wie ein Mantra wird hierzulande immer wieder die Frage beschworen, ob und wie viel Kritik an Israel 'erlaubt' sei. Aufmerksame Zeitungsleser wissen, dass es in Deutschland seit Jahrzehnten kein Tabu mehr ist, Israel und die israelische Regierung zu kritisieren. Ministerpräsident Scharon wurde bis zu seinem Schlaganfall Ende 2005 scharf kritisiert - zum Teil noch heftiger als seine Vorgänger Menahem Begin und Benjamin Netanjahu in den achtziger und neunziger Jahren. Die Schlüsselfrage lautet daher nicht, ob Israelkritik hierzulande erlaubt ist, sondern ob Medien, Politiker und Kulturschaffende ein faires oder aber verzerrtes Israelbild zeichnen."Sehr instruktiv ist auch Dmitri Zakharines Untersuchung zum politisch-kriminellen Komplex russischer Saunafreundschaften, Geldwäsche und politischer Säuberungen: Seit Jahrhunderten wird beim gemeinsamen Schwitzen über Geopolitik, Pipelines und politische Karrieren entscheiden. Schon Godunows Aufstieg begann als Sauna-Bediensteter von Iwan dem Schrecklichen! Und weiter schreibt Zakharine: "Der Beginn der großen politischen Säuberung nach dem Attentat auf Kirow 1934 fiel in die Zeit, als Stalin vom gemeinschaftlichen Baden zur individuellen Körperpflege übergegangen war. Den Nahstehenden sei, so wird berichtet, diese Änderung gleich aufgefallen 'Kirow war bei Stalin im Winter 1934 zu Besuch. Im Dampfbad waren sie zu zweit. Seitdem war Stalin nie mehr im Dampfbad', schreibt Major A.T. Rybin, ein Offizier der Leibwache. Die Rückkehr des Staatslenkers ins gemeinschaftliche Baderitual fällt in die Tauwetterperiode der fünfziger Jahre, als im politischen Leben Russlands angesichts der Wiederhstellung der kollektiven Führung in der Partei gewisse Liberalisierungstendenzen verzeichnet wurden."
Weiteres: In der Ökonomiekolumne würdigt Uwe Jean Heuser die zwei großen Vertreter der Zunft, die sich stärker nicht hätten widersprechen können, die beide aber große Ökonomen waren und im vergangenen Jahr gestorben sind: Den ultraliberalen Milton Friedman und den Planwirtschaftler John Kenneth Galbraith. Über den "Gegenreformator" Friedman schreibt auch Paul Krugman. Autor und Jurist Berndhard Schlink denkt über Verrat, Loyalität und Identität nach. Und Cord Riechelmann bespricht Josef H. Reichholfs "Kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends".
Boston Review (USA), 01.05.2007
Die Boston Review bringt einen langen Text des iranischen Intellektuellen Akbar Ganji, der im letzten Jahr nach Jahren im Evin-Gefängnis freigelassen wurde und nun in den USA und Europa unterwegs ist, um für eine neue Politik, des Westens gegenüber dem Iran zu plädieren: Keinen Krieg gegen die Mullahs, sondern Unterstützung des Wandels von innen, fordert er: "Als Antwort auf eine solche internationale Unterstützung müssten führende Iraner, alle Freiheitsliebenden im Iran und das iranische Volk im allgemeinen Druck auf das Regime ausüben, damit es seinen nuklearen Traum aufgibt. Selbst wenn das iranische Regime nur auf friedliche Nutzung der Atomenergie aus ist, wären das iranische Volk und die Nachbarländer angesichts der schlechten Technologie und Kontrolle im Land in ständiger Gefahr einer Katastrophe für Menschen und Umwelt. Falls das iranischen Atomprogramm sogar auf Waffen aus ist, wären die Gefahren noch weit größer. Aber wenn der externe Druck Not über die iranischen Menschen bringt, dann ist er nicht zu akzeptieren."
Nepszabadsag (Ungarn), 21.05.2007
 Die katastrophal schlechte, doch inzwischen legendäre ostdeutsche Automarke Trabant ist 50 Jahre alt geworden. Die ungarischen Fans feierten den großen Tag angemessen, findet Zsigmond Falusy: "Wenn das Honecker erlebt hätte! Im Wind flattert eine DDR-Flagge, überall Trabants und junge Menschen in trendigen DDR-T-Shirts. (...) Der Trabant ist mehr als eine Leidenschaft. Er symbolisiert ganz Osteuropa, unser ganzes jämmerliches Leben, die Hornkämme der Ostdeutschen, das Mauscheln der Polen, die Armut der Bulgaren, die Tauchkolbenpumpe, die ich von einer sowjetischen Touristengruppe gekauft hatte, das preiswerte Bier in Prag und der auf dem Schwarzmarkt ergatterte Dollar, Kadar, Honecker und Breschnew, Flammkuchen und Kartoffelnudeln. Witzig und traurig zugleich."
Die katastrophal schlechte, doch inzwischen legendäre ostdeutsche Automarke Trabant ist 50 Jahre alt geworden. Die ungarischen Fans feierten den großen Tag angemessen, findet Zsigmond Falusy: "Wenn das Honecker erlebt hätte! Im Wind flattert eine DDR-Flagge, überall Trabants und junge Menschen in trendigen DDR-T-Shirts. (...) Der Trabant ist mehr als eine Leidenschaft. Er symbolisiert ganz Osteuropa, unser ganzes jämmerliches Leben, die Hornkämme der Ostdeutschen, das Mauscheln der Polen, die Armut der Bulgaren, die Tauchkolbenpumpe, die ich von einer sowjetischen Touristengruppe gekauft hatte, das preiswerte Bier in Prag und der auf dem Schwarzmarkt ergatterte Dollar, Kadar, Honecker und Breschnew, Flammkuchen und Kartoffelnudeln. Witzig und traurig zugleich." Babelia (Spanien), 26.05.2007
Einer, der hierzu einiges zu sagen hat, ist der britische Historiker Paul Preston (s. a. hier). Er hat soeben ein Buch über die Rolle der internationalen Berichterstatter während des Spanische Bürgerkrieges vorgelegt: "Im Spanischen Bürgerkrieg wurde der Journalismus erwachsen: die Reporter hatten, vor allem in der republikanischen Zone, die Möglichkeit, unmittelbar bis an die Front zu gelangen, auch Vertreter von Zeitungen, die sich nicht eindeutig für eine der beteiligten Seiten aussprachen - mit Letzterem war es im Zweiten Weltkrieg vorbei. In dieser Hinsicht funktionierte die Spanische Republik tatsächlich bis zuletzt weitgehend wie eine Demokratie."
New York Times (USA), 27.05.2007
Die in Teheran lebende amerikanisch-iranische Autorin Azadeh Moaveni schildert für die New York Times Book Review die Auswüchse der literarischen Kritik im Iran: "Das Ministerium untersucht Buchmanuskripte vor allem auf erotische oder religiöse Verstöße. Wenn es ein Roman heute durch die Zensur geschafft hat, dann vermuten die Iraner, dass darin herumgepfuscht wurde und dass sie besser versuchen sollten, eine Ausgabe aus der Zeit des Schahs oder eine Raubkopie zu bekommen. Auch in der Fiktion müssen alle Beziehungen dem islamischen Gesetz entsprechen. In der jüngsten Ausgabe von 'Madame Bovary' ist Emmas Ehebruch ausgelassen. Figuren, die in westlichen Romanen Champagner oder Whisky trinken, finden sich in der iranischen Ausgabe mit einem Glas doogh, einem Joghurtgetränk (Rezept) wieder, das noch nie jemand beschwipste."
Die Times hat sich mit der Besprechung von Don DeLillos neuem Roman "Falling Man" (erstes Kapitel) bis vorgestern Zeit gelassen.