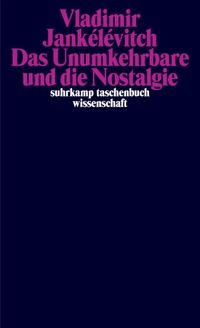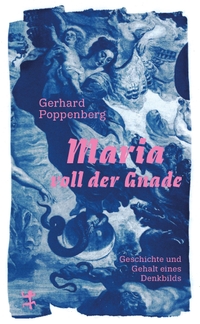Magazinrundschau
Sadiq Jalal al-Azm: Selbstkritik nach der Niederlage
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
21.08.2007. Der Merkur stemmt sich gegen die Dekadenz des Westens. In der New York Times schreibt Mark Lilla über die Politik Gottes und seine modernen Propheten. Der syrische Philosoph Sadiq al-Azm wünscht den arabischen Ländern ein Weizmann-Institut. Der Economist staunt, wie schlecht die CIA ihren Job macht. Outlook India schildert, wie feudal die Owaisi-Familie über die Altstadt von Hyderabad herrscht. In Elet es Irodalom wünscht sich Andras Farkas etwas mehr Globalbewusstsein. Der Nouvel Observateur untersucht den Sexismus der Philosophen. Im Guardian malt sich Germaine Greer aus, wie Ann Hathaway die Sonette des untreuen Shakespeare zu lesen bekam. Und der New Yorker schwärmt von der neuen Retro-Opulenz an der Upper Westside.
New Yorker (USA), 27.08.2007
 Paul Goldberger schwärmt von der neuen "Retro-Opulenz" der Wohnquartiere an der Upper Westside. "Wenn man heute solchen Luxus wie hohe Räume und ein Esszimmer wünscht, ist ein altes Gebäude so ziemlich der einzige Ort, an dem man derlei findet. Vergesst Richard Meier und Jean Nouvel mit ihren schnittigen Eigentumswohnungen: Für Kenner von Wohnungen in Manhattan sind die wahren Architekturberühmtheiten stets Rosario Candela, J. E. R. Carpenter und Emery Roth gewesen, die zwischen den beiden Welkriegen die besten Gebäude entworfen haben. Diese Zeitspanne - als Roth am Central Park West das San Remo baute, während Candela die düsteren Stadtburgen 740 Park Avenue sowie 834, 960 und 1040 Fifth Avenue hinstellte - erwiesen sich als die glorreichen Jahre. Solche Gebäude bilden noch immer den Höhepunkt der New Yorker Wohnarchitektur."
Paul Goldberger schwärmt von der neuen "Retro-Opulenz" der Wohnquartiere an der Upper Westside. "Wenn man heute solchen Luxus wie hohe Räume und ein Esszimmer wünscht, ist ein altes Gebäude so ziemlich der einzige Ort, an dem man derlei findet. Vergesst Richard Meier und Jean Nouvel mit ihren schnittigen Eigentumswohnungen: Für Kenner von Wohnungen in Manhattan sind die wahren Architekturberühmtheiten stets Rosario Candela, J. E. R. Carpenter und Emery Roth gewesen, die zwischen den beiden Welkriegen die besten Gebäude entworfen haben. Diese Zeitspanne - als Roth am Central Park West das San Remo baute, während Candela die düsteren Stadtburgen 740 Park Avenue sowie 834, 960 und 1040 Fifth Avenue hinstellte - erwiesen sich als die glorreichen Jahre. Solche Gebäude bilden noch immer den Höhepunkt der New Yorker Wohnarchitektur."Weiteres: Unter der Überschrift "Die menschliche Bombe" kommentiert Adam Gopnik Nicolas Sarkozys Pläne für Frankreich. Niall Ferguson bespricht die Studie zum Marshall-Plan "The Most Noble Adventure". Adam Kirsch stellt eine Biografie der britischen Autorin Anne Wroe über den englischen Dichter Percy Shelley. Und Anthony Lane würdigt das filmische Vermächtnis von Michelangelo Antonioni.
Zu lesen sind außerdem die Erzählung "Nawabdin Electrician" von Daniyal Mueenuddin und Lyrik von Kimiko Hahn und Philip Schultz.
Nur im Print: Alex Ross über Auswirkungen des Kalten Kriegs auf den amerikanischen Komponisten Aaron Copland, ein Porträt des britischen Schauspielers Ian McKellen und eine Reportage über das Projekt einer nationalen amerikanischen Saatenbank.
Merkur (Deutschland), 20.08.2007
 Das neue Sonderheft des Merkur trägt den Titel "Kein Wille zur Macht. Dekadenz". Die Programmatik beschreiben die Herausgeber im Vorwort wie folgt: "Worum es geht, sind aktuelle und historische Beschreibungen von spezifischen Symptomen einer kulturellen Depression, zu deren Wahrnehmung es nicht erst der islamistischen Propagandaschriften bedurfte."
Das neue Sonderheft des Merkur trägt den Titel "Kein Wille zur Macht. Dekadenz". Die Programmatik beschreiben die Herausgeber im Vorwort wie folgt: "Worum es geht, sind aktuelle und historische Beschreibungen von spezifischen Symptomen einer kulturellen Depression, zu deren Wahrnehmung es nicht erst der islamistischen Propagandaschriften bedurfte." Dass der Blick auf islamistische Schriften aber auch nicht schadet, zeigt der Beitrag von Karsten Fischer, in dem dieser den westlichen Antiliberalismus als "Exportschlager" beschreibt: "Nichts anderes als dieser okzidentalistische Antiliberalismus speist auch den gegenwärtig virulenten fundamentalistischen Dekadenzdiskurs. Eine zentrale Stellung nimmt hierin der islamistische Ideologe Sayyid Qutb ein, dessen heutiger Einfluss kaum überschätzt werden kann, bis hin zu Osama Bin Laden. Qutbs Denken ist besessen von Phantasmagorien allgegenwärtiger Dekadenz, im Orient als Voraussetzung des Kolonialismus, im Okzident als sein Ansporn, und bereits in der römischen Antike mit ihrem das westliche Denken prägenden, bloß zivilreligiösen Wohlstandsstreben, gegen das Qutb einen Dschihad für die Wiedererrichtung der Souveränität und Autorität Gottes ausruft. Solchermaßen erfährt der Dekadenzdiskurs durch den islamischen Fundamentalismus eine sekundäre Sakralisierung, mit der sich erweist, dass alle prägnanten Begriffe der fundamentalistischen Kulturkritik sakralisierte politische Begriffe sind."
In weiteren online lesbaren Artikeln nimmt sich Siegfried Kohlhammer den Hass der Intellektuellen auf die eigene Gesellschaft vor, verfolgt Kathrin Passig das Verhältnis von "Militär und Dekadenz" in Geschichte und Gegenwart und nähert sich Norbert Bolz unter dem Titel "Die Religion des Letzten Menschen" der religiösen Kombinatorik von heute. Nur im Druck kann man unter anderem Aufsätze von Hans Ulrich Gumbrecht über "Stolz" und die "Grenzen des Zumutbaren", von Burkhard Müller über "unseren Unzeitgenossen Sallust" und von Gerhard Henschel über den "Moloch Großstadt" lesen.
Outlook India (Indien), 27.08.2007
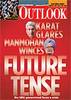 Saba Naqvi Bhaumik erzählt die Hintergründe eines Angriffs auf die Autorin Taslima Nasreen vor einigen Wochen in Hyderabad. Die Attacke folgte auf einen Artikel Nasreens in Outlook, in dem sie erklärte, warum sie nach Westbengalen gezogen ist, das einst eine Einheit mit ihrem Heimatland Bangladesch bildete: "Die Ursprünge der Angriffe auf Nasreen liegen nicht nur im Image der Autorin. Die Attacke hat auch ihren Hintergrund in der Politik von Hyderabad, einer der sich am schnellsten entwickelnden Städte. Hier zählen die Muslime schon wegen ihres hohen Bevölkerungsanteils von 43 Prozent. Ein Viertel davon lebt in der Altstadt. Dies ist das Territorium der muslimischen MIM-Partei (von der die Attacke auf Nasreen ausging, d.Red.) und wird wie ein Feudalstaat von der Owaisi-Familie gesteuert. Die Ursprünge der Familie liegen in der Razakar-Bewegung, die sich scharf gegen eine Vereinigung mit der indischen Union stellte."
Saba Naqvi Bhaumik erzählt die Hintergründe eines Angriffs auf die Autorin Taslima Nasreen vor einigen Wochen in Hyderabad. Die Attacke folgte auf einen Artikel Nasreens in Outlook, in dem sie erklärte, warum sie nach Westbengalen gezogen ist, das einst eine Einheit mit ihrem Heimatland Bangladesch bildete: "Die Ursprünge der Angriffe auf Nasreen liegen nicht nur im Image der Autorin. Die Attacke hat auch ihren Hintergrund in der Politik von Hyderabad, einer der sich am schnellsten entwickelnden Städte. Hier zählen die Muslime schon wegen ihres hohen Bevölkerungsanteils von 43 Prozent. Ein Viertel davon lebt in der Altstadt. Dies ist das Territorium der muslimischen MIM-Partei (von der die Attacke auf Nasreen ausging, d.Red.) und wird wie ein Feudalstaat von der Owaisi-Familie gesteuert. Die Ursprünge der Familie liegen in der Razakar-Bewegung, die sich scharf gegen eine Vereinigung mit der indischen Union stellte."Im Filmteil erzählt Namrat Joshi die Geschichte des Überraschungserfolgs der Saison. "Chak De India" ist ein Film ohne Tanz und Gesang, er handelt von armen Mädchen und einer unpopulär gewordenen Sportart: Hockey. Und SRK alias Shah Rukh Khan (hier eine deutsche Fan-Seite). Es gibt auch ein Interview mit dem Star.
al-Sharq al-Awsat (Saudi Arabien / Vereinigtes Königreich), 20.08.2007
In einem Interview blickt der syrische Philosoph Sadiq Jalal al-Azm auf die arabische Niederlage im Sechs-Tage-Krieg gegen Israel 1967 zurück und umreißt die Lehren, die daraus zu ziehen sein sollten. Al-Azms Buch "Selbstkritik nach der Niederlage" gilt als Meilenstein der arabischen politischen Literatur. "Wir leiden noch immer an den Folgen der Niederlage. Bis heute lässt sich eine wirkliche und ernsthafte Auseinandersetzung mit den tiefliegenden Ursachen der Niederlage nicht beobachten. Nötig wäre eine Reform der sozialen Strukturen, der Bildungs- und Erziehungsstrukturen. Das wäre notwendig, und nicht die Reform des Militärs." Die Förderung eines selbstkritisches Blicks auf die eigene Gesellschaft ließe sich nicht zuletzt durch eine Stärkung der akademischen Forschung erreichen. Al-Azm nennt hier als Beispiel das israelische Weizmann-Institut.
Economist (UK), 17.08.2007
 Nicht viel Gutes hat eine umfangreiche Geschichte der CIA über den US-Auslandsgeheimdienst zu sagen: "Viele Bücher haben zu zeigen versucht, wie schlecht sich die 'Central Intelligence Agency' benimmt. In seiner gründlichen und überzeugenden Studie beschreibt Tim Weiner, wie schlecht sie ihren Job macht. Als Journalist der New York Times, der seit Jahren mit dem Thema Spionage befasst ist, weiß Weiner, worüber er spricht. Er verschweigt die schmutzigen Seiten keineswegs - etwa das Öffnen von Briefen, die Schnüffelei bei Kritikern, Drogenversuche an russischen Häftlingen, Pläne zu Attentaten auf politische Führer im Ausland und so weiter. Das Illegale und das Unmoralische interessieren ihn aber erst in zweiter Linie. Sein Hauptvorwurf ist der der Inkompetenz, und er belegt ihn mit dem Eifer eines Staatsanwalts. Die mächtigste Nation der Welt hat noch immer, klagt er, keinen 'erstklassigen Spionagedienst.'"
Nicht viel Gutes hat eine umfangreiche Geschichte der CIA über den US-Auslandsgeheimdienst zu sagen: "Viele Bücher haben zu zeigen versucht, wie schlecht sich die 'Central Intelligence Agency' benimmt. In seiner gründlichen und überzeugenden Studie beschreibt Tim Weiner, wie schlecht sie ihren Job macht. Als Journalist der New York Times, der seit Jahren mit dem Thema Spionage befasst ist, weiß Weiner, worüber er spricht. Er verschweigt die schmutzigen Seiten keineswegs - etwa das Öffnen von Briefen, die Schnüffelei bei Kritikern, Drogenversuche an russischen Häftlingen, Pläne zu Attentaten auf politische Führer im Ausland und so weiter. Das Illegale und das Unmoralische interessieren ihn aber erst in zweiter Linie. Sein Hauptvorwurf ist der der Inkompetenz, und er belegt ihn mit dem Eifer eines Staatsanwalts. Die mächtigste Nation der Welt hat noch immer, klagt er, keinen 'erstklassigen Spionagedienst.'" Weitere Artikel: Gleich zwei Biografien der US-Außenministerin Condoleezza Rice sind gerade erschienen - für den Economist handelt sich nach Lage der Dinge eher um Nachrufe auf einen einst vielversprechenden Politstar. Sehr angetan ist der Economist auch von Gregory Clarks kurzer Wirtschaftsgeschichte der Welt - gerade weil sie in politisch nicht sehr korrekter Weise den wirtschaftlichen Aufbruch des 18. Jahrhunderts aus Englands fortgeschrittenem Zivilisationszustand erklärt. Außerdem besprochen werden zwei Bücher über den Sudan, eines über seine Geschichte, eines über die Gegenwart.
Tygodnik Powszechny (Polen), 19.08.2007
 Im wieder aufgeflammten deutsch-polnischen Streit um die "Beutekunst" sieht Nawojka Cieslinska-Lobkowicz Unwissen und Arroganz auf beiden Seiten wirken, wovon ihrer Meinung nach die Aussagen des "frustrierten Diplomaten" Tono Eitel ebenso wie die überhitzte Reaktion polnischer Medien zeugen. "Man sollte kompetent und ohne Emotionen die Öffentlichkeiten in beiden Ländern über dieses komplexe Problem informieren. Genau so wichtig ist aber, Kontakte und Kooperationen deutscher und polnischer Experten zu fördern. Sie unterscheiden sich von Politikern und Juristen insofern, als dass für sie das Wohl der Kulturgüter prioritär ist, und nicht rechtliche Hanteleien und ideologische Staatsräson. Sie könnten auch Modelle ausarbeiten, die von beiden Gesellschaften akzeptiert, und somit den Politikern den Weg weisen würden."
Im wieder aufgeflammten deutsch-polnischen Streit um die "Beutekunst" sieht Nawojka Cieslinska-Lobkowicz Unwissen und Arroganz auf beiden Seiten wirken, wovon ihrer Meinung nach die Aussagen des "frustrierten Diplomaten" Tono Eitel ebenso wie die überhitzte Reaktion polnischer Medien zeugen. "Man sollte kompetent und ohne Emotionen die Öffentlichkeiten in beiden Ländern über dieses komplexe Problem informieren. Genau so wichtig ist aber, Kontakte und Kooperationen deutscher und polnischer Experten zu fördern. Sie unterscheiden sich von Politikern und Juristen insofern, als dass für sie das Wohl der Kulturgüter prioritär ist, und nicht rechtliche Hanteleien und ideologische Staatsräson. Sie könnten auch Modelle ausarbeiten, die von beiden Gesellschaften akzeptiert, und somit den Politikern den Weg weisen würden."Foglio (Italien), 18.08.2007
 Tommaso Piffer erzählt die Geschichte von Roberto Anderson, der als italienischer Ingenieur 1924 in die Sowjetunion ging. Anderson war nur einer von Hunderten von Italienern, die aus kommunistischer Überzeugung das Mussolini-Regime verließen, sich dort aber zwischen allen Stühlen wiederfanden. "Zum Beispiel Emilio Guarneschelli, ein Turiner, der erst nach Frankreich, dann nach Belgien und schließlich in die UdSSR auswanderte, wo er Kurse in Marxismus-Leninismus, der Geschichte des Klassenkampfes und der Kommunistischen Partei besuchte. Sein Mut, die Wirklichkeit beim Namen zu nennen, bezahlte er mit der Hinrichtung. Pompeo Nale hingegen hatte sich schon seit früher Jungend in der sozialistischen Partei eingagiert und war an einem Mord an einem Faschisten beteiligt gewesen, bevor er in die UdSSR emigierte. Als er wegen des Vorwurfs des Trotzkismus verhaftet wurde, unterstellten sie ihm, diesen Mord organisiert zu haben, um als Antifaschist zu erscheinen, während er in Wahrheit nichts anderes als ein Spion sei. Er wurde im März 1934 in Butovo erschossen. Und dann gibt es etwa noch Aldo Gorelli aus Mailand, den Antonio Roasio als 'moralisch krank' und 'unzufrieden' bezeichnete. Seine Überreste befinden sich auf dem Gemeindefriedhof von Kommunaeka."
Tommaso Piffer erzählt die Geschichte von Roberto Anderson, der als italienischer Ingenieur 1924 in die Sowjetunion ging. Anderson war nur einer von Hunderten von Italienern, die aus kommunistischer Überzeugung das Mussolini-Regime verließen, sich dort aber zwischen allen Stühlen wiederfanden. "Zum Beispiel Emilio Guarneschelli, ein Turiner, der erst nach Frankreich, dann nach Belgien und schließlich in die UdSSR auswanderte, wo er Kurse in Marxismus-Leninismus, der Geschichte des Klassenkampfes und der Kommunistischen Partei besuchte. Sein Mut, die Wirklichkeit beim Namen zu nennen, bezahlte er mit der Hinrichtung. Pompeo Nale hingegen hatte sich schon seit früher Jungend in der sozialistischen Partei eingagiert und war an einem Mord an einem Faschisten beteiligt gewesen, bevor er in die UdSSR emigierte. Als er wegen des Vorwurfs des Trotzkismus verhaftet wurde, unterstellten sie ihm, diesen Mord organisiert zu haben, um als Antifaschist zu erscheinen, während er in Wahrheit nichts anderes als ein Spion sei. Er wurde im März 1934 in Butovo erschossen. Und dann gibt es etwa noch Aldo Gorelli aus Mailand, den Antonio Roasio als 'moralisch krank' und 'unzufrieden' bezeichnete. Seine Überreste befinden sich auf dem Gemeindefriedhof von Kommunaeka."Außerdem empfiehlt Paola Bacchiddu den Roman "Il signor figlio" des bekannten TV-Conferenciers Alessandro Zaccuri, in dem Giacomo Leopardi und Rudyard Kipling ihren Auftritt haben.
Gazeta Wyborcza (Polen), 18.08.2007
 Die Anthropologin Joanna Tokarska-Bakir erklärt, warum sich die Kaczynski-Regierung in ihrer Geschichtspolitik gern an Israel orientieren würde: "Premierminister Kaczynski hat des öfteren seine Sympathien für dieses kleine Land bekundet, das in wenigen Jahrzehnten so viel erreicht hat. Das symbolische Kapital Israels basiert auf der Martyrologie einer Nation, für die sich die ganze Welt verantwortlich fühlt. Sollten wir uns wundern, dass ein Land, das im denselben Krieg mehrere Millionen Menschen verloren hat - im großen Maße dieselben Menschen - durch Israel erprobte Mittel nachahmen will, um sein Image zu stärken?" Die Kehrseite dieser Strategie sei aber die Vereinnahmung der Leiden von Individuen durch eine staatliche Politik, die eine wirkliche Verarbeitung nationaler Traumata verhindert.
Die Anthropologin Joanna Tokarska-Bakir erklärt, warum sich die Kaczynski-Regierung in ihrer Geschichtspolitik gern an Israel orientieren würde: "Premierminister Kaczynski hat des öfteren seine Sympathien für dieses kleine Land bekundet, das in wenigen Jahrzehnten so viel erreicht hat. Das symbolische Kapital Israels basiert auf der Martyrologie einer Nation, für die sich die ganze Welt verantwortlich fühlt. Sollten wir uns wundern, dass ein Land, das im denselben Krieg mehrere Millionen Menschen verloren hat - im großen Maße dieselben Menschen - durch Israel erprobte Mittel nachahmen will, um sein Image zu stärken?" Die Kehrseite dieser Strategie sei aber die Vereinnahmung der Leiden von Individuen durch eine staatliche Politik, die eine wirkliche Verarbeitung nationaler Traumata verhindert."Der Irak ist zu Ende. Der Irak hat gerade erst begonnen. Er hat noch nicht begonnen, was die Folgen für das Land, den Nahen Osten, für die Außenpolitik der USA und deren Ruf in der Welt angeht" schreibt in einem kurzen Text Timothy Garton Ash. Positives gibt es nicht zu berichten: "Wir kennen die langfristigen Folgen des Krieges nicht. Vielleicht ist da ein Lichtchen der Hoffnung im Tunnel, aber so weit das Auge blicken kann, sieht man nur schlechte oder katastrophale Folgen. Seit einem Vierteljahrhundert schreibe ich über internationale Probleme, aber ich kann mich an kein größeres und vermeidbareres, vom Menschen verursachtes Drama, erinnern."
Nur im Print zu lesen: Fragmente des neuen Romans von Michal Witkowski, in dem der Schriftsteller die Sammelwut der Polen in den Achtziger Jahren als Rückzugsstrategie aus einer hoffnungslosen politischen Realität beschreibt.
Espresso (Italien), 17.08.2007
 Die antisemitischen Äußerungen des Don Gelmini sind für Umberto Eco in seiner Bustina Minerva ein Anzeichen für die besorgniserregende Langlebigkeit antijüdischer Klischees in Kirchenkreisen. Der prominente italienische Priester Don Pierino Gelmini, bekannt wegen der Gründung einiger Drogenentzugsanstalten, hatte eine angebliche "jüdische Lobby" als Urheber der gegen ihn erhobenen Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs ausgemacht. "Es schien, dass derartige Vorstellungen in bröckelnden Bibliotheken bischöflicher Seminare versunken wären, um die Urheberrechte an Adolf Hitler und Bin Laden weiterzugeben. Und jetzt zeigt sich, dass bei einem heute lebenden Gelehrten, der wahrscheinlich in den Dreißigern in einem Kirchenseminar studiert hat (nach der 'Versöhnung' von Kirche und italienischem Faschismus), in den hintersten Winkeln seines Gedächtnisses genau jenes Monster überlebt hat, das auch schon seine ältesten Lehrmeister beherrscht hat." Gelmini hat sich mittlerweile korrigiert: Es seien keine Juden, sondern "Radical-Chic-Freimaurer", die ihn und die Kirche fertigmachen wollten.
Die antisemitischen Äußerungen des Don Gelmini sind für Umberto Eco in seiner Bustina Minerva ein Anzeichen für die besorgniserregende Langlebigkeit antijüdischer Klischees in Kirchenkreisen. Der prominente italienische Priester Don Pierino Gelmini, bekannt wegen der Gründung einiger Drogenentzugsanstalten, hatte eine angebliche "jüdische Lobby" als Urheber der gegen ihn erhobenen Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs ausgemacht. "Es schien, dass derartige Vorstellungen in bröckelnden Bibliotheken bischöflicher Seminare versunken wären, um die Urheberrechte an Adolf Hitler und Bin Laden weiterzugeben. Und jetzt zeigt sich, dass bei einem heute lebenden Gelehrten, der wahrscheinlich in den Dreißigern in einem Kirchenseminar studiert hat (nach der 'Versöhnung' von Kirche und italienischem Faschismus), in den hintersten Winkeln seines Gedächtnisses genau jenes Monster überlebt hat, das auch schon seine ältesten Lehrmeister beherrscht hat." Gelmini hat sich mittlerweile korrigiert: Es seien keine Juden, sondern "Radical-Chic-Freimaurer", die ihn und die Kirche fertigmachen wollten. HVG (Ungarn), 16.08.2007
 Mit seiner eigenwilligen Kameraführung und seinen expressionistischen Bildkompositionen ist der ungarische Regisseur Miklos Jancso in den 1960er Jahren international bekannt geworden. Seit der Wende dreht er vor allem bitterböse Komödien. Über die Gegenwart könne man nur lachen, sagt Jancso im Gespräch mit Tamas Vajna. "Ich gebe zu: Blödsinn zu machen ist auch altersbedingt. In der Kindheit denkt man, man werde ewig leben und man nimmt sich selbst sehr ernst. Wenn das Ende des Lebens in sichtbare Nähe rückt, fragt man sich, was das Ganze eigentlich sollte." Filme seien inzwischen ein Teil der Alltagskultur geworden, fährt Jancso fort, Filmen eine elementare Kulturtechnik: "Die Filmsprache ist eine alltägliche Ausdrucksform geworden. Die Kamera ist heute so etwas wie früher ein Stift war. Es kam ganz genauso, wie Alexandre Astruc, ein Vertreter der französischen Nouvelle Vague, es prophezeit hat. Letztes Jahr fand in Kapolcs das erste Festival statt, auf dem nur mit Handys gedrehte Filme zu sehen waren."
Mit seiner eigenwilligen Kameraführung und seinen expressionistischen Bildkompositionen ist der ungarische Regisseur Miklos Jancso in den 1960er Jahren international bekannt geworden. Seit der Wende dreht er vor allem bitterböse Komödien. Über die Gegenwart könne man nur lachen, sagt Jancso im Gespräch mit Tamas Vajna. "Ich gebe zu: Blödsinn zu machen ist auch altersbedingt. In der Kindheit denkt man, man werde ewig leben und man nimmt sich selbst sehr ernst. Wenn das Ende des Lebens in sichtbare Nähe rückt, fragt man sich, was das Ganze eigentlich sollte." Filme seien inzwischen ein Teil der Alltagskultur geworden, fährt Jancso fort, Filmen eine elementare Kulturtechnik: "Die Filmsprache ist eine alltägliche Ausdrucksform geworden. Die Kamera ist heute so etwas wie früher ein Stift war. Es kam ganz genauso, wie Alexandre Astruc, ein Vertreter der französischen Nouvelle Vague, es prophezeit hat. Letztes Jahr fand in Kapolcs das erste Festival statt, auf dem nur mit Handys gedrehte Filme zu sehen waren."Elet es Irodalom (Ungarn), 10.08.2007
 "In der globalisierten, an Milliarden Punkten vernetzten Welt führt die Durchsetzung nationaler Interessen automatisch auch zu ihrer Verletzung", schreibt der Wirtschaftswissenschaftler Andras Farkas. Die größten Probleme der europäischen Nationen wie Klimawandel, Terrorgefahr, alternde Gesellschaften oder Migration können nur noch global gelöst werden. Die Entwicklung eines "globalen Nationalbewusstseins" gehöre daher zu den größten Herausforderungen Europas, meint Farkas: "Die europäischen Nationen haben tausend Jahre lang gegeneinander gekämpft. Die europäische Zusammenarbeit ist für sie heute noch wie ein Schleier, den sie sofort abwerfen, wenn es um ihre nationalen Interessen geht. Wollen wir wirklich diese Einstellung aufrecht erhalten? Das traditionelle Denken in nationalen Rahmen sagt: Unser eigenes Interesse kommt an erster Stelle, an zweiter Stelle wiederum unser eigenes Interesse usw. Auf Platz zehn fällt uns plötzlich ein: Ach, beinahe hätten wir Europa vergessen, halleluja."
"In der globalisierten, an Milliarden Punkten vernetzten Welt führt die Durchsetzung nationaler Interessen automatisch auch zu ihrer Verletzung", schreibt der Wirtschaftswissenschaftler Andras Farkas. Die größten Probleme der europäischen Nationen wie Klimawandel, Terrorgefahr, alternde Gesellschaften oder Migration können nur noch global gelöst werden. Die Entwicklung eines "globalen Nationalbewusstseins" gehöre daher zu den größten Herausforderungen Europas, meint Farkas: "Die europäischen Nationen haben tausend Jahre lang gegeneinander gekämpft. Die europäische Zusammenarbeit ist für sie heute noch wie ein Schleier, den sie sofort abwerfen, wenn es um ihre nationalen Interessen geht. Wollen wir wirklich diese Einstellung aufrecht erhalten? Das traditionelle Denken in nationalen Rahmen sagt: Unser eigenes Interesse kommt an erster Stelle, an zweiter Stelle wiederum unser eigenes Interesse usw. Auf Platz zehn fällt uns plötzlich ein: Ach, beinahe hätten wir Europa vergessen, halleluja."In Cividale del Friuli, einer kleinen italienischen Stadt an der slowenischen Grenze, hat im Juli das mitteleuropäische Festival "Mittelfest" stattgefunden. Dessen Leiter Moni Ovadia erklärt Julia Varadi seine Auffassung von zeitgenössischem Theater. "Wir, die wir auf der Bühne groß geworden sind, wissen, welch starke Wirkung ein auf der Bühne zum Ausdruck gebrachter Gedanke auf das Publikum haben kann. Nicht nur der Intellekt empfängt eine Botschaft, auch der Magen, das Herz, alle Sinnesorgane sind daran beteiligt. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschenrechte in Europa und anderswo auf der Welt erst dann vollständig geachtet werden, wenn sie den Menschen ins Blut übergehen, wenn sich die Erkenntnis bei einem jeden Einzelnen durchsetzt, dass das Leben ohne die Achtung der Menschenrechte nicht lebenswürdig ist. Sie können es naiv nennen, aber ich glaube fest daran, dass das Theater eines der wenigen wirkungsvollen Mittel dazu ist."
Nouvel Observateur (Frankreich), 16.08.2007
 In einem Dossier über die Philosophen und die Frauen untersucht der Nouvel Obs, wie sich die großen Denker seit den Griechen am angeblichen "Rätsel Frau" abarbeiteten. In einem Interview über die Frage, ob die Herren von Platon bis Derrida letztlich frauenfeindlich waren, erklärt die Philosophin Francoise Collin, warum das andere Geschlecht so häufig herabgesetzt wurde oder unverstanden blieb. "Es gibt keine 'Bösen' oder 'Guten'. Aber keiner sucht wirklich nach einer Erklärung dafür, dass die Frauen, obwohl in der Überzahl, für eine Minderheit gehalten werden. Außer Marx, natürlich, aber wer glaubt schon, dass sich der Sexismus durch das Verschwinden des Kapitalismus auflösen würde! Erstaunlich ist, dass sie trotz häufig entgegengesetzter Voraussetzungen alle zum gleichen Nachweis der weiblichen Unterlegenheit gelangen. Aristoteles gilt dabei oft als der Sexist par excellence."
In einem Dossier über die Philosophen und die Frauen untersucht der Nouvel Obs, wie sich die großen Denker seit den Griechen am angeblichen "Rätsel Frau" abarbeiteten. In einem Interview über die Frage, ob die Herren von Platon bis Derrida letztlich frauenfeindlich waren, erklärt die Philosophin Francoise Collin, warum das andere Geschlecht so häufig herabgesetzt wurde oder unverstanden blieb. "Es gibt keine 'Bösen' oder 'Guten'. Aber keiner sucht wirklich nach einer Erklärung dafür, dass die Frauen, obwohl in der Überzahl, für eine Minderheit gehalten werden. Außer Marx, natürlich, aber wer glaubt schon, dass sich der Sexismus durch das Verschwinden des Kapitalismus auflösen würde! Erstaunlich ist, dass sie trotz häufig entgegengesetzter Voraussetzungen alle zum gleichen Nachweis der weiblichen Unterlegenheit gelangen. Aristoteles gilt dabei oft als der Sexist par excellence."Weitere Dossierbeiträge untersuchen das Frauenbild bei Adorno, Rousseau, Kiergaard und Nietzsche, ein Artikel widmet sich Hannah Arendt, der Frau "im Schatten Heideggers".
Guardian (UK), 18.08.2007
 Anfang September erscheint ein Buch der feministischen Literaturwissenschaftlerin Germaine Greer über Ann Hathaway, Shakespeares oft verächtlich gemachte Ehefrau. In einem Auszug, den der Guardian vorabdruckt, fragt sich Greer, ob Hathaway Shakespeares Sonette gelesen hat - und entwickelt die folgende Fantasie: "Manche wollen glauben, dass Ann ihren Ehemann dafür tadelte, seine Untreue herauszuposaunen, andere, dass sie meckerte und tobte und ihn dadurch nur noch weiter aus ihrem Leben drängte. Es ist ebenso wahrscheinlich, dass sie die Sonette gelesen hat, wie, dass sie sie sich vorlesen ließ. Sie war schließlich Teil seiner Realität, nicht seiner Fantasie. Ich selbst glaube, dass sie in der Tat eine Kopie der Sonette erhielt, wenn auch nicht von ihrem Ehemann, dass sie sich erst weigerte, sie hinter seinem Rücken zu lesen, und als sie sie dann doch las, war sie erschüttert, bewegt und beeindruckt. Manche würde sie schon gekannt haben, aber nicht alle. Dann würde sie das kleine Buch in die kleine Truhe, in der sie ihre Besitzschaften aufbewahrte, gepackt, die Bibel geöffnet und für sie beide gebetet haben."
Anfang September erscheint ein Buch der feministischen Literaturwissenschaftlerin Germaine Greer über Ann Hathaway, Shakespeares oft verächtlich gemachte Ehefrau. In einem Auszug, den der Guardian vorabdruckt, fragt sich Greer, ob Hathaway Shakespeares Sonette gelesen hat - und entwickelt die folgende Fantasie: "Manche wollen glauben, dass Ann ihren Ehemann dafür tadelte, seine Untreue herauszuposaunen, andere, dass sie meckerte und tobte und ihn dadurch nur noch weiter aus ihrem Leben drängte. Es ist ebenso wahrscheinlich, dass sie die Sonette gelesen hat, wie, dass sie sie sich vorlesen ließ. Sie war schließlich Teil seiner Realität, nicht seiner Fantasie. Ich selbst glaube, dass sie in der Tat eine Kopie der Sonette erhielt, wenn auch nicht von ihrem Ehemann, dass sie sich erst weigerte, sie hinter seinem Rücken zu lesen, und als sie sie dann doch las, war sie erschüttert, bewegt und beeindruckt. Manche würde sie schon gekannt haben, aber nicht alle. Dann würde sie das kleine Buch in die kleine Truhe, in der sie ihre Besitzschaften aufbewahrte, gepackt, die Bibel geöffnet und für sie beide gebetet haben."Steven Poole bespricht recht enthusiastisch William Gibsons neuen Roman "Spook County": "Dieser Roman ist ein Politthriller, der auch eine Satire auf Werbung, Musik und die Computer-Geekokratie ist, ein sehr fein gearbeiteter Krimi, dessen hauptsächlicher Reiz in der Fülle winziger ästhetischer Schocks und unerwarteter Texturen liegt."
New York Times (USA), 19.08.2007
 In einem ausgreifenden Essay für das New York Times Magazine (in Wahrheit ein Vorabdruck aus seinem kommenden Buch "The Stillborn God - Religion, Politics and the Modern West") kommt nach Ian Buruma und Timothy Garton Ash mit Mark Lilla (mehr hier) nun ein weiterer angelsächsischer Großintellektueller zum Ergebnis, dass wohl nur Tariq Ramadan dem europäischen Islam einen Weg zur Integration weisen kann. Lillas Essay handelt von "politischer Theologie", die auch im Christentum bis vor nicht allzu langer Zeit virulent war, und er legt dar, dass eine Liberalisierung von Theologie, wie sie im Islam etwa Bassam Tibi vorschlägt, längst nicht so attraktiv sei: "Natürlich sprechen wir lieber mit islamischen Liberalisierern, denn sie sprechen unsere Sprache: Sie akzeptieren die intellektuellen Voraussetzungen der Trennung von Religion und Politik... Sie sind keine politischen Theologen. Aber Reformation schafft wesentlich größere Aussichten auf einen dauerhaften polischen Wandel als Liberalisierung. Reformatoren sprechen von innerhalb der gläubigen Gemeinde und geben ihr somit zwingende theologische Gründe, um Erneuerungen als authentische Interpretationen ihres Glaubens zu begreifen."
In einem ausgreifenden Essay für das New York Times Magazine (in Wahrheit ein Vorabdruck aus seinem kommenden Buch "The Stillborn God - Religion, Politics and the Modern West") kommt nach Ian Buruma und Timothy Garton Ash mit Mark Lilla (mehr hier) nun ein weiterer angelsächsischer Großintellektueller zum Ergebnis, dass wohl nur Tariq Ramadan dem europäischen Islam einen Weg zur Integration weisen kann. Lillas Essay handelt von "politischer Theologie", die auch im Christentum bis vor nicht allzu langer Zeit virulent war, und er legt dar, dass eine Liberalisierung von Theologie, wie sie im Islam etwa Bassam Tibi vorschlägt, längst nicht so attraktiv sei: "Natürlich sprechen wir lieber mit islamischen Liberalisierern, denn sie sprechen unsere Sprache: Sie akzeptieren die intellektuellen Voraussetzungen der Trennung von Religion und Politik... Sie sind keine politischen Theologen. Aber Reformation schafft wesentlich größere Aussichten auf einen dauerhaften polischen Wandel als Liberalisierung. Reformatoren sprechen von innerhalb der gläubigen Gemeinde und geben ihr somit zwingende theologische Gründe, um Erneuerungen als authentische Interpretationen ihres Glaubens zu begreifen."In der Sunday Book Review liest Luc Sante eine Neuausgabe von Jack Kerouacs epochalem Buch "On the Road", das vor fünfzig Jahren zum ersten Mal erschien. Und Matt Weiland liest ein Buch John Lelands, das anlassgerecht erklärt "Why Kerouac Matters". Und Leah Hager Cohen empfiehlt ein offensichtlich faszinierendes Buch von Margalit Fox über ein Berberdorf mit einer sehr hohen Rate von Gehörlosen, das eine eigene Zeichensprache entwickelte, die dort von Tauben und Hörenden verstanden wird. Besprochen wird auch Handkes neuer Roman "Crossing the Sierra de Gredos".