Magazinrundschau
Man nannte es das Ding
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
13.11.2018. In der New York Review of Books taucht der Historiker Christopher Clark in die Kriege der Zukunft. Der Guardian erzählt, wie das suchterzeugende OxyContin bei Ärzten und Patienten durchgedrückt wurde. Les inrockuptibles widmet sich den blühenden antisemitischen Szenen in Frankreich. Der Film-Dienst sichtet Paul Schraders "Dark". Der New Yorker geht dem geheimnisvollen Havanna-Syndrom nach.
New York Review of Books (USA), 22.11.2018
 Tief deprimiert taucht der Historiker Christopher Clark aus zwei Büchern auf, die sich mit den Kriegen der Zukunft befassen, "The Future of War" von Lawrence Freedman und Robert H. Latiffs "Future War": "Es ist schwer, nicht von der Erfindungsgabe der Waffenexperten in ihren Untergrundlabors beeindruckt zu sein, aber auch schwer, nicht an der Art und Weise zu verzweifeln, wie ein solcher Einfallsreichtum von größeren ethischen Imperativen abgekoppelt ist. Und man kann nicht umhin, sich von der kühlen, zustimmenden Prosa beeindrucken zu lassen, in der die Experten der Kriegsstudien ihre Argumente abfassen, als ob Krieg eine menschliche Notwendigkeit wäre und immer sein wird, ein Merkmal unserer Existenz, so natürlich wie die Geburt oder die Bewegung von Wolken. Ich erinnerte mich an eine Bemerkung des französischen Soziologen Bruno Latour, als er im Frühjahr 2016 Cambridge besuchte. 'Es ist sicherlich von entscheidender Konsequenz', sagte er und überraschte die betont säkularen Kollegen im Raum, 'zu wissen, ob wir als Menschen in einem Zustand der Erlösung oder Verdammnis sind'."
Tief deprimiert taucht der Historiker Christopher Clark aus zwei Büchern auf, die sich mit den Kriegen der Zukunft befassen, "The Future of War" von Lawrence Freedman und Robert H. Latiffs "Future War": "Es ist schwer, nicht von der Erfindungsgabe der Waffenexperten in ihren Untergrundlabors beeindruckt zu sein, aber auch schwer, nicht an der Art und Weise zu verzweifeln, wie ein solcher Einfallsreichtum von größeren ethischen Imperativen abgekoppelt ist. Und man kann nicht umhin, sich von der kühlen, zustimmenden Prosa beeindrucken zu lassen, in der die Experten der Kriegsstudien ihre Argumente abfassen, als ob Krieg eine menschliche Notwendigkeit wäre und immer sein wird, ein Merkmal unserer Existenz, so natürlich wie die Geburt oder die Bewegung von Wolken. Ich erinnerte mich an eine Bemerkung des französischen Soziologen Bruno Latour, als er im Frühjahr 2016 Cambridge besuchte. 'Es ist sicherlich von entscheidender Konsequenz', sagte er und überraschte die betont säkularen Kollegen im Raum, 'zu wissen, ob wir als Menschen in einem Zustand der Erlösung oder Verdammnis sind'."Alexander Stille kommentiert den Brief von Erzbischof Carlo Maria Viganò an Papst Franziskus. Viganò beschuldigt darin den Papst, Anzeichen sexuellen Missbrauchs in der Katholische Kirche zu ignorieren und zu verheimlichen: "Die größte Verantwortung für das Problem liegt bei Papst Johannes Paul II., der über 20 Jahre auf diesem Auge blind war. Zwischen Mitte der 80er und 2004 gab die Kirche 2,6 Milliarden Dollar für die Beilegung von Prozessen allein in den USA aus, für Schweigegelder für Opfer vor allem. Fälle in Irland, Australien, England, Kanada und Mexiko folgten dem gleiche n deprimierenden Muster: Opfer wurden ignoriert, schikaniert, Täter in neue Gemeinden versetzt, wo sie weiter missbrauchten … Franziskus steht unter großem Druck. Opfer fordern die Untersuchung der Verantwortlichkeiten von Bischöfen und Kardinälen, die Bescheid wussten und nichts unternahmen. In der Folge könnten viele Kirchenführer in den Ruhestand gezwungen werden, die Kirche würde das für Jahre paralysieren. Wenn Franziskus nichts tut, droht ebenfalls Paralyse. Die beste Option scheint noch zu sein, die Beteiligung der Laien in Kirchendingen zu fördern und Frauen als Diakonissinnen zuzulassen. Doch es könnte zu spät sein und zu wenig."
Außerdem: Bill McKibben gruselt es bei der Lektüre eines Reports über den Klimawandel. Jed Perl besucht zwei Delacroix-Ausstellungen. Yasmine El Rashidi liest zwei Romane von Ali Smith. Und Robert Kuttner beugt sich über Adam Toozes "Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World".
168 ora (Ungarn), 10.11.2018
 Der Theaterregisseur László Bagossy spricht mit Zoltán Lakner über verordnete Kanonisierungsprozesse im gegenwärtigen Ungarn. Da soll dann etwa ein Péter Esterházy für einen Albert Wass ausgetauscht werden. "Tag für Tag bekommen wir Druck, den Kanon zu erneuern, doch die Evolution der Kultur ist mindestens so kompliziert wie die biologische Evolution: Mit mehreren Unbekannten ist sie unberechenbar und auch unkontrollierbar für jeden, der sie verordnen will. Politisch gesehen ist es genau so hoffnungslos, Bücher zu verbrennen wie Bücher zu drucken. Kein Mensch, keine Partei könnte Péter Esterházy oder Albert Wass auf dem steilen Kanon-Berg Hilfestellung leisten. Wer versucht, das mit Gewalt durchzusetzen, wird allenfalls Pfingstkönig."
Der Theaterregisseur László Bagossy spricht mit Zoltán Lakner über verordnete Kanonisierungsprozesse im gegenwärtigen Ungarn. Da soll dann etwa ein Péter Esterházy für einen Albert Wass ausgetauscht werden. "Tag für Tag bekommen wir Druck, den Kanon zu erneuern, doch die Evolution der Kultur ist mindestens so kompliziert wie die biologische Evolution: Mit mehreren Unbekannten ist sie unberechenbar und auch unkontrollierbar für jeden, der sie verordnen will. Politisch gesehen ist es genau so hoffnungslos, Bücher zu verbrennen wie Bücher zu drucken. Kein Mensch, keine Partei könnte Péter Esterházy oder Albert Wass auf dem steilen Kanon-Berg Hilfestellung leisten. Wer versucht, das mit Gewalt durchzusetzen, wird allenfalls Pfingstkönig."Guardian (UK), 12.11.2018
Respekt (Tschechien), 12.11.2018
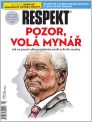 Gleicher, als man oder frau denkt: Silvie Lauder hat sich mit der britischen Wissenschaftsjournalistin Angela Saini unterhalten, die für ihr Buch "Inferior" (Besprechung im Guardian) Hunderte aktueller wissenschaftlicher Studien zum Thema Geschlechterunterschiede ausgewertet hat und von dem Ergebnis selbst überrascht wurde: "Ich habe von Kind an die Wissenschaft geliebt, die klaren Antworten, die etwa die Mathematik anbietet, habe schließlich sogar Maschinenbau studiert - und war in der Klasse gewöhnlich das einzige solche Mädchen. Ich dachte immer, mein Gehirn sei eben nicht so wie das von anderen Frauen und war schockiert, als ich jetzt erkannte, dass dem nicht so ist. … Es gibt kein männliches und kein weibliches Gehirn. Ich bin lediglich einen anderen Weg gegangen als andere Frauen, aber nicht, weil sie ein anderes Gehirn hätten, sondern weil sie anders erzogen wurden oder aus einer anderen Kultur kamen." Auf die Frage nach möglichen Lösungen für das Rollenproblem meint Saini: "Man kann die Dinge ganz allmählich ändern. Ich bin Freiberuflerin, und wenn ich zu irgendeiner Konferenz reise, dann bitte ich mir als Teil des angebotenen Services eine Kinderbetreuung aus. Und sehr häufig kommt man mir entgegen, und wenn es bedeutet, dass die Tochter oder der Sohn des Organisators auf mein Kind aufpasst. Wenn wir alle - Männer wie Frauen - anfangen, bestimmte Dienste einzufordern, und wenn Männer vermehrt Zeit mit ihren Kindern verbringen, dann wird sich die Situation verändern."
Gleicher, als man oder frau denkt: Silvie Lauder hat sich mit der britischen Wissenschaftsjournalistin Angela Saini unterhalten, die für ihr Buch "Inferior" (Besprechung im Guardian) Hunderte aktueller wissenschaftlicher Studien zum Thema Geschlechterunterschiede ausgewertet hat und von dem Ergebnis selbst überrascht wurde: "Ich habe von Kind an die Wissenschaft geliebt, die klaren Antworten, die etwa die Mathematik anbietet, habe schließlich sogar Maschinenbau studiert - und war in der Klasse gewöhnlich das einzige solche Mädchen. Ich dachte immer, mein Gehirn sei eben nicht so wie das von anderen Frauen und war schockiert, als ich jetzt erkannte, dass dem nicht so ist. … Es gibt kein männliches und kein weibliches Gehirn. Ich bin lediglich einen anderen Weg gegangen als andere Frauen, aber nicht, weil sie ein anderes Gehirn hätten, sondern weil sie anders erzogen wurden oder aus einer anderen Kultur kamen." Auf die Frage nach möglichen Lösungen für das Rollenproblem meint Saini: "Man kann die Dinge ganz allmählich ändern. Ich bin Freiberuflerin, und wenn ich zu irgendeiner Konferenz reise, dann bitte ich mir als Teil des angebotenen Services eine Kinderbetreuung aus. Und sehr häufig kommt man mir entgegen, und wenn es bedeutet, dass die Tochter oder der Sohn des Organisators auf mein Kind aufpasst. Wenn wir alle - Männer wie Frauen - anfangen, bestimmte Dienste einzufordern, und wenn Männer vermehrt Zeit mit ihren Kindern verbringen, dann wird sich die Situation verändern."Les inrockuptibles (Frankreich), 11.11.2018
 Die Zahl antisemitischer Straftaten ist in Frankreich stark gestiegen. Nicolas Bove unterhält sich mit Jean-Yves Camus, vom "Observatoire des radicalités politiques" über die historischen und aktuellen Ursprünge des Antisemitismus in Frankreich, die in der Tat sehr vielfältig sind: Der Antisemitismus ist noch virulent in rechtsextremen Kreisen um die Zeitschrift Rivarol, es gibt ihn in der klassisch globalisierungskritischen Linken und unter Muslimen - und Camus bedauert es sehr, dass im laizistischen Frankreich keine Statistiken über den ethnisch-religiösen Hintergrund erlaubt sind. Es gibt außerdem den besonders trüben Zwischenbereich zwischen rechtsextrem und linksextrem, der von dem Komiker Dieudonné besetzt wird, dem viele Jugendliche aus der Banlieue folgen. Auch die "Indigènes de la République", die eine Art postkolonialen Extremismus betreiben, haben Dieudonné mit dem Argument verteidigt, dass der Kampf gegen den Antirassimus wesentlicher sei als der Kampf gegen Antisemitismus: "Solche Reden werden von Leuten gehalten, die sich als Linksradikale sehen, aber eine Idee von der Republik haben, die mir völlig inakzeptabel scheint. Zum einen weil sie nicht auf der Geschichte, sondern auf einer Ideologie der Schuld beruht: Es ist notwendig, die Geschichte des Algerienkriegs, des Sklavenhandels, der Kolonisierung zu schreiben. Viele seriöse Historiker tun das. Aber es besteht ein entscheidender Unterschied zwischen einer Geschichtsschreibung, die Schattenbereiche ausleuchtet… und einer Kulpabilisierung eines Teils der Bevölkerung, weil er aufgrund seines Ursprungs für die Verbrechen seiner Vorfahren verantwortlich sei."
Die Zahl antisemitischer Straftaten ist in Frankreich stark gestiegen. Nicolas Bove unterhält sich mit Jean-Yves Camus, vom "Observatoire des radicalités politiques" über die historischen und aktuellen Ursprünge des Antisemitismus in Frankreich, die in der Tat sehr vielfältig sind: Der Antisemitismus ist noch virulent in rechtsextremen Kreisen um die Zeitschrift Rivarol, es gibt ihn in der klassisch globalisierungskritischen Linken und unter Muslimen - und Camus bedauert es sehr, dass im laizistischen Frankreich keine Statistiken über den ethnisch-religiösen Hintergrund erlaubt sind. Es gibt außerdem den besonders trüben Zwischenbereich zwischen rechtsextrem und linksextrem, der von dem Komiker Dieudonné besetzt wird, dem viele Jugendliche aus der Banlieue folgen. Auch die "Indigènes de la République", die eine Art postkolonialen Extremismus betreiben, haben Dieudonné mit dem Argument verteidigt, dass der Kampf gegen den Antirassimus wesentlicher sei als der Kampf gegen Antisemitismus: "Solche Reden werden von Leuten gehalten, die sich als Linksradikale sehen, aber eine Idee von der Republik haben, die mir völlig inakzeptabel scheint. Zum einen weil sie nicht auf der Geschichte, sondern auf einer Ideologie der Schuld beruht: Es ist notwendig, die Geschichte des Algerienkriegs, des Sklavenhandels, der Kolonisierung zu schreiben. Viele seriöse Historiker tun das. Aber es besteht ein entscheidender Unterschied zwischen einer Geschichtsschreibung, die Schattenbereiche ausleuchtet… und einer Kulpabilisierung eines Teils der Bevölkerung, weil er aufgrund seines Ursprungs für die Verbrechen seiner Vorfahren verantwortlich sei."Ergänzend sei die Lektüre von Paul Bermans Artikel über linken Antisemitismus in Großbritannien, Frankreich und den USA aus Tablet empfohlen.
Film-Dienst (Deutschland), 13.11.2018

In einem großen Essay über das postkinematografische Spätwerk Paul Schraders und über dessen Überlegungen zu einer Kartografie des transzendenten Filmstils im Gegenwartskino hat sich Lukas Foerster auch ausführlich mit Schraders Experiment "Dark" beschäftigt, dessen Entstehungsgeschichte so spektakulär wie tragisch ist: Es handelt sich dabei um eine Neu-Aneignung von Schraders eigenem, mit Nicolas Cage besetzten Low-Budget-Thriller "Dying of the Light", mit dessen Produzenten sich Schrader so unversöhnlich zerstritten hatte, dass er sich von dem Endresultat distanzierte und der Produzent ihm auch keinen Zugang mehr zum Originalmaterial gewährte. "Dark" nun ist ein mit neuer Musik versehener, experimenteller Neu-Schnitt auf Grundlage von Workprint-DVDs und Zuhilfenahme rustikaler Hilfsmittel, ein Neu-Schnitt, der rechtlich so heikel ist, dass er sich nur in Filmarchiven, aber nicht in der Öffentlichkeit sichten lässt: Der Filmemacher "und sein Editor Benjamin Rodriguez sichteten das gesamte ihnen zur Verfügung stehende Material auf einem Fernseher - und filmten währenddessen einfach mit einem Smartphone den Bildschirm ab. Auf diese Weise isolieren sie Details, häufig Gesichter, aber auch Hände, Füße oder Dekorelemente, die anschließend auf Vollbildgröße 'aufgeblasen' und oft zusätzlich durch Zeitlupeneffekte, hektische Schwenks (die kameratechnisch betrachtet keine Schwenks sind, weil die Bewegung erst in der Postproduktion entsteht) oder Ähnliches verfremdet werden. ... Die Bruchstellen sind offensichtlich und auch zusätzlich markiert durch die Materialdifferenz: Schrader und Rodriguez geben sich keine Mühe, die gröbere Textur der nicht allzu hochauflösenden und außerdem zusätzlich durch Spiegeleffekte verfremdeten Handyaufnahmen an das übrige Material anzugleichen. Ganz im Gegenteil bearbeiten sie viele dieser Inserts zusätzlich durch teils exzessive Farbmanipulationen, die das Bild gelegentlich fast pulsieren lassen. ... Die bloß kontingente Falschheit der Direct-to-DVD-Bilder aus 'Dying of the Light' wird in eine andere, intensivere, aber bewusste und deshalb produktivere Falschheit übertragen. Gerade indem sie den Defekt, die Krankheit umarmen, ermöglichen diese neuen Einstellungen eine neue Art des Sehens - die außerdem, auf der erzählerischen Ebene, nicht zu trennen ist von Lakes Gehirnkrankheit. Eine sinnliche Pathologie der Bilder."
Elet es Irodalom (Ungarn), 09.11.2018
 Nach dem in den vergangenen Wochen eine Diskussion über die Zukunft des umstrittenen Erinnerungsprojektes der geplanten Holocaust-Gedenkstätte "Haus der Schicksale" entbrannt war, zeigt sich der renommierte Rechtsanwalt András Hanák (Sohn des legendären Historikers und Holocaust-Überlebenden Péter Hanák) skeptisch gegenüber den zwei Trägern des Projektes, nämlich dem ungarischen Staat einerseits und der hassidischen Gemeinde Chabad (eine der Orthodoxie nahestehenden Richtung innerhalb des religiös-praktizierenden Judentums) andererseits. "Wenn es zwei Protagonisten gäbe, denen ich die Erinnerung an das Schicksal der ungarischen Juden nicht anvertrauen würde, dann wären es diese zwei. (...) Wie wir wissen, lehnt der jetzige ungarische Staat für die Ereignisse nach dem 19. März 1944 die Rechtsnachfolge ab. Für die aus New York stammende Chabad-Gemeinde auf der anderen Seite spielt der Holocaust in ihrem auf die Ankunft des Messias wartenden Gedankensystem eine diametral andere Rolle als für die traditionellen orthodoxen Juden."
Nach dem in den vergangenen Wochen eine Diskussion über die Zukunft des umstrittenen Erinnerungsprojektes der geplanten Holocaust-Gedenkstätte "Haus der Schicksale" entbrannt war, zeigt sich der renommierte Rechtsanwalt András Hanák (Sohn des legendären Historikers und Holocaust-Überlebenden Péter Hanák) skeptisch gegenüber den zwei Trägern des Projektes, nämlich dem ungarischen Staat einerseits und der hassidischen Gemeinde Chabad (eine der Orthodoxie nahestehenden Richtung innerhalb des religiös-praktizierenden Judentums) andererseits. "Wenn es zwei Protagonisten gäbe, denen ich die Erinnerung an das Schicksal der ungarischen Juden nicht anvertrauen würde, dann wären es diese zwei. (...) Wie wir wissen, lehnt der jetzige ungarische Staat für die Ereignisse nach dem 19. März 1944 die Rechtsnachfolge ab. Für die aus New York stammende Chabad-Gemeinde auf der anderen Seite spielt der Holocaust in ihrem auf die Ankunft des Messias wartenden Gedankensystem eine diametral andere Rolle als für die traditionellen orthodoxen Juden."Slate.fr (Frankreich), 05.11.2018
New Yorker (USA), 19.11.2018
 In der aktuellen Ausgabe des New Yorker gehen Adam Entous und Jon Lee Anderson den unter dem Namen Havanna-Syndrom bekannten rätselhaften Hirnbeschwerden nach, die amerikanische Diplomaten in ihrer Botschaft in der kubanischen Hauptstadt ereilte und die man Russland oder China zugeschrieben hat, allerdings bisher ohne Beweise: "Die Betroffenen litten unter Kopfschmerz, Schwindel und einer Reihe weiterer Symptome. Die Untersuchung durch Neurologen ergab, dass die Symptome einem Schädel-Hirn-Trauma glichen, vergleichbar jenem von Soldaten, die in Afghanistan und im Irak Opfer von Bombenattentaten wurden, nur dass es keine äußeren Anzeichen gab. Es handelte sich um ein Trauma ohne Trauma. Douglas Smith, der die Untersuchung leitete, sagte, nie habe jemand dergleichen gesehen. CIA-Experten zeigten sich alarmiert von der neuen Bedrohung von US-Personal im Ausland, wie es seit dem Kalten Krieg nicht vorgekommen ist. Mangels Alternative nannte man es das Ding … Erklärungsversuche reichen von akustischen Waffen bis zu Mikrowellen." Nach anderthalb Jahren sind die Amerikaner in der Aufklärung keinen Schritt weiter. Der größte Teil des diplomatischen Personals wurde inzwischen aus Kuba abgezogen. Die wenigen in Kuba verbliebenen amerikanischen Diplomaten leben derzeit "im Ausnahmezustand".
In der aktuellen Ausgabe des New Yorker gehen Adam Entous und Jon Lee Anderson den unter dem Namen Havanna-Syndrom bekannten rätselhaften Hirnbeschwerden nach, die amerikanische Diplomaten in ihrer Botschaft in der kubanischen Hauptstadt ereilte und die man Russland oder China zugeschrieben hat, allerdings bisher ohne Beweise: "Die Betroffenen litten unter Kopfschmerz, Schwindel und einer Reihe weiterer Symptome. Die Untersuchung durch Neurologen ergab, dass die Symptome einem Schädel-Hirn-Trauma glichen, vergleichbar jenem von Soldaten, die in Afghanistan und im Irak Opfer von Bombenattentaten wurden, nur dass es keine äußeren Anzeichen gab. Es handelte sich um ein Trauma ohne Trauma. Douglas Smith, der die Untersuchung leitete, sagte, nie habe jemand dergleichen gesehen. CIA-Experten zeigten sich alarmiert von der neuen Bedrohung von US-Personal im Ausland, wie es seit dem Kalten Krieg nicht vorgekommen ist. Mangels Alternative nannte man es das Ding … Erklärungsversuche reichen von akustischen Waffen bis zu Mikrowellen." Nach anderthalb Jahren sind die Amerikaner in der Aufklärung keinen Schritt weiter. Der größte Teil des diplomatischen Personals wurde inzwischen aus Kuba abgezogen. Die wenigen in Kuba verbliebenen amerikanischen Diplomaten leben derzeit "im Ausnahmezustand".In einem weiteren spannenden Text untersucht Rebecca Mead die innovativen und manchmal auch manipulativen Seiten von Podcasts: "Es handelt sich um ein sehr intimes Medium, das üblicherweise über Kopfhörer und mit einem einzelnen Hörer funktioniert und so eindringlich sein kann wie kein Küchenradio. Podcasts sind dazu gemacht, mit Zeit genossen zu werden; sie sind für die Momente, wenn das Smartphone Pause hat. Als digitales Medium sind sie eher ungewöhnlich durch ihr Abzielen auf eine langsam aufbauende sinnliche Atmosphäre." Das macht es manchmal aber auch noch schwerer, den Unterschied zwischen Fakten und Fiktion zu erkennen.
Weiteres: Anlässlich von Julian Schnabels Film "At Eternity's Gate" fragt Anthony Lane: Warum lieben Filmemacher van Gogh? Adam Kirsch liest Hermann Hesse. Peter Schjeldahl besucht die Retrospektive des "wundervollen" Andy Warhol im Whitneys. Hua Hsu hört Harfenmusik von Jeff Majors und Mary Lattimore. Anthony Lane sah im Kino Steve McQueens Film "Widows".
Kommentieren












