Magazinrundschau
Schmerzhaftes Quietschen
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
17.01.2017. Im Jacobin fordert der syrische Autor Yasser Munif die westliche Linke auf, endlich die Anatomie des syrischen Regimes anzuerkennen. Im CulturMag analysiert Dominik Graf liebevoll die erstaunlichen Sonderwege des deutschen Films. Es war Frauenverachtung, die Donald Trump nach oben gebracht hat, hält die LRB fest. In HVG erklärt Verleger Sándor Mészáros, warum der slowakisch-ungarische Verlag Kalligram nach 25 Jahren aufgeteilt wird. London ist der sichere Hafen für korruptes Kapital, lernt der Guardian.
Jacobin | Backchannel | Linkiesta | New York Times | CulturMag | Respekt | London Review of Books | El Espectador | New Yorker | HVG | Guardian
Jacobin (USA), 09.01.2017
 Da in Syrien nicht die üblichen Verdächtigen Amerika und Israel als die Bösen figurieren, bringt die westliche Linke kaum Interesse für diesen Konflikt auf. Umso tapferer das große Gespräch im marxistischen New Yorker Magazin Jacobin, in dem der syrische Autor Yasser Munif die westliche Linke auffordert, die Verantwortung Baschar al-Assads und Wladimir Putins zu benennen. Nebenbei erklärt er einige Hintergrundaspekte, die die Hartnäckigkeit des Assad-Regimes verständlich machen: "Es ist nicht klar, warum Teile der Linken die Anatomie des syrischen Regimes nicht verstehen, das sich allein auf diese Vaterfigur bezieht, in seinen Slogans, seiner Ideologie, selbst in den vielen Graffiti auf den Straßen. Wenn Assad gestürzt würde, könnte auch das Regime nicht sehr lange überleben, denn es ist so gebaut, dass es fast unmöglich ist, den Kopf vom Körper zu trennen. Anders als in Ägypten, wo es Institutionen gibt, die den Austausch des Diktators erlauben, wie wir sehen konnten, als Sisi Mubarak ersetzte und das ganze System erhielt, ist ein solches Szenario in Syrien meiner Meinung nach nicht möglich. Es ist kaum möglich Assad abzusetzen, und in Syrien die Diktatur zu erhalten."
Da in Syrien nicht die üblichen Verdächtigen Amerika und Israel als die Bösen figurieren, bringt die westliche Linke kaum Interesse für diesen Konflikt auf. Umso tapferer das große Gespräch im marxistischen New Yorker Magazin Jacobin, in dem der syrische Autor Yasser Munif die westliche Linke auffordert, die Verantwortung Baschar al-Assads und Wladimir Putins zu benennen. Nebenbei erklärt er einige Hintergrundaspekte, die die Hartnäckigkeit des Assad-Regimes verständlich machen: "Es ist nicht klar, warum Teile der Linken die Anatomie des syrischen Regimes nicht verstehen, das sich allein auf diese Vaterfigur bezieht, in seinen Slogans, seiner Ideologie, selbst in den vielen Graffiti auf den Straßen. Wenn Assad gestürzt würde, könnte auch das Regime nicht sehr lange überleben, denn es ist so gebaut, dass es fast unmöglich ist, den Kopf vom Körper zu trennen. Anders als in Ägypten, wo es Institutionen gibt, die den Austausch des Diktators erlauben, wie wir sehen konnten, als Sisi Mubarak ersetzte und das ganze System erhielt, ist ein solches Szenario in Syrien meiner Meinung nach nicht möglich. Es ist kaum möglich Assad abzusetzen, und in Syrien die Diktatur zu erhalten."CulturMag (Deutschland), 15.01.2017
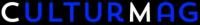 Wohl kein zweiter schreibt so sinnlich wie kundig über die Geschichte des BRD-Kinos wie der Filmemacher Dominik Graf. Das CulturMag bringt die "Director's Cut"-Fassung von Grafs Beitrag zur filmhistorischen Aufsatzsammlung "Geliebt und verdrängt" über das deutsche Kino der 50er Jahre, die anlässlich der Retrospektive beim Filmfestival in Locarno erschienen ist. In seinem Essay ertastet der Regisseur die Konturen des Männerkörpers im Nachkriegskino, die sich ihm unter anderem auch in den Synchronisationen amerikanischer Filme offenbaren: Diese Praxis mag als Ausweis von Provinzialismus gelten, doch sie hat auch "deutschen Schauspielern sprachliche Coolness gelehrt, wenn sie Jean Paul Belmondo oder Humphrey Bogart sprechen konnten. Hinzu kommt, daß die deutschen Mimen im Synchronstudio vollends die Sau rauslassen konnten, ja mußten, wenn sie sich an Louis de Funes' oder Alberto Sordis Tempi angleichen sollten. Und so sah man bzw hörte, was sie alle technisch-schauspielerisch konnten! Zu solchen Höchst-Leistungen gab ihnen nämlich das deutsche Kino ab den 70ern nur noch selten Gelegenheit. ...Um zu einem gerechten Urteil des westdeutschen Kinos (im Grund bis in die Jetzt-Zeit) zu kommen, muß man solche erstaunlichen Sonderwege des deutschen Films auch ans Herz drücken können, will sagen: erspüren, wie sehr die Grenzen, die Übergänge stets ineinander flossen. Wahnsinn und Modernität, Tradition und Lüge, Verdrängung und wunderbares Understatement, Aufrichtigkeit, Kunst und Kunstgewerbe sind Nachbarn im deutschen Film und erzeugen so ein schmerzhaftes Quietschen in den Scharnieren der Darstellung, der Herstellung - aber auch oft eine wirklich einzigartige Schwingung der Filme."
Wohl kein zweiter schreibt so sinnlich wie kundig über die Geschichte des BRD-Kinos wie der Filmemacher Dominik Graf. Das CulturMag bringt die "Director's Cut"-Fassung von Grafs Beitrag zur filmhistorischen Aufsatzsammlung "Geliebt und verdrängt" über das deutsche Kino der 50er Jahre, die anlässlich der Retrospektive beim Filmfestival in Locarno erschienen ist. In seinem Essay ertastet der Regisseur die Konturen des Männerkörpers im Nachkriegskino, die sich ihm unter anderem auch in den Synchronisationen amerikanischer Filme offenbaren: Diese Praxis mag als Ausweis von Provinzialismus gelten, doch sie hat auch "deutschen Schauspielern sprachliche Coolness gelehrt, wenn sie Jean Paul Belmondo oder Humphrey Bogart sprechen konnten. Hinzu kommt, daß die deutschen Mimen im Synchronstudio vollends die Sau rauslassen konnten, ja mußten, wenn sie sich an Louis de Funes' oder Alberto Sordis Tempi angleichen sollten. Und so sah man bzw hörte, was sie alle technisch-schauspielerisch konnten! Zu solchen Höchst-Leistungen gab ihnen nämlich das deutsche Kino ab den 70ern nur noch selten Gelegenheit. ...Um zu einem gerechten Urteil des westdeutschen Kinos (im Grund bis in die Jetzt-Zeit) zu kommen, muß man solche erstaunlichen Sonderwege des deutschen Films auch ans Herz drücken können, will sagen: erspüren, wie sehr die Grenzen, die Übergänge stets ineinander flossen. Wahnsinn und Modernität, Tradition und Lüge, Verdrängung und wunderbares Understatement, Aufrichtigkeit, Kunst und Kunstgewerbe sind Nachbarn im deutschen Film und erzeugen so ein schmerzhaftes Quietschen in den Scharnieren der Darstellung, der Herstellung - aber auch oft eine wirklich einzigartige Schwingung der Filme."Sehr unterhaltsam und erfreulich ausführlich geraten ist auch ein Beitrag von Lee Child, in dem der Bestsellerautor erklärt, wie er seine Thrillerfigur Jack Reacher ersonnen hat. Unter anderem erfahren wir auch, dass die ikonische Figur ihren Namen auf sehr unkonventionelle Weise erhalten hat - beim Einkauf: "Im Supermarkt trat - was für große Männer eine alltägliche Erfahrung ist - eine kleine alte Dame zu mir und sagte: 'Sie sind ein recht großer Mann, könnten Sie mir bitte diese Dose reichen (Englisch: 'to reach')?' Meine Frau sagte zu mir: 'Wenn das mit dem Schreiben nicht funktioniert, kannst du jederzeit als Reicher (Englisch: 'reacher') im Supermarkt arbeiten.' Ich dachte, was für ein toller Name! Und ich nahm ihn und muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich im Internet Kommentare lese, in denen es heißt, dass ich den Namen gewählt hätte, weil das Zielstrebige und Unaufhaltsame darin enthalten seien." Dazu ein Hinweis in eigener Sache: Bereits 2007 hat Perlentaucher Ekkehard Knörer einen Essay über diesen großartigen Thriller-Zyklus geschrieben, der Reacher-Neulingen gut als Einstieg dienen kann.
Außerdem: Ein Auszug aus Georg Seeßlens neuem Buch, in dem der umtriebige Kulturkritiker das Phänomen Trump aus Perspektive der Popkultur deutet.
Respekt (Tschechien), 15.01.2017
 Erik Tabery, Chefredakteur des tschechischen Wochenmagazins Respekt, wünscht sich mehr intellektuelle Redlichkeit bei der Benennung von Gegenwartsphänomenen: "Es gibt Momente, wo die Sprache uns verrät. Angesichts unserer genannten Geschichtskenntnisse haben wir die Tendenz, aktuelle Ereignisse mit den vergangenen zu vergleichen. Häufig benutzen wir dafür sogar den Begriff 'Neo' - wir haben also einen Neonazismus, einen Neofaschismus und, immer öfter zu hören, einen Neomarxismus. Nach der Wahl Donald Trumps behalf sich eine Reihe von Journalisten und Beobachtern mit dem Begriff 'Faschismus', um das Trump-Phänomen zu beschreiben. Und auch bei uns lesen wir ab und zu von einer Faschisierung der Gesellschaft." Diese Schlagwörter bewirken jedoch laut Tabery ein Abstumpfen der Sensibilität für ganz neue Formen der Bedrohung für die freie Gesellschaft. "Der Fall Ungarn beweist, dass es möglich ist, ein relativ unfreies Land zu schaffen, das weder mit dem Faschismus noch mit dem Kommunismus zu tun hat. Wenn heute also etwas nottut, dann dass wir uns von den diversen Stempeln lösen - auch wenn die Erinnerung an die Geschichte weiter von großer Bedeutung ist - und nach einer eigenen Interpretation für das gegenwärtige Geschehen suchen."
Erik Tabery, Chefredakteur des tschechischen Wochenmagazins Respekt, wünscht sich mehr intellektuelle Redlichkeit bei der Benennung von Gegenwartsphänomenen: "Es gibt Momente, wo die Sprache uns verrät. Angesichts unserer genannten Geschichtskenntnisse haben wir die Tendenz, aktuelle Ereignisse mit den vergangenen zu vergleichen. Häufig benutzen wir dafür sogar den Begriff 'Neo' - wir haben also einen Neonazismus, einen Neofaschismus und, immer öfter zu hören, einen Neomarxismus. Nach der Wahl Donald Trumps behalf sich eine Reihe von Journalisten und Beobachtern mit dem Begriff 'Faschismus', um das Trump-Phänomen zu beschreiben. Und auch bei uns lesen wir ab und zu von einer Faschisierung der Gesellschaft." Diese Schlagwörter bewirken jedoch laut Tabery ein Abstumpfen der Sensibilität für ganz neue Formen der Bedrohung für die freie Gesellschaft. "Der Fall Ungarn beweist, dass es möglich ist, ein relativ unfreies Land zu schaffen, das weder mit dem Faschismus noch mit dem Kommunismus zu tun hat. Wenn heute also etwas nottut, dann dass wir uns von den diversen Stempeln lösen - auch wenn die Erinnerung an die Geschichte weiter von großer Bedeutung ist - und nach einer eigenen Interpretation für das gegenwärtige Geschehen suchen."London Review of Books (UK), 16.01.2017
 Es war Frauenverachtung, die Donald Trump nach oben gebracht hat, hält Rebecca Solnit in einem zornigen Text fest. Sie erinnert noch einmal daran, dass Trumps Aufstieg und der Niedergang wahrheitsgetreuer Medien in großem Maße vom Sender Fox News befeuert wurde, den Trumps Medienberater Roger Ailes wie ein Ein-Mann-Bordell geführt hatte. Aber die Misogynie zeigt sich für Solnit vor allem darin, dass Hillary Clinton machen konnte, was sie wollte, sie war immer schuld: "Allein Hillary Clinton stand zwischen uns und einem rücksichtslosen, instabilen, ignoranten, geistlosen, unendlich vulgären, den Klimawandel leugnenden, weiß-nationalistischen Frauenfeind mit autoritären Ambitionen und kleptokratischen Plänen. Doch viele Leute, besonders weiße Männer, konnten sie nicht leiden, und das ist eben auch ein Grund für Trumps Sieg. ... Nie gaben sich diese Männer selbst die Schuld, dass sie Donald Trump nicht aufgehalten haben, auch nicht den Wahlmännern und nicht dem System."
Es war Frauenverachtung, die Donald Trump nach oben gebracht hat, hält Rebecca Solnit in einem zornigen Text fest. Sie erinnert noch einmal daran, dass Trumps Aufstieg und der Niedergang wahrheitsgetreuer Medien in großem Maße vom Sender Fox News befeuert wurde, den Trumps Medienberater Roger Ailes wie ein Ein-Mann-Bordell geführt hatte. Aber die Misogynie zeigt sich für Solnit vor allem darin, dass Hillary Clinton machen konnte, was sie wollte, sie war immer schuld: "Allein Hillary Clinton stand zwischen uns und einem rücksichtslosen, instabilen, ignoranten, geistlosen, unendlich vulgären, den Klimawandel leugnenden, weiß-nationalistischen Frauenfeind mit autoritären Ambitionen und kleptokratischen Plänen. Doch viele Leute, besonders weiße Männer, konnten sie nicht leiden, und das ist eben auch ein Grund für Trumps Sieg. ... Nie gaben sich diese Männer selbst die Schuld, dass sie Donald Trump nicht aufgehalten haben, auch nicht den Wahlmännern und nicht dem System."Sehr lesenswert erzählt Adam Shatz die Geschichte Frantz Fanons nach, dessen Schriften in Frankreich gerade neu herausgegeben wurden. Shatz erinnert an Fanons Theorie der Entkolonialisierung, seine Zeit als Psychiater im Algerienkrieg, seinen Glauben an die Gewalt und kommt dann zu einem Schluss, der sehr typisch ist für die amerikanische Linke: "Der Universalismus ist als Währung entwertet: Bei allem Gerede von Transnationalismus sind die einzigen beiden postnationalen Projekte, die derzeit im Angebot stehen, die flache Welt der Globalisierung und die islamistische Tabula Rasa des Kalifats: Davos und Dabiq. Doch Fanon wird nicht verschwinden. Den Glauben an die reinigende Kraft der Gewalt teilt nicht nur der Islamische Staat, dessen spektakuläre Attacken und aufgeschlitzte Kehlen einer Low-Tech-Variante von 'Shock and Awe' gleich kommen, sondern auch die Architekten des Dronenkriegs und der humanitären Intervention. Die von Fanon aufgeworfenen Fragen über die Grenzen des westlichen Humanismus und die Kluft zwischen Arm und Reich, sind noch immer relevant."
Weiteres: Seit die USA auch europäische Firmen belangen, wenn diese im Ausland bestechen oder korrumpieren, betonen vor allem Ölkonzerne ihre strengen Compliance-Regeln. Alexander Briant erzählt, wie er von einem "britischen Ölkonzern" als Anwalt nach Nigeria geschickt wurde, um intern in Port Harcourt zu ermitteln.
El Espectador (Kolumbien), 15.01.2017
 "Von Lesbos nach Jericó." Héctor Abad fordert Solidarität mit Flüchtlingen: "Kolumbien war lange Zeit allergisch gegen Immigranten. Nicht weil die Menschen hier fremdenfeindlich sind - im Gegenteil, ein guter Teil der Kolumbianer ist durchaus fremdenfreundlich, wie mir scheint -, aber die Regierungen waren es seit jeher, jedenfalls wenn es um Morisken, Juden, Muslime, Konvertierte oder Protestanten ging. Dafür sorgte auch der starke Einfluss der katholischen Kirche. Millionen Kolumbianer haben während des vierzigjährigen gewaltsamen Konfliktes in anderen Ländern Zuflucht gesucht. Jetzt gilt es, etwas zurückzugeben und - viel verlange ich für den Anfang gar nicht - wenigstens 200 oder 300 syrische, iranische oder afghanische Familien in Kolumbien aufzunehmen, die zurzeit auf den griechischen Inseln frierend in Eis und Schnee festsitzen. Das ist so gut wie nichts, aber gar nichts wäre noch schlimmer. Kolumbien muss und kann das leisten."
"Von Lesbos nach Jericó." Héctor Abad fordert Solidarität mit Flüchtlingen: "Kolumbien war lange Zeit allergisch gegen Immigranten. Nicht weil die Menschen hier fremdenfeindlich sind - im Gegenteil, ein guter Teil der Kolumbianer ist durchaus fremdenfreundlich, wie mir scheint -, aber die Regierungen waren es seit jeher, jedenfalls wenn es um Morisken, Juden, Muslime, Konvertierte oder Protestanten ging. Dafür sorgte auch der starke Einfluss der katholischen Kirche. Millionen Kolumbianer haben während des vierzigjährigen gewaltsamen Konfliktes in anderen Ländern Zuflucht gesucht. Jetzt gilt es, etwas zurückzugeben und - viel verlange ich für den Anfang gar nicht - wenigstens 200 oder 300 syrische, iranische oder afghanische Familien in Kolumbien aufzunehmen, die zurzeit auf den griechischen Inseln frierend in Eis und Schnee festsitzen. Das ist so gut wie nichts, aber gar nichts wäre noch schlimmer. Kolumbien muss und kann das leisten."New Yorker (USA), 23.01.2017
 In der neuen Ausgabe des New Yorker beklagt Atul Gawande den Verlust intensiver ärztlicher Behandlung auch über längere Zeiträume: "Wir haben heroische Erwartungen an die Medizin. Nach dem Krieg heilten Penizillin und andere Antiobotika bakterielle Erkrankungen, von denen man angenommen hatte, dass nur Gott sie beenden könnte. Polio, Diphterie, Masern wurden erfolgreich bekämpft. Die Chirurgie öffnete Herzen, verpflanzte Organe und entfernte einst als inoperabel geltende Tumore. Infarkte konnten gestoppt, Krebs gehilt werden. Eine einzige Generation erfuhr eine Verwandlung in der Behandlung menschlicher Erkrankungen wie keine andere zuvor. Es war wie die Entdeckung des Wassers als Mittel gegen Feuer. Und genauso ist unser Gesundheitssystem: Ärzte sind die Feuerwehr. Aber das Modell hat einen Fehler. Wenn eine Krankheit ein Feuer ist, so braucht es unter Umständen Monate oder Jahre, um sie zu löschen. Die Behandlung kann Nebeneffekte haben, Komplikationen, die weitere Aufmerksamkeit benötigen. Chronische Krankheiten sind heute normal, aber wir sind darauf schlecht vorbereitet. Vieles, was uns leiden lässt, braucht ein geduldigeres Können."
In der neuen Ausgabe des New Yorker beklagt Atul Gawande den Verlust intensiver ärztlicher Behandlung auch über längere Zeiträume: "Wir haben heroische Erwartungen an die Medizin. Nach dem Krieg heilten Penizillin und andere Antiobotika bakterielle Erkrankungen, von denen man angenommen hatte, dass nur Gott sie beenden könnte. Polio, Diphterie, Masern wurden erfolgreich bekämpft. Die Chirurgie öffnete Herzen, verpflanzte Organe und entfernte einst als inoperabel geltende Tumore. Infarkte konnten gestoppt, Krebs gehilt werden. Eine einzige Generation erfuhr eine Verwandlung in der Behandlung menschlicher Erkrankungen wie keine andere zuvor. Es war wie die Entdeckung des Wassers als Mittel gegen Feuer. Und genauso ist unser Gesundheitssystem: Ärzte sind die Feuerwehr. Aber das Modell hat einen Fehler. Wenn eine Krankheit ein Feuer ist, so braucht es unter Umständen Monate oder Jahre, um sie zu löschen. Die Behandlung kann Nebeneffekte haben, Komplikationen, die weitere Aufmerksamkeit benötigen. Chronische Krankheiten sind heute normal, aber wir sind darauf schlecht vorbereitet. Vieles, was uns leiden lässt, braucht ein geduldigeres Können."Außerdem: John Seabrook singt seine persönliche Ballade von der Alkoholabhängigkeit. Jonathan Blitzer berichtet über das gefährliche Leben aus den USA abgeschobener Immigranten in El Salvador. Und Sarah Stillman sorgt sich um das Fortbestehen von Obamas Verhaltenforscher-Teams unter einem wissenschaftsskeptischen Präsidenten. Benjamin Kunkel stellt den argentinischen Autor Antonio Di Benedetto vor, dessen Roman "Zama" er als Meisterwerk feiert wie vor ihm schon J.M. Coetzee in der NYRB (unser Resümee). Alex Ross feiert den "Guerilla Minimalismus" des Komponisten Julius Eastman. Lesen dürfen wir außerdem Elif Batumans Short Story "Constructed Worlds"
HVG (Ungarn), 17.01.2017
 Nach 25 Jahren wird der slowakisch-ungarische Verlag Kalligram mit bisherigem Sitz in Bratislava aufgeteilt. Unter anderem war es ein Anliegen des Verlags die slowakische und die ungarische Literatur in der jeweils anderen Öffentlichkeit vorzustellen. So veröffentlichte Kalligram in dieser Zeit um die hundert Werke der zeitgenössischen ungarischen Literatur in der Slowakei. Der Chefredakteur und Eigentümer des nunmehr ungarischen Teils des Verlags, Sándor Mészáros erklärt die Teilung: "Der Verlag startete mit dem ernsten Vorsatz: Grenzen sind nicht interessant, fokussiert wird es auf die zeitgenössische slowakisch-ungarische Literatur. Die ungarisch-sprachige Kalligram macht weiter, der slowakische Teil wird sich dagegen verändern. (...) Referenz für die slowakische zeitgenössische Literatur war immer die tschechische Literatur. Doch durch unsere Veröffentlichungen wurde die slowakische Literatur auch von der ungarischen inspiriert. Esterházys 'Harmonia Caelestis' und noch mehr Lajos Grendel, dessen gesamtes Lebenswerk auf Slowakisch zugänglich ist und der fruchtbar zum Heraustreten der slowakischen Prosa aus der großrealistischen Tradition beitrug. Umgekehrt gilt diese Wirkung weniger, denn bei uns wurden nur wenige slowakische Schriftsteller bekannt. Grundsätzlich ging die Interesse an den Geist von 'Zwischen-Europa' zurück. Der ungarische Leser schaut auf angelsächsische und deutsche Bestsellerautoren. Seine Kenntnisse der polnischen, tschechischen, rumänischen, serbischen, slowenischen und slowakischen Literaturen sind lückenhaft bis sporadisch."
Nach 25 Jahren wird der slowakisch-ungarische Verlag Kalligram mit bisherigem Sitz in Bratislava aufgeteilt. Unter anderem war es ein Anliegen des Verlags die slowakische und die ungarische Literatur in der jeweils anderen Öffentlichkeit vorzustellen. So veröffentlichte Kalligram in dieser Zeit um die hundert Werke der zeitgenössischen ungarischen Literatur in der Slowakei. Der Chefredakteur und Eigentümer des nunmehr ungarischen Teils des Verlags, Sándor Mészáros erklärt die Teilung: "Der Verlag startete mit dem ernsten Vorsatz: Grenzen sind nicht interessant, fokussiert wird es auf die zeitgenössische slowakisch-ungarische Literatur. Die ungarisch-sprachige Kalligram macht weiter, der slowakische Teil wird sich dagegen verändern. (...) Referenz für die slowakische zeitgenössische Literatur war immer die tschechische Literatur. Doch durch unsere Veröffentlichungen wurde die slowakische Literatur auch von der ungarischen inspiriert. Esterházys 'Harmonia Caelestis' und noch mehr Lajos Grendel, dessen gesamtes Lebenswerk auf Slowakisch zugänglich ist und der fruchtbar zum Heraustreten der slowakischen Prosa aus der großrealistischen Tradition beitrug. Umgekehrt gilt diese Wirkung weniger, denn bei uns wurden nur wenige slowakische Schriftsteller bekannt. Grundsätzlich ging die Interesse an den Geist von 'Zwischen-Europa' zurück. Der ungarische Leser schaut auf angelsächsische und deutsche Bestsellerautoren. Seine Kenntnisse der polnischen, tschechischen, rumänischen, serbischen, slowenischen und slowakischen Literaturen sind lückenhaft bis sporadisch."Guardian (UK), 14.01.2017
 Jamie Doward erzählt in einem sehr lesenswerten Hintergrundartikel, wie London und Großbritannien immer mehr zu einem sicheren Hafen für korruptes Kapital und seine Eigner wird, in einem Ausmaß, das inzwischen sogar wohlhabende Londoner aus ihren Vierteln vertreibt. Mehr als hunderttausend Grundstücke und Immobilien - oft in den allerbesten Lagen - in London und und bevorzugten Landhausregionen gehören anonymen Personengesellschaften. Selbst Transparency International ist nicht in der Lage, die eigentlichen Besitzer dieser Immobilien zu benennen. Bei den Besitzern der Filetstücke handelt es sich häufig um Oligarchen und Diktatorenkinder: Das nach Britannien fließende Kapital "ernährt eine Armee von ausgepichten PR-Profis, die auf 'reputation laundering' spezialisiert sind - das heißt, sie helfen zweifelhaften Individuen ihren sozialen Status zu verbessern, indem sie sicherstellen, dass sie zu den richtigen Parties und Fundraisingdinners eingeladen werden und dass sie ihr Geld bei den richtigen Wohltätigkeitsorganisationen, Thinktanks und Galerien ausgeben. London ist auch eine von einem halben Dutzend Städten - neben Dubai, New York, Shanghai, Peking und Hong Kong -, wo man nicht nur gut kaufen kann, sondern auch die Profis für komplexe finanzielle Transaktionen findet."
Jamie Doward erzählt in einem sehr lesenswerten Hintergrundartikel, wie London und Großbritannien immer mehr zu einem sicheren Hafen für korruptes Kapital und seine Eigner wird, in einem Ausmaß, das inzwischen sogar wohlhabende Londoner aus ihren Vierteln vertreibt. Mehr als hunderttausend Grundstücke und Immobilien - oft in den allerbesten Lagen - in London und und bevorzugten Landhausregionen gehören anonymen Personengesellschaften. Selbst Transparency International ist nicht in der Lage, die eigentlichen Besitzer dieser Immobilien zu benennen. Bei den Besitzern der Filetstücke handelt es sich häufig um Oligarchen und Diktatorenkinder: Das nach Britannien fließende Kapital "ernährt eine Armee von ausgepichten PR-Profis, die auf 'reputation laundering' spezialisiert sind - das heißt, sie helfen zweifelhaften Individuen ihren sozialen Status zu verbessern, indem sie sicherstellen, dass sie zu den richtigen Parties und Fundraisingdinners eingeladen werden und dass sie ihr Geld bei den richtigen Wohltätigkeitsorganisationen, Thinktanks und Galerien ausgeben. London ist auch eine von einem halben Dutzend Städten - neben Dubai, New York, Shanghai, Peking und Hong Kong -, wo man nicht nur gut kaufen kann, sondern auch die Profis für komplexe finanzielle Transaktionen findet."Backchannel (USA), 11.01.2017
 BitTorrent ist nicht nur eine Technologie, sondern auch eine Firma, ursprünglich gegründet von Bram Cohen, dem Erfinder des Programms, mit dem sich große Datenmengen in Netzwerken bewegen lassen. Es wurde zum illegalen Download von Filmen genutzt, ist aber selbst absolut legal. Auch Firmen wie Twitter und Facebook setzen es ein, um ihre riesigen Datenmengen zu bewältigen. Nur die Firma ist so gut wie pleite. Jessi Hempel erzählt in traurigen Details in Backchannel, einem Wired-Ableger, wie Versuch um Versuch misslang, ein Geschäftsmodell für BitTorrent zu finden - auch die Idee, eine Konkurrenz zu Netflix aufzubauen, scheiterte: "Jeder meiner Gesprächspartner hat eine andere Idee darüber, was falsch lief mit dem Start up. Interne Kämpfe. Übermäßige Ausgaben. Strategische Fehler. Aber absolut alle waren sich in einem Punkt einig: Cohens Erfindung war brillant... Vielleicht ist die Lektion hieraus, dass Technologien nicht immer Produkte sind. Und sie sind nicht Firmen. Sie sind eben nur verdammit gute Technologien."
BitTorrent ist nicht nur eine Technologie, sondern auch eine Firma, ursprünglich gegründet von Bram Cohen, dem Erfinder des Programms, mit dem sich große Datenmengen in Netzwerken bewegen lassen. Es wurde zum illegalen Download von Filmen genutzt, ist aber selbst absolut legal. Auch Firmen wie Twitter und Facebook setzen es ein, um ihre riesigen Datenmengen zu bewältigen. Nur die Firma ist so gut wie pleite. Jessi Hempel erzählt in traurigen Details in Backchannel, einem Wired-Ableger, wie Versuch um Versuch misslang, ein Geschäftsmodell für BitTorrent zu finden - auch die Idee, eine Konkurrenz zu Netflix aufzubauen, scheiterte: "Jeder meiner Gesprächspartner hat eine andere Idee darüber, was falsch lief mit dem Start up. Interne Kämpfe. Übermäßige Ausgaben. Strategische Fehler. Aber absolut alle waren sich in einem Punkt einig: Cohens Erfindung war brillant... Vielleicht ist die Lektion hieraus, dass Technologien nicht immer Produkte sind. Und sie sind nicht Firmen. Sie sind eben nur verdammit gute Technologien."Linkiesta (Italien), 14.01.2017
 Zum Glück gibt es Alain Badiou, der die Weltformel schon parat hat. Es handelt sich um den Marxismus, mit dessen Bibeln in der Hand wir nur noch Revolution machen müssen, erklärt er Nicola Grolla. Vom Internet dürfe man sich dagegen nichts erwarten. Es sei nur ein Sphäre, die die Entstehung neuer Weltkonzerene und polizeilicher Überwachung begünstigt habe. "Auch die elektronischen Spiele verdummen nur ihre Fanatiker. Die Sache ist, dass wir all diese Kindereien beiseite lassen und verstehen müssen, dass die Technik seit drei Jahrhunderten nur die entscheidende Zone kapitalistischer Berecherung ist: von der Dampfmaschine bis zu den Atomkraftwerken, von der Laterna magica bis zum Fernsehen, vom Kartenspiel bis Pokémon. Das ist alles nichts Neues, während es unser Pflicht bleibt, die Alternative zu denken."
Zum Glück gibt es Alain Badiou, der die Weltformel schon parat hat. Es handelt sich um den Marxismus, mit dessen Bibeln in der Hand wir nur noch Revolution machen müssen, erklärt er Nicola Grolla. Vom Internet dürfe man sich dagegen nichts erwarten. Es sei nur ein Sphäre, die die Entstehung neuer Weltkonzerene und polizeilicher Überwachung begünstigt habe. "Auch die elektronischen Spiele verdummen nur ihre Fanatiker. Die Sache ist, dass wir all diese Kindereien beiseite lassen und verstehen müssen, dass die Technik seit drei Jahrhunderten nur die entscheidende Zone kapitalistischer Berecherung ist: von der Dampfmaschine bis zu den Atomkraftwerken, von der Laterna magica bis zum Fernsehen, vom Kartenspiel bis Pokémon. Das ist alles nichts Neues, während es unser Pflicht bleibt, die Alternative zu denken."New York Times (USA), 15.01.2017
 In der aktuellen Ausgabe des New York Times Magazines macht uns Jon Mooallem mit einem nahen Verwandten bekannt: dem Neanderthaler. "Neanderthaler begruben ihre Toten wie der Homo sapiens auch, sie stellten Schmuck, Werkzeuge und Pigmente her, um sich zu bemalen, Hinweis auf eine symbolische Weltsicht. Ihre Anatomie ermöglichte Sprache … In Gibraltar gibt es Hinweise darauf, dass sie schwarze Vogelfedern für Zeremonien verwendeten. Einst als Aasfresser verschrien, erscheinen sie neuesten Erkenntnissen zufolge als Jäger und Sammler, die Seehunde und Meeresfrüchte und Kamille aßen und Zahnstocher benutzten … Solch flexibles und komplexes Verhalten galt bisher als Ausweis unserer Besonderheit. Die Forschung übersah einfach, was sie heute mit neuen Technologien und offenen Augen erkennt. Die wahre Überraschung ist auch nicht das Können der Neanderthaler, sondern die Tatsache, dass ein Teil der Forschung unser anderes Selbst vehement ausblendete, und die Vorurteile dahinter. Eine Art 'moderner menschlicher Suprematismus'".
In der aktuellen Ausgabe des New York Times Magazines macht uns Jon Mooallem mit einem nahen Verwandten bekannt: dem Neanderthaler. "Neanderthaler begruben ihre Toten wie der Homo sapiens auch, sie stellten Schmuck, Werkzeuge und Pigmente her, um sich zu bemalen, Hinweis auf eine symbolische Weltsicht. Ihre Anatomie ermöglichte Sprache … In Gibraltar gibt es Hinweise darauf, dass sie schwarze Vogelfedern für Zeremonien verwendeten. Einst als Aasfresser verschrien, erscheinen sie neuesten Erkenntnissen zufolge als Jäger und Sammler, die Seehunde und Meeresfrüchte und Kamille aßen und Zahnstocher benutzten … Solch flexibles und komplexes Verhalten galt bisher als Ausweis unserer Besonderheit. Die Forschung übersah einfach, was sie heute mit neuen Technologien und offenen Augen erkennt. Die wahre Überraschung ist auch nicht das Können der Neanderthaler, sondern die Tatsache, dass ein Teil der Forschung unser anderes Selbst vehement ausblendete, und die Vorurteile dahinter. Eine Art 'moderner menschlicher Suprematismus'".Außerdem: Patrick Symmes beschreibt den Krieg des philippinischen Präsidenten Duterte gegen die Drogen in seinem Land als staatlich unterstützte Mordserie. Taffy Brodesser-Akner lässt sich von Dampf-Talker Andy Cohen die Welt des Reality-TV erklären. Und Greg Howard denkt über die Nominierung des farbigen Neurochirurgen Ben Carson zum Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung nach.
Jacobin | Backchannel | Linkiesta | New York Times | CulturMag | Respekt | London Review of Books | El Espectador | New Yorker | HVG | Guardian
Kommentieren












