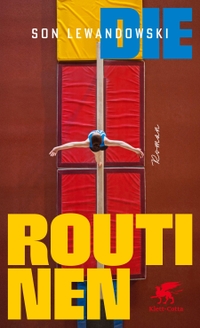Magazinrundschau
Das gaullo-imperiale Denken
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
02.07.2019. Wahlrecht für Frauen gab's in Amerika schon vor tausend Jahren, lernt der New Yorker. Ob tausend oder hundert Jahre, trotz Feminismus hat sich die Lage für Frauen verschlechtert, stellt die London Review fest. La Règle du jeu betrachtet das Desaster westlichen Nicht-Intervenierens in Syrien. Der Guardian gibt uns den Essex-Man. Die NYRB betrachtet die gespaltene Wählerschaft der Demokraten. Cinema Scope porträtiert den Musiker Scott Walker und seine Liebe zu Robert Bresson. Die NYT lässt sich erklären, was das russische Wort bardag bedeutet.
New Yorker (USA), 15.07.2019
 In der aktuellen Ausgabe des Magazins erinnert Casey Cep an den Kampf der Suffragetten vor hundert Jahren und an ihre vergessenen Vorkämpferinnen: "In gewisser Hinsicht haben Frauen in Amerika gewählt, lange bevor es die Vereinigten Staaten gab. In einer faszinierenden neuen Anthologie, 'The Women's Suffrage Movement' verlängert die Wissenschaftlerin Sally Roesch Wagner die Zeitspanne des Wahlrechts in diesem Teil der Welt um knapp tausend Jahre. Sie beginnt mit der Gründung der Konföderation der Haudenosaunee (der Irokesen), als sich die Nationen Onondaga, Mohawk, Seneca, Oneida und Cayuga, später zusammen mit den Tuscarora, im Land um die Großen Seen versammelten, um eine egalitäre Gesellschaft zu gründen, die Frauen politische Macht gewährte. Haudenosaunee-Frauen halfen bei der Wahl der Chefs, die gemeinsam vom Rat regiert wurden, und sie hatten ein Mitspracherecht in Fragen von Krieg und Frieden. Politikhistoriker haben die Konföderation der Haudenosaunee schon lange als die älteste ununterbrochen funktionierende Demokratie der Welt erkannt. Wagner erinnert daran, dass diese demokratischen Grundsätze auch für Frauen galten. Leider enthält das Buch weder historische noch zeitgenössische Stimmen der Haudenosaunee, aber Wagner zeigt, wie diese Nachbargesellschaften die erste Generation moderner Suffragetten beeinflussten. Lucretia Mott lebte in einer Seneca-Gemeinde, während sie mit Quäkern Hilfsarbeit leistete, Elizabeth Cady Stanton beobachtete die Oneida-Nation um die Seneca-Fälle, und Matilda Joslyn Gage traf nicht nur auf Mitglieder der Mohawk-Nation, sondern war Ehrenmitglied des Wolf-Clans. Diese frühen Aktivisten sahen aus erster Hand, dass Haudenosaunee-Frauen Eigentum besitzen, Scheidungen einleiten und, am schockierendsten, sogar wählen konnten."
In der aktuellen Ausgabe des Magazins erinnert Casey Cep an den Kampf der Suffragetten vor hundert Jahren und an ihre vergessenen Vorkämpferinnen: "In gewisser Hinsicht haben Frauen in Amerika gewählt, lange bevor es die Vereinigten Staaten gab. In einer faszinierenden neuen Anthologie, 'The Women's Suffrage Movement' verlängert die Wissenschaftlerin Sally Roesch Wagner die Zeitspanne des Wahlrechts in diesem Teil der Welt um knapp tausend Jahre. Sie beginnt mit der Gründung der Konföderation der Haudenosaunee (der Irokesen), als sich die Nationen Onondaga, Mohawk, Seneca, Oneida und Cayuga, später zusammen mit den Tuscarora, im Land um die Großen Seen versammelten, um eine egalitäre Gesellschaft zu gründen, die Frauen politische Macht gewährte. Haudenosaunee-Frauen halfen bei der Wahl der Chefs, die gemeinsam vom Rat regiert wurden, und sie hatten ein Mitspracherecht in Fragen von Krieg und Frieden. Politikhistoriker haben die Konföderation der Haudenosaunee schon lange als die älteste ununterbrochen funktionierende Demokratie der Welt erkannt. Wagner erinnert daran, dass diese demokratischen Grundsätze auch für Frauen galten. Leider enthält das Buch weder historische noch zeitgenössische Stimmen der Haudenosaunee, aber Wagner zeigt, wie diese Nachbargesellschaften die erste Generation moderner Suffragetten beeinflussten. Lucretia Mott lebte in einer Seneca-Gemeinde, während sie mit Quäkern Hilfsarbeit leistete, Elizabeth Cady Stanton beobachtete die Oneida-Nation um die Seneca-Fälle, und Matilda Joslyn Gage traf nicht nur auf Mitglieder der Mohawk-Nation, sondern war Ehrenmitglied des Wolf-Clans. Diese frühen Aktivisten sahen aus erster Hand, dass Haudenosaunee-Frauen Eigentum besitzen, Scheidungen einleiten und, am schockierendsten, sogar wählen konnten."Außerdem: Daniel Alarcon untersucht den Selbstmord des früheren peruanischen Präsidenten Alan Garcia. Charles McGrath folgt Rudyard Kipling in die USA. Margaret Talbot porträtiert die Musikerin Mitski. Dan Chiasson liest Gedichte von James Tate. Hua Hsu erzählt, wie aus Postern Kunst wurde. Peter Schjeldahl erzählt, was für ein Schlag der Tod des Graffitikünstlers Michael Stewart durch einen Polizisten für Michel Basquiat war. Und Anthony Lane sah im Kino Danny Boyles Film "Yesterday".
London Review of Books (UK), 04.07.2019
 Feminismus ist en vogue, keine Frage, und er hat einiges erreicht. Doch Lorna Finlayson hält auch fest, dass sich die Lage von Frauen in vielerlei Hinsicht verschlechtert hat: In allen Teilen der Welt sind Frauen überproportional vom Abbau sozialer Dienstleistungen betroffen, die Austeritätspolitik in Europa hat die Einkommen und Renten von Frauen viel stärker reduziert als die von Männern; Frauenhäuser werden geschlossen, immer mehr Frauen verkaufen Sex, um ihre Miete zu zahlen und ihre Kinder über die Runden zu bekommen. Finlayson geht völlig d'accord mit dem Manifest "Feminism for the 99 percent" von Nancy Fraser, Cinzia Arruzza und Tithi Bhattacharya und beklagt, dass sich der neue Feminismus mehr und mehr auf die Themen Geschlecht, Sexualität und Körper beschränkt oder eine Quotierung in Politik und Wirtschaft: Dem liegt die nie explizit gemachte Annahme zugrunde, dass Frauen an der Macht mit ihrer Politik Fraueninteressen voranbringen. Doch heute kann diese Annahme nicht mehr als ungeprüft gelten. Die vergangenen Jahre, in dem die Repräsentation von Frauen in vielen Feldern gestärkt wurde - darunter im Parlament - waren geprägt von einer Politik der Austerität und des Neoliberalismus. In Britannien zumindest hat die Vorstellung, dass Politikerinnen die Anliegen ihrer Schwestern Gehör schenken, mit Margaret Thatcher und Theresa May zwei spektakuläre Gegenbeispiele erlebt. Frauen an der Macht praktizieren nicht selbstverständlich eine feministische Politik. Feministinnen misstrauen schon lange und aus guten Grund essentialistischen Behauptungen über Frauen, die traditionell dazu dienten, unsere Unterordnung zu kaschieren oder zu legitimieren. Die Vorstellung, dass Frauen friedliebender oder empathischer ist, unterscheidet sich nicht wesentlich von vertrauten sexistischen Stereotypen."
Feminismus ist en vogue, keine Frage, und er hat einiges erreicht. Doch Lorna Finlayson hält auch fest, dass sich die Lage von Frauen in vielerlei Hinsicht verschlechtert hat: In allen Teilen der Welt sind Frauen überproportional vom Abbau sozialer Dienstleistungen betroffen, die Austeritätspolitik in Europa hat die Einkommen und Renten von Frauen viel stärker reduziert als die von Männern; Frauenhäuser werden geschlossen, immer mehr Frauen verkaufen Sex, um ihre Miete zu zahlen und ihre Kinder über die Runden zu bekommen. Finlayson geht völlig d'accord mit dem Manifest "Feminism for the 99 percent" von Nancy Fraser, Cinzia Arruzza und Tithi Bhattacharya und beklagt, dass sich der neue Feminismus mehr und mehr auf die Themen Geschlecht, Sexualität und Körper beschränkt oder eine Quotierung in Politik und Wirtschaft: Dem liegt die nie explizit gemachte Annahme zugrunde, dass Frauen an der Macht mit ihrer Politik Fraueninteressen voranbringen. Doch heute kann diese Annahme nicht mehr als ungeprüft gelten. Die vergangenen Jahre, in dem die Repräsentation von Frauen in vielen Feldern gestärkt wurde - darunter im Parlament - waren geprägt von einer Politik der Austerität und des Neoliberalismus. In Britannien zumindest hat die Vorstellung, dass Politikerinnen die Anliegen ihrer Schwestern Gehör schenken, mit Margaret Thatcher und Theresa May zwei spektakuläre Gegenbeispiele erlebt. Frauen an der Macht praktizieren nicht selbstverständlich eine feministische Politik. Feministinnen misstrauen schon lange und aus guten Grund essentialistischen Behauptungen über Frauen, die traditionell dazu dienten, unsere Unterordnung zu kaschieren oder zu legitimieren. Die Vorstellung, dass Frauen friedliebender oder empathischer ist, unterscheidet sich nicht wesentlich von vertrauten sexistischen Stereotypen."Andrew O'Hagan liefert einige Reminiszenzen an die New Yorker Autorin Lilian Ross, deren Boshaftigkeiten er als ihr ständiger Begleiter offenbar genossen hat: "Ich kenne niemanden, der so viele Menschen hasste wie Lilian Ross. Sie zählte sie gern an ihren Fingern ab, meist nur einen Steinwurf von ihnen entfernt und dabei ihre Stimme zu senken: Sie bog jeden Finger nach hinten, zog eine Grimasse und lieferte zu jedem Name das entscheidende Attibut: Gloria Steinem - falsch. Janet Malcolm - eine Angeberin. Renata Adler - eine Spinnerin. Susan Sontag - ein Niemand. Nora Ephron - eine Lügnerin. Andere Hand: Kenneth Tynan - ein Mistkerl. Truman Capote - eine Klette. George Plimpton - schmierig. Tom Wolfe - untalentiert. Philip Roth - ein Blödmann."
Magyar Narancs (Ungarn), 28.06.2019
 Im Zuge der der Wende vor dreißig Jahren wurde auch der hingerichtete Reformkommunist und Ministerpräsidenten der 1956er Revolution Imre Nagy rehabilitiert und umgebettet. Bei den offiziellen Erinnerungsveranstaltungen und Erzählungen wird jedoch Ministerpräsident Orbán, der 1989 als junger Mann eine viel beachtete Rede hielt, nun als Schlüsselfigur, Antreiber und Organisator der Wende inszeniert und dargestellt. Der Historiker András Mink beschreibt Facetten dieser Erinnerungspolitik: "Das Imre-Nagy-Bild der heutigen Regierung ähnelt sehr dem Zerrbild der Kádár-Ära. (...) Imre Nagy und die Reformkommunisten konnten nicht die geistigen und politischen Anführer und Helden der Revolution gewesen sein, lediglich Nebendarsteller mit tragischen Schicksalen, die auf Druck des protestierenden Volkes und der Straße aus Zwang gehandelt hatten, denn sie waren ja Kommunisten. Ihr ungewolltes Märtyrertum verdiene zwar ein wenig Respekt. Doch nicht mehr. (...) Die wahren Helden waren nicht sie, sondern die 'Budapester Jungs'. Diese Interpretation manifestierte sich beim Gedenkjahr für 1956 vor drei Jahren und sie wurde voll entfaltet bei der gestohlenen 30-Jahr-Feier der Umbettung Nagys. Hauptakteure der Geschichte sind nicht mehr Imre Nagy und seine Kameraden, sondern der größte Junge der "Budapester Jungs", Viktor Orbán, der mit seiner Rede die Systemwende einläutete und das kommunistische Regime eigenhändig beendete. Diesen unverschämten, verunglimpfenden Schritt kann nur als zweiter symbolischer Diebstahl an der Imre-Nagy-Gruppe betrachtet werden."
Im Zuge der der Wende vor dreißig Jahren wurde auch der hingerichtete Reformkommunist und Ministerpräsidenten der 1956er Revolution Imre Nagy rehabilitiert und umgebettet. Bei den offiziellen Erinnerungsveranstaltungen und Erzählungen wird jedoch Ministerpräsident Orbán, der 1989 als junger Mann eine viel beachtete Rede hielt, nun als Schlüsselfigur, Antreiber und Organisator der Wende inszeniert und dargestellt. Der Historiker András Mink beschreibt Facetten dieser Erinnerungspolitik: "Das Imre-Nagy-Bild der heutigen Regierung ähnelt sehr dem Zerrbild der Kádár-Ära. (...) Imre Nagy und die Reformkommunisten konnten nicht die geistigen und politischen Anführer und Helden der Revolution gewesen sein, lediglich Nebendarsteller mit tragischen Schicksalen, die auf Druck des protestierenden Volkes und der Straße aus Zwang gehandelt hatten, denn sie waren ja Kommunisten. Ihr ungewolltes Märtyrertum verdiene zwar ein wenig Respekt. Doch nicht mehr. (...) Die wahren Helden waren nicht sie, sondern die 'Budapester Jungs'. Diese Interpretation manifestierte sich beim Gedenkjahr für 1956 vor drei Jahren und sie wurde voll entfaltet bei der gestohlenen 30-Jahr-Feier der Umbettung Nagys. Hauptakteure der Geschichte sind nicht mehr Imre Nagy und seine Kameraden, sondern der größte Junge der "Budapester Jungs", Viktor Orbán, der mit seiner Rede die Systemwende einläutete und das kommunistische Regime eigenhändig beendete. Diesen unverschämten, verunglimpfenden Schritt kann nur als zweiter symbolischer Diebstahl an der Imre-Nagy-Gruppe betrachtet werden."Cinema Scope (USA), 30.06.2019
 In einem schönen, ausführlichen Essay geht Christoph Huber dem Verhältnis des im März gestorbenen Musiker Scott Walker zum Kino nach: "In den Jahrzehnten nach den 70ern erfand er sich als in seinen Visionen kompromissloser Künstler neu. Es ging ihm darum, alle überflüssigen Exzesse aus seinem Werk zu streichen. Robert Bresson nannte er als Ideal: 'Wenn ich seine Filme sehe, sehe ich eine visuelle Entsprechung dessen, auf was ich abziele. Er greift nie auf echte Schauspieler zurück. Wenn ein Mensch seine Hand sinken lässt, dann will er nur, dass Du weißt, dass ein Mensch seine Hand sinken lässt. Das ist das Phänomen, Mensch zu sein.' Es ist diese Idee der universellen Menschlichkeit, die Walkers Spätwerk kennzeichnet: Nach dem Vorbild des Bresson'schen Konzepts des 'Modells' versuchte er sogar, die Persönlichkeit aus seiner unverwechselbaren Gesangsstimme zu streichen, um der Essenz eines Songs nicht im Wege zu stehen. Im selben Interview beschreibt Walker Bresson auf eine Art, die auch seine eigene musikalische Entwicklung zutrifft: "'Ein zum Tode Verurteiler ist entflohen' ist der erste Film, in dem er seinen Stil nahezu vollständig entwickelt hat, insbesondere was den Gebrauch von Klang betrifft. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich von Musik noch nicht vollständig verabschiedet. Erst später stellte er fest, dass Musik - insbesondere 'glorreiche Musik' (Mozart, Bach, Lully, etc.) - das Bild tatsächlich sogar flach werden lässt, wohingegen ein Klangeffekt dem Bild Tiefe verleiht. Aber kein anderer Regisseur lässt uns derart auf das blanke Rätsel des menschlichen Wesens fokussieren.' In dieser Hinsicht spielt es keine Rolle, ob das menschliche Wesen ein Unbekannter oder Marlon Brando ist, vor dem Walker in einem Stück auf 'Soused', seiner großen Zusammenarbeit mit Sunn o))) aus dem Jahr 2004, den Hut zieht, oder Pasolini, um den es in 'Farmer in the City', dem großartigen ersten Stück auf 'Tilt', geht. Darin übersetzt Walker Passagen aus Pasolinis Gedicht 'Uno dei tanti Epiloghi' (das der Künstler für seinen jungen Liebhaber Ninetto Davoli geschrieben hatte) und integriert es dann in ein anspielungsreiches Netzwerk, das auf etwas Größeres und universell Nachvollziehbareres verweist."
In einem schönen, ausführlichen Essay geht Christoph Huber dem Verhältnis des im März gestorbenen Musiker Scott Walker zum Kino nach: "In den Jahrzehnten nach den 70ern erfand er sich als in seinen Visionen kompromissloser Künstler neu. Es ging ihm darum, alle überflüssigen Exzesse aus seinem Werk zu streichen. Robert Bresson nannte er als Ideal: 'Wenn ich seine Filme sehe, sehe ich eine visuelle Entsprechung dessen, auf was ich abziele. Er greift nie auf echte Schauspieler zurück. Wenn ein Mensch seine Hand sinken lässt, dann will er nur, dass Du weißt, dass ein Mensch seine Hand sinken lässt. Das ist das Phänomen, Mensch zu sein.' Es ist diese Idee der universellen Menschlichkeit, die Walkers Spätwerk kennzeichnet: Nach dem Vorbild des Bresson'schen Konzepts des 'Modells' versuchte er sogar, die Persönlichkeit aus seiner unverwechselbaren Gesangsstimme zu streichen, um der Essenz eines Songs nicht im Wege zu stehen. Im selben Interview beschreibt Walker Bresson auf eine Art, die auch seine eigene musikalische Entwicklung zutrifft: "'Ein zum Tode Verurteiler ist entflohen' ist der erste Film, in dem er seinen Stil nahezu vollständig entwickelt hat, insbesondere was den Gebrauch von Klang betrifft. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich von Musik noch nicht vollständig verabschiedet. Erst später stellte er fest, dass Musik - insbesondere 'glorreiche Musik' (Mozart, Bach, Lully, etc.) - das Bild tatsächlich sogar flach werden lässt, wohingegen ein Klangeffekt dem Bild Tiefe verleiht. Aber kein anderer Regisseur lässt uns derart auf das blanke Rätsel des menschlichen Wesens fokussieren.' In dieser Hinsicht spielt es keine Rolle, ob das menschliche Wesen ein Unbekannter oder Marlon Brando ist, vor dem Walker in einem Stück auf 'Soused', seiner großen Zusammenarbeit mit Sunn o))) aus dem Jahr 2004, den Hut zieht, oder Pasolini, um den es in 'Farmer in the City', dem großartigen ersten Stück auf 'Tilt', geht. Darin übersetzt Walker Passagen aus Pasolinis Gedicht 'Uno dei tanti Epiloghi' (das der Künstler für seinen jungen Liebhaber Ninetto Davoli geschrieben hatte) und integriert es dann in ein anspielungsreiches Netzwerk, das auf etwas Größeres und universell Nachvollziehbareres verweist."Zum Reinhören:
La regle du jeu (Frankreich), 23.06.2019
 Die Intervention des Westens im Irak mag ein Desaster gewesen sein, die Nicht-Intervention in Syrien war es um so mehr, auch wenn es niemanden hinter dem Ofen hervorlockt. Der Artikel von Gilles Hertzog über den Krieg der Kurden und Iraker gegen den "Islamischen Staat" ist geeignet, einem die Schamesröte ins Gesicht zu treiben, und sei es nur, weil man es den zumeist kurdischen "Proxies" überließ, Daech zu bekämpfen und ihnen dann wieder einmal nicht die geringste Unterstützung bei ihren Unabhängigkeitsbestrebungen zukommen ließ. Hertzog bezieht sich im übrigen auf die Kritik des französischen Obersts François-Régis Legrier an der "Proxie"-Strategie: "Sein Abschlussbericht zur Mission, der zuerst von der Revue défense nationale publiziert und dann wieder zurückgezogen wurde, hat ihm einen Ordnungsruf und ein Blacklisting der militärischen Obrigkeit eingebracht. Oberst Legrier warf der auf Vorortkämpfern basierenden westlichen Kriegsführung vor, dass sie drei lange Jahre in Anspruch nahm, ohne dass das Kalifat auch nur im geringsten aus dem Territorium zurückgedrängt wurde und dass man den Terroristen also während dieser ganzen langen Zeit Zugriff auf die gequälte Zivilbevölkerung ließ, und schließlich, dass man im Moment der so späten Abschlussoffensive eine unermessliche Zerstörung der von Daech gehaltenen Städte durch die Luft- und Artillerieangriffe zuließ. Denn die Proxies, die vor Ort kämpfenden Einsatzkräfte, hatten nicht die Ausbildung und die Mittel, sie durch Häuserkampf zu erobern, während sich Fremdenlegionäre und ihre britischen und amerikanischen Pendants als kriegerische Profis genau hierfür bestens geeignet hätten. Ergebnis: Mossul und Raqqa sind zu 90 Prozent zerstört. Um von den Tausenden Zivilisten zu schweigen, die nicht durch Daech getötet wurden, sondern weil sie zwischen dem Beschuss beider Seiten in der Falle saßen."
Die Intervention des Westens im Irak mag ein Desaster gewesen sein, die Nicht-Intervention in Syrien war es um so mehr, auch wenn es niemanden hinter dem Ofen hervorlockt. Der Artikel von Gilles Hertzog über den Krieg der Kurden und Iraker gegen den "Islamischen Staat" ist geeignet, einem die Schamesröte ins Gesicht zu treiben, und sei es nur, weil man es den zumeist kurdischen "Proxies" überließ, Daech zu bekämpfen und ihnen dann wieder einmal nicht die geringste Unterstützung bei ihren Unabhängigkeitsbestrebungen zukommen ließ. Hertzog bezieht sich im übrigen auf die Kritik des französischen Obersts François-Régis Legrier an der "Proxie"-Strategie: "Sein Abschlussbericht zur Mission, der zuerst von der Revue défense nationale publiziert und dann wieder zurückgezogen wurde, hat ihm einen Ordnungsruf und ein Blacklisting der militärischen Obrigkeit eingebracht. Oberst Legrier warf der auf Vorortkämpfern basierenden westlichen Kriegsführung vor, dass sie drei lange Jahre in Anspruch nahm, ohne dass das Kalifat auch nur im geringsten aus dem Territorium zurückgedrängt wurde und dass man den Terroristen also während dieser ganzen langen Zeit Zugriff auf die gequälte Zivilbevölkerung ließ, und schließlich, dass man im Moment der so späten Abschlussoffensive eine unermessliche Zerstörung der von Daech gehaltenen Städte durch die Luft- und Artillerieangriffe zuließ. Denn die Proxies, die vor Ort kämpfenden Einsatzkräfte, hatten nicht die Ausbildung und die Mittel, sie durch Häuserkampf zu erobern, während sich Fremdenlegionäre und ihre britischen und amerikanischen Pendants als kriegerische Profis genau hierfür bestens geeignet hätten. Ergebnis: Mossul und Raqqa sind zu 90 Prozent zerstört. Um von den Tausenden Zivilisten zu schweigen, die nicht durch Daech getötet wurden, sondern weil sie zwischen dem Beschuss beider Seiten in der Falle saßen."New York Review of Books (USA), 18.07.2019
 Michael Tomasky betrachtet die Riege der Kandidaten unter den Demokraten für das Präsidentschaftsamt. Bis April nächsten Jahres werden zwanzig Bewerber in zwölf Debatten um die Gunst des Wahlvolks ringen. Doch der Nominierungskampf könnte sich länger ziehen, denn die Wählerschaft ist zerstritten: Hier die zumeist älteren moderat Liberalen und dort die zumeist jungen Linken, die den Ton angeben, aber längst nicht so stark sind, wie sie in den Medien aussehen, wie Tomasky mit einer Reihe von Zahlen belegt. Vor allem Schwarze gehören eher zu den moderaten bis konservativen Liberalen: Einmal, weil sie oft religiöser sind als viele Weiße, und zum zweiten, weil sie mehr zu verlieren haben: "Die gegenwärtige Kluft scheint nicht nur ökonomisch, sondern auch ganzheitlich zu sein, mehr geprägt von Sensibilität, Erfahrung, Identität, emotionalen Reaktionen auf Macht und Ideen, wie man sie herausfordert und annimmt. Eine solche Kluft umfasst alle Themen: Wirtschaft, Geschlecht, Rasse, Klima - was auch immer. Es geht um eine grundlegende Weltanschauung, und solche Meinungsverschiedenheiten sind tiefer und weniger kompromissfähig. Wir werden sehen, was passiert, wenn die Abstimmung beginnt. Aber mit einem Establishment, das Bernie Sanders gern ausschließen würde, einer Sanders-Basis, die stets bereit ist, wahrgenommene Schwachstellen in Kriegsangelegenheiten zu verwandeln, mit Medien, die glücklich sind, diese Fehden im Namen von Klicks zu verstärken, und mit einem Präsidenten (und seinem Propagandanetzwerk, Fox News), der nur darauf wartet, Benzin auf jedes kleine demokratische Feuer zu werfen und es in ein Inferno zu verwandeln, sind die Vorwahlen eine potenziell gefährliche Situation."
Michael Tomasky betrachtet die Riege der Kandidaten unter den Demokraten für das Präsidentschaftsamt. Bis April nächsten Jahres werden zwanzig Bewerber in zwölf Debatten um die Gunst des Wahlvolks ringen. Doch der Nominierungskampf könnte sich länger ziehen, denn die Wählerschaft ist zerstritten: Hier die zumeist älteren moderat Liberalen und dort die zumeist jungen Linken, die den Ton angeben, aber längst nicht so stark sind, wie sie in den Medien aussehen, wie Tomasky mit einer Reihe von Zahlen belegt. Vor allem Schwarze gehören eher zu den moderaten bis konservativen Liberalen: Einmal, weil sie oft religiöser sind als viele Weiße, und zum zweiten, weil sie mehr zu verlieren haben: "Die gegenwärtige Kluft scheint nicht nur ökonomisch, sondern auch ganzheitlich zu sein, mehr geprägt von Sensibilität, Erfahrung, Identität, emotionalen Reaktionen auf Macht und Ideen, wie man sie herausfordert und annimmt. Eine solche Kluft umfasst alle Themen: Wirtschaft, Geschlecht, Rasse, Klima - was auch immer. Es geht um eine grundlegende Weltanschauung, und solche Meinungsverschiedenheiten sind tiefer und weniger kompromissfähig. Wir werden sehen, was passiert, wenn die Abstimmung beginnt. Aber mit einem Establishment, das Bernie Sanders gern ausschließen würde, einer Sanders-Basis, die stets bereit ist, wahrgenommene Schwachstellen in Kriegsangelegenheiten zu verwandeln, mit Medien, die glücklich sind, diese Fehden im Namen von Klicks zu verstärken, und mit einem Präsidenten (und seinem Propagandanetzwerk, Fox News), der nur darauf wartet, Benzin auf jedes kleine demokratische Feuer zu werfen und es in ein Inferno zu verwandeln, sind die Vorwahlen eine potenziell gefährliche Situation."Ansonsten ist die neue NYRB stark der Literatur gewidmet: Rachel Cusk schreibt über Yiyun Li, Deborah Eisenberg über Natalia Ginzburg und Robert Gottlieb (leider nicht online) über Ivo Andric.
En attendant Nadeau (Frankreich), 22.06.2019
 Es ist ein sperriger Text, den Catherine Coquio verfasst hat, so literarisch und ins Detail ihrer Lektüren vertieft, dass die Autorin vergisst, die Linien der Verantwortung französischer Akteure für den Genozid in Ruanda klar zu ziehen. Die Lektüre lohnt sich dennoch, besonders in jenen Passagen, in denen sie über das Buch "Rwanda Ils parlent - Témoignages pour l'histoire" von Laurent Larcher spricht. Auch Larcher quält sich bis ins Detail mit der Frage der französischen Verantwortung. Er hat mit vielen der damaligen Akteure gesprochen, und es ergibt sich für Coquio und den Leser das Bild einer Schuld aus Geschehenlassen und halber bis ganzer Unterstützung der Mörder bei gleichzeitigem Intervenieren für die Opfer: "Mitterrand, der große Abwesende des Buchs, schwebt über allem. Jeder Verweis auf die höhere Ebene bezeichnet ihn implizit oder explizit als den letztlich Verantwortlichen, den Entscheider. Aber jenseits des Skandals der politischen Entscheidung und der Identifikation der Hierarchien erlauben diese Gespräche auch einen Blick auf die gemeinsame Vorstellungswelt all jener selbst zu Entscheidungen befugten Akteure. Das ist, was Bernard Kouchner (damals 'Ärzte ohne Grenzen', d.Red.) in einem Moment luzider Genervtheit das 'gaullo-imperiale Denken' nennt, das im Außenministerium noch virulent sei und das aus einer Mischung aus 'unglaublichem Konformismus', aus Ignoranz und Arroganz und primitivem Antiamerikanismus bestehe - wozu sich bei Mitterrand 'eine Spur des Rechtsextremismus' aus der Vichy-Vergangenheit geselle."
Es ist ein sperriger Text, den Catherine Coquio verfasst hat, so literarisch und ins Detail ihrer Lektüren vertieft, dass die Autorin vergisst, die Linien der Verantwortung französischer Akteure für den Genozid in Ruanda klar zu ziehen. Die Lektüre lohnt sich dennoch, besonders in jenen Passagen, in denen sie über das Buch "Rwanda Ils parlent - Témoignages pour l'histoire" von Laurent Larcher spricht. Auch Larcher quält sich bis ins Detail mit der Frage der französischen Verantwortung. Er hat mit vielen der damaligen Akteure gesprochen, und es ergibt sich für Coquio und den Leser das Bild einer Schuld aus Geschehenlassen und halber bis ganzer Unterstützung der Mörder bei gleichzeitigem Intervenieren für die Opfer: "Mitterrand, der große Abwesende des Buchs, schwebt über allem. Jeder Verweis auf die höhere Ebene bezeichnet ihn implizit oder explizit als den letztlich Verantwortlichen, den Entscheider. Aber jenseits des Skandals der politischen Entscheidung und der Identifikation der Hierarchien erlauben diese Gespräche auch einen Blick auf die gemeinsame Vorstellungswelt all jener selbst zu Entscheidungen befugten Akteure. Das ist, was Bernard Kouchner (damals 'Ärzte ohne Grenzen', d.Red.) in einem Moment luzider Genervtheit das 'gaullo-imperiale Denken' nennt, das im Außenministerium noch virulent sei und das aus einer Mischung aus 'unglaublichem Konformismus', aus Ignoranz und Arroganz und primitivem Antiamerikanismus bestehe - wozu sich bei Mitterrand 'eine Spur des Rechtsextremismus' aus der Vichy-Vergangenheit geselle."Guardian (UK), 27.06.2019
HVG (Ungarn), 26.06.2019
 In Ungarn gibt es derzeit eine zum Teil öffentlich geführte Diskussion unter oppositionellen Wissenschaftlern, Künstlern und Intellektuellen, wie angesichts der erdrückenden Macht und Kontrolle der Regierung in der Wissenschaft, Kunst und Kultur ein angemessenes Verhalten aussehen könnte. Dabei werden Reflexe von vor 1989 erkennbar. Manche verkünden, dass sie auswandern wollen, viele ziehen sich zurück, andere verteidigen ihre Position, weiterhin die Institutionen (wie das Petőfi Literaturmuseum, die Forschungsinstitute der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, das Theaterfestival POSZT in Fünfkirchen u.a.) nutzen zu wollen. Der Philosoph Gáspár Miklós Tamás entdeckt jedoch vor allem eine Unorganisiertheit unter den Intellektuellen, die mit dazu beiträgt, dass es keine schlagkräftigen Reaktionen auf und Aktionen gegen die Regierungsmaßnahmen gibt. "Das Schicksal der ungarischen Intellektuellen ist jeweils eine individuelle Angelegenheit, ungeachtet der Asymmetrie der Macht. Sowohl die rechtswidrige Übermacht auf der einen, als auch die rechtswidrige Machtlosigkeit auf der anderen Seite: eine persönliche Angelegenheit. Manche herrschen, manche folgen, manche fliehen. Nach der herrschenden intellektuellen Ideologie hängt dies von der persönlichen Beschaffenheit, vom Charakter und Vorsatz ab. Eine Gesellschaft gibt es - wie wir es wissen - nicht. Aus einer demokratischen gemeinsamen Aktion könnte ja am Ende noch Politik werden. 1988/89 war das Aufschrei der ungarischen Intellektuellen bei einem Bruchteil der Schweinereien von heute enorm. Jetzt nicht. Aber es ist wahrlich heiß."
In Ungarn gibt es derzeit eine zum Teil öffentlich geführte Diskussion unter oppositionellen Wissenschaftlern, Künstlern und Intellektuellen, wie angesichts der erdrückenden Macht und Kontrolle der Regierung in der Wissenschaft, Kunst und Kultur ein angemessenes Verhalten aussehen könnte. Dabei werden Reflexe von vor 1989 erkennbar. Manche verkünden, dass sie auswandern wollen, viele ziehen sich zurück, andere verteidigen ihre Position, weiterhin die Institutionen (wie das Petőfi Literaturmuseum, die Forschungsinstitute der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, das Theaterfestival POSZT in Fünfkirchen u.a.) nutzen zu wollen. Der Philosoph Gáspár Miklós Tamás entdeckt jedoch vor allem eine Unorganisiertheit unter den Intellektuellen, die mit dazu beiträgt, dass es keine schlagkräftigen Reaktionen auf und Aktionen gegen die Regierungsmaßnahmen gibt. "Das Schicksal der ungarischen Intellektuellen ist jeweils eine individuelle Angelegenheit, ungeachtet der Asymmetrie der Macht. Sowohl die rechtswidrige Übermacht auf der einen, als auch die rechtswidrige Machtlosigkeit auf der anderen Seite: eine persönliche Angelegenheit. Manche herrschen, manche folgen, manche fliehen. Nach der herrschenden intellektuellen Ideologie hängt dies von der persönlichen Beschaffenheit, vom Charakter und Vorsatz ab. Eine Gesellschaft gibt es - wie wir es wissen - nicht. Aus einer demokratischen gemeinsamen Aktion könnte ja am Ende noch Politik werden. 1988/89 war das Aufschrei der ungarischen Intellektuellen bei einem Bruchteil der Schweinereien von heute enorm. Jetzt nicht. Aber es ist wahrlich heiß."New York Times (USA), 30.06.2019
 In der aktuellen Ausgabe des Magazins fragt Sarah A. Topol, was Putin eigentlich will, wie Russland funktioniert und warum alles ganz anders ist, als wir im Westen so denken: "Ich treffe Ruslan Pukhov im eleganten Café Puschkin, er ist Direktor am Zentrum für Strategieanalysen und Technologien, ein militärischer Thinktank, und er redet nicht lang um den heißen Brei: 'Immer wenn ein Beobachter aus dem Westen sagt, Russen tun dies oder jenes, sage ich: Ihr beschreibt Russen, als wären sie Deutsche oder Amerikaner, aber das sind sie nicht. Ich frage: Kennst du den Begriff 'bardag'? Wenn nicht, kannst du Russland nicht analysieren, denn 'bardag' bedeutet Unordnung, Fiasko.' Pukhov meint damit, dass Russlands politisches System nicht stromlinienförmig ist, keine vertikale Diktatur. Nur Naivität, Paranoia oder beides kann jemanden glauben machen, dass dieses System effizient genug ist, irgend etwas von großer globaler Bedeutung anzuzetteln. Russland war lange eine Projektionsfläche für amerikanische Ängste vor der roten Bedrohung und Putins Jagd nach der Weltherrschaft. Diese Tradition bekam Schub durch die Wahl 2016, als jeder auf einmal Fachmann für Putins Agenda war. Keine Wahl, die Putin nicht hacken, keine Grenze, die er nicht überschreiten, kein Verbündeter, den er nicht manipulieren würde. Das schiere Wort Putin steht für die systematische Zerstörung der Post-Kalter-Krieg-Ordnung in der Welt. Aber keiner, mit dem ich sprach und der Einblick hatte in die russischen Verhältnisse, hielt das für etwas anderes als Fiktion. Stattdessen bezeichneten sie Russlands Rückkehr auf die internationale Bühne als Improvisation, Taktik, Glücksspiel, allesamt eher bedenklich als meisterlich."
In der aktuellen Ausgabe des Magazins fragt Sarah A. Topol, was Putin eigentlich will, wie Russland funktioniert und warum alles ganz anders ist, als wir im Westen so denken: "Ich treffe Ruslan Pukhov im eleganten Café Puschkin, er ist Direktor am Zentrum für Strategieanalysen und Technologien, ein militärischer Thinktank, und er redet nicht lang um den heißen Brei: 'Immer wenn ein Beobachter aus dem Westen sagt, Russen tun dies oder jenes, sage ich: Ihr beschreibt Russen, als wären sie Deutsche oder Amerikaner, aber das sind sie nicht. Ich frage: Kennst du den Begriff 'bardag'? Wenn nicht, kannst du Russland nicht analysieren, denn 'bardag' bedeutet Unordnung, Fiasko.' Pukhov meint damit, dass Russlands politisches System nicht stromlinienförmig ist, keine vertikale Diktatur. Nur Naivität, Paranoia oder beides kann jemanden glauben machen, dass dieses System effizient genug ist, irgend etwas von großer globaler Bedeutung anzuzetteln. Russland war lange eine Projektionsfläche für amerikanische Ängste vor der roten Bedrohung und Putins Jagd nach der Weltherrschaft. Diese Tradition bekam Schub durch die Wahl 2016, als jeder auf einmal Fachmann für Putins Agenda war. Keine Wahl, die Putin nicht hacken, keine Grenze, die er nicht überschreiten, kein Verbündeter, den er nicht manipulieren würde. Das schiere Wort Putin steht für die systematische Zerstörung der Post-Kalter-Krieg-Ordnung in der Welt. Aber keiner, mit dem ich sprach und der Einblick hatte in die russischen Verhältnisse, hielt das für etwas anderes als Fiktion. Stattdessen bezeichneten sie Russlands Rückkehr auf die internationale Bühne als Improvisation, Taktik, Glücksspiel, allesamt eher bedenklich als meisterlich."Außerdem: Susan Dominus erklärt, was es bedeutet, dass Samenspender (und ihre Kinder) heute über DNA-Analyse ausfindig zu machen sind. Und Eli Baden-Lasar, Kind eines Samenspenders, erzählt, was es heißt, 32 Halbgeschwister zu haben und sich auf die Suche nach ihnen zu machen.
Kommentieren