Magazinrundschau
Die Magazinrundschau
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
31.03.2003. Der Merkur bewundert den Sturzkampfbomber Karajan. Im Nouvel Obs versichert der Schriftsteller Jonathan Coe, die Engländer seien nicht "completement stupides". Der Economist vergleicht Donald Rumsfeld mit Robert McNamara. Der Spiegel erklärt der US-Armee, was eine Scud ist. Das TLS wundert sich nach der Lektüre zweier Bücher über Nietzsche, dass diese Kuh immer noch Milch gibt. Die NYT Book Review freut sich über eine W.C. Fields-Biografie. Der New Yorker liefert Hintergrund zu Auseinandersetzungen im Pentagon und zum amerikanischen Bildungssystem. Im Profil meditieren Boris Groys und Isolde Charim über den Krieg der Bilder.
Merkur (Deutschland), 01.04.2003
Anlässlich von Richard Osbornes Biografie rollt Richard Klein den "Fall Herbert von Karajan" (mehr hier) noch einmal auf und stellt immerhin klar, dass Karajan tatsächlich nur einmal in die NSDAP eingetreten ist. Bemerkenswert auch eine Konzertbesprechung von Isaiah Berlin aus dem Jahre 1947, die Klein anführt: "Berlins Unruhe über das Gehörte, das von Wohlklangglätte weit entfernt gewesen sein muss, ist nicht zu verkennen. In aller Veräußerlichung scheint ein latent katastrophisches Moment mitgeschwungen zu haben. Berlin beschreibt eine Organisation von Tempo und Dynamik, 'die sich mit der unbarmherzigen Genauigkeit eines Sturzkampfbombers fortbewegt, welcher sich auf seine Opfer konzentriert'. Karajan war von der Kritik begeistert."
Dirk Kurbjuweit erzählt eine deutsche Filmgeschichte, genauer gesagt, wie aus seinem Roman "Schussangst" ein Film wurde. Es geht darin um einen jungen Hamburger Pazifisten, dessen Welt durch den Bosnien-Krieg und seine Liebe zu Isabella aus den Fugen gerät. Der georgische Regisseur Dito Tsintsadze hatte sich von einer Bulgarin das Drehbuch ins Russische übersetzen lassen und fand den Stoff ganz hervorragend: "'We'll make a very poetic movie, a movie about poetic killing', sagte er und mit seinem georgischen Akzent klang das selbst schon ziemlich poetisch." Dann strich Tsintsadze Bosnien aus dem Drehbuch.
Den Lesern der Printausgabe vorbehalten: Karl Schlögel folgt den Spuren Sergej Djagilew (mehr hier oder hier), Chef der Balletts Russes, Dandy, Ästhet und Herold der russischen Moderne, und beklagt, dass an die Stelle von Persönlichkeiten wie Djagilew die Apparate des Kulturbetriebs getreten sind. Gustav Seibt fragt sich, warum Berlin als einzige europäische Metropole keinen gültigen Großstadtroman hervorgebracht. Liegt's am fehlenden Bürgertum, den vielen Kindern der Provinz, die sich in den Schwarzwald zurücksehnen, oder diesem "gleichmütigen, maulenden, faulen Berliner Volk"? Gerhard Henschel wünscht sich für Hans-Ulrich Treichels ("Der irdische Armor") nächsten Roman einen Putsch des Erzählers gegen den Stadrat von Emsfelde und einen Helden, der mit Glück und Erfolg zurechtkommt. Und Jeremy Adler erkennt im Zickzack die Denkfigur der Moderne.
Dirk Kurbjuweit erzählt eine deutsche Filmgeschichte, genauer gesagt, wie aus seinem Roman "Schussangst" ein Film wurde. Es geht darin um einen jungen Hamburger Pazifisten, dessen Welt durch den Bosnien-Krieg und seine Liebe zu Isabella aus den Fugen gerät. Der georgische Regisseur Dito Tsintsadze hatte sich von einer Bulgarin das Drehbuch ins Russische übersetzen lassen und fand den Stoff ganz hervorragend: "'We'll make a very poetic movie, a movie about poetic killing', sagte er und mit seinem georgischen Akzent klang das selbst schon ziemlich poetisch." Dann strich Tsintsadze Bosnien aus dem Drehbuch.
Den Lesern der Printausgabe vorbehalten: Karl Schlögel folgt den Spuren Sergej Djagilew (mehr hier oder hier), Chef der Balletts Russes, Dandy, Ästhet und Herold der russischen Moderne, und beklagt, dass an die Stelle von Persönlichkeiten wie Djagilew die Apparate des Kulturbetriebs getreten sind. Gustav Seibt fragt sich, warum Berlin als einzige europäische Metropole keinen gültigen Großstadtroman hervorgebracht. Liegt's am fehlenden Bürgertum, den vielen Kindern der Provinz, die sich in den Schwarzwald zurücksehnen, oder diesem "gleichmütigen, maulenden, faulen Berliner Volk"? Gerhard Henschel wünscht sich für Hans-Ulrich Treichels ("Der irdische Armor") nächsten Roman einen Putsch des Erzählers gegen den Stadrat von Emsfelde und einen Helden, der mit Glück und Erfolg zurechtkommt. Und Jeremy Adler erkennt im Zickzack die Denkfigur der Moderne.
Nouvel Observateur (Frankreich), 27.03.2003
 In einem als "giftig" annoncierten Text erklärt der englische Schriftsteller Jonathan Coe (mehr hier), "was die moralische Autorität Tony Blairs wirklich bedroht": Er wolle den moralischen Widerwillen der Engländer gegen den Krieg mit einem Appell an ihre moralische Empfindlichkeit bekämpfen, indem er die Abscheulichkeiten von Saddams Regime schildert. Doch "die Engländer mögen empfindlich sein, aber sie sind nicht vollständig verblödet. Sie kennen die Wirkung von Bomben und das enorme Waffenarsenal der USA...; und sie wagen es zu denken, dass ein Angriff auf das Zentrum von Bagdad ein merkwürdiges Mittel ist, um die Lebensbedingungen irakischer Kinder und anderer unschuldiger Zivilisten zu verbessern."
In einem als "giftig" annoncierten Text erklärt der englische Schriftsteller Jonathan Coe (mehr hier), "was die moralische Autorität Tony Blairs wirklich bedroht": Er wolle den moralischen Widerwillen der Engländer gegen den Krieg mit einem Appell an ihre moralische Empfindlichkeit bekämpfen, indem er die Abscheulichkeiten von Saddams Regime schildert. Doch "die Engländer mögen empfindlich sein, aber sie sind nicht vollständig verblödet. Sie kennen die Wirkung von Bomben und das enorme Waffenarsenal der USA...; und sie wagen es zu denken, dass ein Angriff auf das Zentrum von Bagdad ein merkwürdiges Mittel ist, um die Lebensbedingungen irakischer Kinder und anderer unschuldiger Zivilisten zu verbessern."Marie Chauvin, Berlin-Korrespondentin des Nouvel Obs, hat sich die "unter furchtbaren Zwängen" fertiggestellte französische Botschaft von Christian de Portzamparc (mehr hier) am Pariser Platz angesehen. Deren "formelle Subtilität" sei nicht nach dem "Geschmack aller Berliner". So hätten sich einige erbitterte Kritiker an einen "Bunker" erinnert gefühlt.
Zu lesen ist außerdem ein Interview mit dem amerikanischen Krimiautor Ed McBain (mehr hier), Drehbuchautor von Hitchcocks "Die Vögel" und Erfinder der Serie rund um das 87. Polizeirevier der fiktiven Stadt Isola. Pascal Bruckner stellt schließlich das Buch "De Paris a la lune" (Nil; mehr zur amerikanische Originalausgabe hier) von Adam Gopnik (mehr hier) vor. Gopnik, seit 1986 Journalist des New Yorker und zwischen 1995 und 2000 Pariskorrespondent der Zeitschrift, stelle sich auf jeder Seite seines Stadtporträts die Frage: "Wie kann man Pariser sein und eine derartige Mischung aus Arroganz, Konservativismus und Lebenskunst miteinander vereinen?"
Economist (UK), 28.03.2003
 Der Economist liefert ein Porträt des amerikanischen Verteidigungsministers Donald Rumsfeld: "Donald Rumsfeld liebt Führungs-Maximen. Eine der 'Rumsfeld-Regeln' lautet: 'Teile die Welt nicht in "sie" und "wir" auf.' Darin hat er offensichtlich versagt. Eine andere lautet: 'Besuche deine Vorgänger aus vorigen Regierungen. Versuche eher originelle Fehler zu machen, als unnötigerweise die ihrigen zu wiederholen.' Was uns zu McNamara zurückführt, auch ein ehemaliger Geschäftsführer mit grenzenlosem Ego und eine Vorliebe für zurückgegeltes Haar, randlose Brillengläser und hochtechnologisierte Kriegsführung. Ob Rumsfeld eine weitere seiner Regeln bricht und unnötigerweise McNamaras vor so vielen Jahren in Vietnam begangene Fehler wiederholt, werden wir bald erfahren."
Der Economist liefert ein Porträt des amerikanischen Verteidigungsministers Donald Rumsfeld: "Donald Rumsfeld liebt Führungs-Maximen. Eine der 'Rumsfeld-Regeln' lautet: 'Teile die Welt nicht in "sie" und "wir" auf.' Darin hat er offensichtlich versagt. Eine andere lautet: 'Besuche deine Vorgänger aus vorigen Regierungen. Versuche eher originelle Fehler zu machen, als unnötigerweise die ihrigen zu wiederholen.' Was uns zu McNamara zurückführt, auch ein ehemaliger Geschäftsführer mit grenzenlosem Ego und eine Vorliebe für zurückgegeltes Haar, randlose Brillengläser und hochtechnologisierte Kriegsführung. Ob Rumsfeld eine weitere seiner Regeln bricht und unnötigerweise McNamaras vor so vielen Jahren in Vietnam begangene Fehler wiederholt, werden wir bald erfahren."Weitere Artikel: Der Irakkrieg spaltet die arabische Welt, indem er die arabische Bevölkerung von ihren politischen Führern entfremdet, da die eine eindeutige Stellungnahme zu den Ereignissen vermissen lassen. Der syrische General Assad bringt es auf den Punkt: "Es kann gefährlich sein, dieser Tage Amerikas Feind zu sein, aber dessen Freund zu sein, könnte sich als fatal herausstellen." Neues in Sachen transatlantischer Verstimmung: Der Economist vergleicht das jetzige franko-amerikanische Zerwürfnis mit der Krise von 1966, als Charles de Gaulle die amerikanische Vietnam-Politik verurteilte. Das internationale Bankabkommen "Basel 2" könnte wegen amerikanischen Widerständen zum zweigleisigen Modell geraten.
Zu lesen außerdem ein Nachruf auf den Amerikaner Daniel Patrick Moyhinan, "einen der bemerkenswertesten Politiker seiner Generation", und die entzückte Besprechung von Simon Winchesters Buch über den legendären Ausbruch des Krakatoa-Vulkans. Und schließlich: Was darf es denn sein? Der Economist berichtet, dass Forscher einen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht eines Kindes und der Jahreszeit seiner Zeugung herausgefunden haben.
Nur im Print zu lesen ist der Aufmacher, der mit dem "Nebel des Krieges" nicht nur die Sandstürme meint.
Spiegel (Deutschland), 31.03.2003
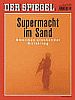 Wieder ein Irak-Titel, natürlich auch wieder online nur gegen Zuzahlung. Diesmal unter anderem mit einem Interview des britischen Chefs von CNN International, Chris Cramer, in dem dieser behauptet: "Wir machen den Krieg nicht keimfrei." Claus Christian Malzahn, "eingebetteter" Spiegel-Korrespondent im Irak, erklärt, wie der Informationsfluss zwischen Soldaten und Journalisten funktioniert: "'Scud-Alarm'. Wir rennen in den Bunker, die Gasmaske klebt schwer im Gesicht. Es sind aber ... keine mit Giftgas bestückten Scuds, deren Einsatz belegen würde, dass Saddam gegen die Uno-Auflagen verstößt. Das genau aber glauben fast alle Offiziere. Und dieser Glaube gibt ihnen moralischen Auftrieb. 'Wir machen das hier doch nicht für Öl. Wir machen das für die Welt!', empört sich ein junger Captain. Als ich dem Mann erkläre, das Pentagon habe den Einsatz von Scuds vor kurzem dementiert, gerät er ins Grübeln. Über AFN ist diese Nachricht nicht gelaufen. Jetzt hört er BBC."
Wieder ein Irak-Titel, natürlich auch wieder online nur gegen Zuzahlung. Diesmal unter anderem mit einem Interview des britischen Chefs von CNN International, Chris Cramer, in dem dieser behauptet: "Wir machen den Krieg nicht keimfrei." Claus Christian Malzahn, "eingebetteter" Spiegel-Korrespondent im Irak, erklärt, wie der Informationsfluss zwischen Soldaten und Journalisten funktioniert: "'Scud-Alarm'. Wir rennen in den Bunker, die Gasmaske klebt schwer im Gesicht. Es sind aber ... keine mit Giftgas bestückten Scuds, deren Einsatz belegen würde, dass Saddam gegen die Uno-Auflagen verstößt. Das genau aber glauben fast alle Offiziere. Und dieser Glaube gibt ihnen moralischen Auftrieb. 'Wir machen das hier doch nicht für Öl. Wir machen das für die Welt!', empört sich ein junger Captain. Als ich dem Mann erkläre, das Pentagon habe den Einsatz von Scuds vor kurzem dementiert, gerät er ins Grübeln. Über AFN ist diese Nachricht nicht gelaufen. Jetzt hört er BBC."Online lesen dürfen wir Hans Halters Rezension der Dutschke-Tagebücher: Die "Liebe zur Revolution" sei für Dutschke immer vorgegangen, "was er 1974 der 'lieben Genossin' Jutta, die sich extra für ihn freigenommen hatte, erklären musste und später auch noch Elsa und Ellen. Selbst Ehefrau Gretchen wollte er nicht im ersten Verliebtsein heiraten; Begründung: Ein Revolutionär muss die Revolution machen." Und Nikolaus Festenberg stellt Mariam Laus (mehr hier) Biografie Harald Schmidts vor und denkt darüber nach, warum alle Schmidts Reaktion auf den Irak-Krieg so gut finden.
Im Print außerdem ein Interview mit Dustin Hoffman über seinen neuen Film "Moonlight Mile". Schließlich noch ein Ortstermin in Frankfurt beim US-Soldatensender AFN, der seinen sechzigsten Geburtstag feiert und ein Nachruf auf Gordian Troeller.
New Yorker (USA), 07.04.2003
 Ausführlich und aus vielen Perspektiven beschäftigt sich der New Yorker mit dem Irak-Krieg. In einem "Letter from Baghdad" erklärt Jon Lee Anderson, wie sich die Stadt auf den Krieg einstellt. Jeffrey Goldberg schreibt aus dem Nordirak über die gleichzeitige "Erwartung und Angst" der kurdischen Kämpfer. Isabel Hilton (mehr hier) untersucht die Hoffungen und Ängste, mit denen Exiliraker auf den Krieg blicken, und George Packer porträtiert einen irakischen Deserteur, den er in Brooklyn traf. In seinem Kommentar über die ersten "Schockwellen" nennt Hendrik Hertzberg den Konflikt "eine neue Form des totalen Kriegs".
Ausführlich und aus vielen Perspektiven beschäftigt sich der New Yorker mit dem Irak-Krieg. In einem "Letter from Baghdad" erklärt Jon Lee Anderson, wie sich die Stadt auf den Krieg einstellt. Jeffrey Goldberg schreibt aus dem Nordirak über die gleichzeitige "Erwartung und Angst" der kurdischen Kämpfer. Isabel Hilton (mehr hier) untersucht die Hoffungen und Ängste, mit denen Exiliraker auf den Krieg blicken, und George Packer porträtiert einen irakischen Deserteur, den er in Brooklyn traf. In seinem Kommentar über die ersten "Schockwellen" nennt Hendrik Hertzberg den Konflikt "eine neue Form des totalen Kriegs".Seymour M. Hersh beschreibt schließlich die "Kämpfe innerhalb des Pentagon", die Donald Rumsfeld dort zu schlagen hat, Nancy Franklin analysiert, wie der Krieg im amerikanischen Fernsehen inszeniert wird, und James Surowiecki überlegt, was nun wohl aus den Schulden wird, die der Irak hat.
Weitere Themen: Louis Menand beschäftigt sich in mit dem "zunehmend unvorhersehbarer" werdenden Zulassungssystem amerikanischer Spitzencolleges. Das klingt trocken, vermittelt aber erstaunliche Einsichten in das amerikanische Ausbildungssystem. So weiß Menand etwa zu berichten, dass College-Direktoren gelegentlich "Berater" engagieren, die ihnen erzählen, "welcher von zwei gleichwertigen Bewerbern wohlhabendere Eltern hat, was die Chance auf eine Schenkung (an das College, Anm. d. Red.) erhöhen könnte (...). Derartige Überlegungen können für die endgültige Entscheidung eine Rolle spielen oder auch nicht. Es ist aber ein Fehler zu glauben, sie kämen nicht zur Sprache." Der Begriff "Leistungsgesellschaft" treffe, so Menand, auf Amerika jedenfalls nicht zu: "Amerikanische Erziehung ist nicht leistungsorientiert und war es nie. (...) Erfolg in der Zulassung zu einem College beruht, wie in den meisten Lebensbereichen, auf einer Mischung aus Fähigkeit, Beziehungen, Hartnäckigkeit und Wohlhabenheit ..."
Außerdem zu lesen: Die Erzählung "The Niece" von Margot Livesey, Kurzbesprechungen zu Büchern, Filmkritiken zu "The Good Thief" von Neil Jordan mit Nick Nolte, Robert Downey Jr. und Winona Ryder und "The Man Without a Past" von Aki Kaurismäki und ein Nachruf auf den "unzuverlässig" neokonservativen Senator Daniel Patrick Moynihan.
Nur in der Printausgabe: Überlegungen zum "anglophonen Empire", ein Hintergrundsbericht von der Wall Street und Lyrik von Mark Strand und Lavinia Greenlaw.
Espresso (Italien), 03.04.2003
 Umberto Eco fühlt sich nicht verpflichtet, zu aktuellen Themen zu schreiben, wie er in der Vorrede seiner Bustina betont. Deshalb erzählt er von einem lange gesuchten und überraschend in einem Antiquariat gefundenen Text, 1655 von dem Protestanten Isaac de la Peyrere veröffentlicht und umgehend verboten. Darin stellt dieser die These von Völkern auf, die vor Adam exisitiert haben müssen, also ohne Sünde waren. "Peyrere hat einfach gesagt eine einzigartige anti-ethnozentrische Operation gestartet, indem er zeigen wollte, dass die Welt und die Zivilisation nicht nur aus 'uns' besteht, sondern auch aus den 'Anderen', die eine sogar noch ältere Zivilisation als die jüdisch-christliche aufweisen." Und dann muss Eco doch wieder aktuell werden. "Und siehe da, meine kleine Wiederentdeckung, die vielleicht doch weniger ein Zufall als vielmehr Vorsehung war, zeigt, dass wir uns heute von Neuem von der Idee eines Kreuzzuges gegen diejenigen blenden lassen, die (so glauben wir) weniger Geschichte und weniger noble Werte haben als wir."
Umberto Eco fühlt sich nicht verpflichtet, zu aktuellen Themen zu schreiben, wie er in der Vorrede seiner Bustina betont. Deshalb erzählt er von einem lange gesuchten und überraschend in einem Antiquariat gefundenen Text, 1655 von dem Protestanten Isaac de la Peyrere veröffentlicht und umgehend verboten. Darin stellt dieser die These von Völkern auf, die vor Adam exisitiert haben müssen, also ohne Sünde waren. "Peyrere hat einfach gesagt eine einzigartige anti-ethnozentrische Operation gestartet, indem er zeigen wollte, dass die Welt und die Zivilisation nicht nur aus 'uns' besteht, sondern auch aus den 'Anderen', die eine sogar noch ältere Zivilisation als die jüdisch-christliche aufweisen." Und dann muss Eco doch wieder aktuell werden. "Und siehe da, meine kleine Wiederentdeckung, die vielleicht doch weniger ein Zufall als vielmehr Vorsehung war, zeigt, dass wir uns heute von Neuem von der Idee eines Kreuzzuges gegen diejenigen blenden lassen, die (so glauben wir) weniger Geschichte und weniger noble Werte haben als wir."Paul Auster (Bücher) spricht mit Andrea Visconti über sein "Buch der Illusionen" und das Wesen der USA. "Unser Land ist ein puritanisches. Wir haben große Angst vor dem Tod, aber zur gleichen Zeit verleugnen wir seine Existenz. Deshalb gibt es in Amerika die Überzeugung, dass wir, wenn wir die richtigen Sachen essen, joggen und uns um selbst kümmern, niemals sterben werden."
Weiteres: Giorgio Bocca sorgt sich im Kulturaufmacher um die amerikanischen Bürgerrechte, die in der Krise verraten würden, und das noch mit dem Placet eines Großteils der Bevölkerung. Greg Campbell schildert in einem Abstract zu seinem Buch das Geschäft mit den Blutdiamanten aus Afrika.
Profil (Österreich), 31.03.2003
 Das neueste Profil-Heft sucht nach Antworten, wie der Krieg im Bild erscheint. Dazu äußern sich die Philosophin Isolde Charim und der Medientheoretiker Boris Groys, der sich in ein Pornokino versetzt fühlt. Isolde Charim sieht sich durch die Bilderflut vom Irak-Krieg in ein medientheoretisches Seminar versetzt: "Wir alle haben die Lektion schnell gelernt: Den Bildern ist nicht zu trauen. Wenn man uns jetzt erzählt, Achtung, die Bilder lügen!, dann kann man abwinken, denn es ist Allgemeingut." Doch "der aktuelle Golfkrieg funktioniert nach einer anderen Logik des Symbolischen... Nicht das Medien-, sondern das Echtzeitereignis ist das Novum. Wesentlich ist jetzt: Hier wird live gekämpft, live gestorben, hier ist man live dabei - an allen Fronten, rund um die Uhr." Und: "Noch nie gab es einen so direkten Zugang zum Krieg - und trotzdem haben wir so wenige gesicherte Informationen."
Das neueste Profil-Heft sucht nach Antworten, wie der Krieg im Bild erscheint. Dazu äußern sich die Philosophin Isolde Charim und der Medientheoretiker Boris Groys, der sich in ein Pornokino versetzt fühlt. Isolde Charim sieht sich durch die Bilderflut vom Irak-Krieg in ein medientheoretisches Seminar versetzt: "Wir alle haben die Lektion schnell gelernt: Den Bildern ist nicht zu trauen. Wenn man uns jetzt erzählt, Achtung, die Bilder lügen!, dann kann man abwinken, denn es ist Allgemeingut." Doch "der aktuelle Golfkrieg funktioniert nach einer anderen Logik des Symbolischen... Nicht das Medien-, sondern das Echtzeitereignis ist das Novum. Wesentlich ist jetzt: Hier wird live gekämpft, live gestorben, hier ist man live dabei - an allen Fronten, rund um die Uhr." Und: "Noch nie gab es einen so direkten Zugang zum Krieg - und trotzdem haben wir so wenige gesicherte Informationen."Der Medientheoretiker Boris Groys ergänzt in einem Interview: "Wir vertrauen der Sprache nicht mehr und wollen, dass unser Wissen durch Bilder verifiziert wird. Der Westen ist christlich geprägt, und das Christentum ist eine Kultur der Bildgläubigkeit. Insofern ist dieser Krieg auch der Versuch, eine bildfeindliche islamische Kultur durch die christliche Bildgläubigkeit zu besiegen und zu besetzen."
Times Literary Supplement (UK), 29.03.2003
 Wer verstehen will, was einen erfolgsverwöhnten Premier dazu bringt, seine politische Karriere für einen Krieg aufs Spiel zu setzen, der die UNO in eine tiefe Krise gerissen hat und den gesamten Nahen und Mittleren Osten in Brand zu stecken droht, meint Peter Clarke, der sollte D. R. Thorpes gründlich recherchierte Biografie über Premierminister Anthony Eden lesen. Der nämlich hat für Öl und Einfluss Großbritannien in den fatalen Suezkrieg geführt, andererseits aber auch als Außenminister beim Münchner Abkommen seine Erfahrungen in Appeasement-Politik gemacht.
Wer verstehen will, was einen erfolgsverwöhnten Premier dazu bringt, seine politische Karriere für einen Krieg aufs Spiel zu setzen, der die UNO in eine tiefe Krise gerissen hat und den gesamten Nahen und Mittleren Osten in Brand zu stecken droht, meint Peter Clarke, der sollte D. R. Thorpes gründlich recherchierte Biografie über Premierminister Anthony Eden lesen. Der nämlich hat für Öl und Einfluss Großbritannien in den fatalen Suezkrieg geführt, andererseits aber auch als Außenminister beim Münchner Abkommen seine Erfahrungen in Appeasement-Politik gemacht.L.G. Mitchell preist Edgar Vincents glänzende Nelson-Biografie ("Love and Fame"), wobei es ihm dieses "gut geschriebene und gründlich recherchierte" Buch genauso angetan hat wie der große Admiral selbst: "Erstens war Nelson immer und ausschließlich aggressiv: Im Krieg ging es darum, jemanden zu bekämpfen. Schwierigkeiten und Hindernisse wurden beiseite gewischt... Zweitens war er ein überragender Kommandeur. Seine Kapitäne waren seine Lieblingskinder."
Zwei neue Bücher zu Nietzsche haben Jonathan Ree davon überzeugt, dass "die Kuh noch gemolken werden kann": zum einen die Essaysammlung "Nietzsche, Godfather of Fascism?", die vorbildlich gründlich untersuche, wieviel Nationalsozialismus in Nietzsche steckt, ohne zu einer endgültigen Aussage zu kommen; zum anderen Curtis Cates' Biografie, die ganz altmodisch versuche, Nietzsches Werk aus seinem Leben zu erklären.
Mick Imlah hat sich köstlich mit Robert Graves wiederaufgelegtem Roman "Antigua, Penny, Puce" von 1935 amüsiert, dessen Witz er so "leicht" findet, dass man ihn nur als "jenseits von Gut und Böse" bezeichnen könne. Jeremy Treglown bedauert, dass der Schriftsteller, Schauspieler und Soho-Dandy Julian Maclaren-Ross seiner Zeit einfach zu weit voraus war, wie er Paul Willetts Biografie "Fear and Loathing in Fitzrovia" entnimmt.
Outlook India (Indien), 07.04.2003
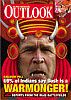 Titelthema ist der Irakkrieg. Paul Danahar berichtet aus Bagdad. Er war in der Nähe, als in einem armen Wohnviertel ohne militärische Infrastruktur Bomben einschlugen und 17 Anwohner - "Menschen, von denen die Amerikaner sagen, sie kommen, um sie zu befreien" - getötet wurden. Zumindest den Kampf um die Sympathien, meint er, dessen Ausgang nicht nur für den Krieg, sondern auch die Zeit danach entscheidende Bedeutung haben wird, werde Amerika auf diese Weise verlieren.
Titelthema ist der Irakkrieg. Paul Danahar berichtet aus Bagdad. Er war in der Nähe, als in einem armen Wohnviertel ohne militärische Infrastruktur Bomben einschlugen und 17 Anwohner - "Menschen, von denen die Amerikaner sagen, sie kommen, um sie zu befreien" - getötet wurden. Zumindest den Kampf um die Sympathien, meint er, dessen Ausgang nicht nur für den Krieg, sondern auch die Zeit danach entscheidende Bedeutung haben wird, werde Amerika auf diese Weise verlieren.Hani Sukrallah erinnert sich, dass Mark Twain vor mehr als hundert Jahren die amerikanische "Befreiung" der Philippinen als Eroberung entlarvte. Das "amerikanische Jahrhundert" begann. Ein weiteres, ist er überzeugt, wird es nicht geben: Die Iraker leisten Widerstand - wenn auch nicht aus Liebe zu ihrem Diktator -, und der Rest der Welt geht in Opposition. Und V. Sudarshan macht sich Gedanken über die neutrale Haltung der indischen Regierung zum Krieg.
Weitere Artikel: Prem Shankar Jha analysiert die Lage in Kaschmir nach dem jüngsten Terroranschlag vor wenigen Tagen. Mallica Singh kennt die Sorgen von Indiens Eltern: Was machen ihre verwestlichten Kinder, wenn sie nachts unterwegs sind oder tagelang wegbleiben? Woher kommen die Augenringe des Sohnes? Oder die schlechten Collegeleistungen der Tochter? Ihr drastischer Ausweg: Sie engagieren Detektive.
Und Namrata Joshi erklärt, wie die indische Filmindustrie sich anschickt, zum Global Player zu werden. Ein erstes Beispiel dafür war Shekar Kapurs Film "Elizabeth", der "auf dem Leben der britischen Königin basiert, die von einer australischen Schauspielerin gespielt wird, während ein indischer Filmemacher Regie führt und ein Hollywood-Studio die Produktion übernimmt". Bollywood, berichtet Joshi, drängt ins Ausland - mit internationalen Koproduktionen sollen die Märkte weltweit erschlossen werden. "Wir sind in der Werbephase", sagt ein britischer Produzent, "Heirat ist unausweichlich."
Express (Frankreich), 27.03.2003
 Die Position der französischen Regierung im Irak-Krieg kommentiert in dieser Woche Jacques Attali: "Was auch immer das Los der Waffen sein mag, es beweist sich jeden Tag aufs Neue, wie Recht Frankreich hatte, nicht den Forderungen der amerikanischen Regierung mit ihrer arroganten und autistischen Haltung nachzugeben." Claude Allegre denkt über die Rolle der Demokratie im Irak-Krieg nach. Ist es möglich auf antidemokratischer Basis eine Demokratie zu errichten? Kann das Anliegen, ein demokratisches Regierungssystem zu etablieren, den Krieg im Irak legitimieren? Die komplette Irak-Dossier des Express finden Sie hier.
Die Position der französischen Regierung im Irak-Krieg kommentiert in dieser Woche Jacques Attali: "Was auch immer das Los der Waffen sein mag, es beweist sich jeden Tag aufs Neue, wie Recht Frankreich hatte, nicht den Forderungen der amerikanischen Regierung mit ihrer arroganten und autistischen Haltung nachzugeben." Claude Allegre denkt über die Rolle der Demokratie im Irak-Krieg nach. Ist es möglich auf antidemokratischer Basis eine Demokratie zu errichten? Kann das Anliegen, ein demokratisches Regierungssystem zu etablieren, den Krieg im Irak legitimieren? Die komplette Irak-Dossier des Express finden Sie hier.In der Bücherschau lesen wir ein Porträt des amerikanischen Autors James Salter. "Amerika ist mein Heimatland, Frankreich ist mein Zufluchtsland", erklärt er gegenüber dem Express, "denn wie kann man es wagen, die neue Welt gegen das alte Europa auszuspielen?" Einen Auszug aus seinem neuen Roman "Bangkok" finden Sie hier. Michel Grisolia lobt einen Briefroman über den Algerienkrieg. Thierry Gandillot freut sich über die surrealistische Erzählung "Lobster" von Guillaume Lecasble. Sie handelt vom Untergang der Titanic und zwar aus der Perspektive eines Hummers.
Weitere Artikel: Gilles Medioni schreibt ein kleines Portrait der französischen Musikgruppe La Tordue. Nicht nur von der Musik zwischen Rock, Ska und Reggae schwärmt er, sondern auch von den Songtexten, die alles andere als banal seien. Der Chansonier Maxime Le Forestier plaudert im Gespräch mit Eric Libiot über Star Academy, das Fernsehen, soziales Engagement und natürlich Musik. Und: Marie Cousin lässt die Franzosen anlässlich eines internationalen Kongresses über Beleidigungen aller Art mal so richtig schimpfen. Zu den neuesten französischen Schimpfwörtern gehört unter anderem: "Fait pas ton Bush!"
New York Times (USA), 30.03.2003
 Bevor W.C. Fields (Aphorismen) zum Filmstar wurde, schreibt Richard Schickel in seiner Besprechung der Fields-Biografie (erstes Kapitel) von Richard Curtis, verbrachte er zwei Jahrzehnte beim Kabarett, wo er seine unnachahmliche Comicversion von sich selbst erschuf. "Der einst verbreitete Männertyp, den er verkörperte - der trunksüchtige Einzelgänger, gerissen und tönend, ohne Liebe oder Wurzeln, der seine kleinen Pläne und zum Scheitern verurteilten Träume unter einer Wolke aus grandiosen Worten verbarg - ist verloren." Nur beinahe, denn jetzt gibt es ja die Biografie. Und auch wenn sich Schickel von dem ihm etwas zu biederen Curtis gewünscht hätte, dass er "Field's feinere Absurditäten mit ein wenig mehr Verve und Detail" erzählt hätte, muss er dem Autor doch ein Kompliment aussprechen. Denn immerhin sei das Buch die "bei weitem vollständigste, redlichste und schließlich anrührendste Darstellung" von Fields "traurigem, einsamen Leben."
Bevor W.C. Fields (Aphorismen) zum Filmstar wurde, schreibt Richard Schickel in seiner Besprechung der Fields-Biografie (erstes Kapitel) von Richard Curtis, verbrachte er zwei Jahrzehnte beim Kabarett, wo er seine unnachahmliche Comicversion von sich selbst erschuf. "Der einst verbreitete Männertyp, den er verkörperte - der trunksüchtige Einzelgänger, gerissen und tönend, ohne Liebe oder Wurzeln, der seine kleinen Pläne und zum Scheitern verurteilten Träume unter einer Wolke aus grandiosen Worten verbarg - ist verloren." Nur beinahe, denn jetzt gibt es ja die Biografie. Und auch wenn sich Schickel von dem ihm etwas zu biederen Curtis gewünscht hätte, dass er "Field's feinere Absurditäten mit ein wenig mehr Verve und Detail" erzählt hätte, muss er dem Autor doch ein Kompliment aussprechen. Denn immerhin sei das Buch die "bei weitem vollständigste, redlichste und schließlich anrührendste Darstellung" von Fields "traurigem, einsamen Leben."Außerdem gibt es Interessantes zum Innenleben der USA. Ab und an erscheinen Essays, die exakt ausdrücken, was eine Nation gerade denkt, preist Serge Schmemann Robert Kagans "Of Paradise and Power" ("Macht und Ohnmacht", erstes Kapitel im Original). In dem jetzt auf Buchformat erweiterten Aufsatz aus dem vergangenen Sommer schildert Kagan, wie Europa und Amerika sich entfremden werden. "Der Fakt, dass Kagan seinen Essay Monate vor dem Auseinanderdriften von Washington und Paris im Weltsicherheitsrat veröffentlicht hat, lässt ihn fast als Propheten erscheinen."
Loren Goodman schreibt ein Gedicht über das Gedichteschreiben im Auftrag der Regierung: "My work for the government / is not only confidential, it is gross, exquisite / many lives hang in the balance. I'm also writing some poems /that aren't for the government, but now those seem / about nothing at all. I don't know where or how my poems / will be used, but I want them to be foolish and deadly."
Weitere Besprechungen: Sophie Harrison findet den im Mysterygenre beheimateten Debütroman von Louise Welsh "The Cutting Room" (erstes Kapitel) deshalb so bemerkenswert wie unterhaltsam, weil man auf jeder Seite die Schaffensfreude der Autorin spüre. Manchmal müsste man Vassilis Vassilikos von ihm so genannte Novistory "The Few Things I Know About Glafkos Thrassakis" zwar eher dekodieren als lesen, nichtsdestotrotz wünscht sich Mary Park mehr von diesem Autor, der "noch viel zu spärlich" ins Englische übersetzt worden ist.








