Magazinrundschau
Die Magazinrundschau
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
02.02.2003. Der Merkur rechnet mit einem "geistig verwahrlosten" Slavoj Zizek ab. In der NYT Book Review schwärmt Jeffrey Eugenides von der Brillanz und dem Charme der Feuilletons, die Joseph Roth in Berlin geschrieben hat. Im NouvelObs wundert sich Brian Eno über die Arroganz der USA. Im Spiegel fordert Leon de Winter mehr Eigenverantwortlichkeit der Araber. Der Economist findet Frankreich schwierig. Das TLS empfiehlt dringend Kenneth Pollacks Buch zum Irak "The Threatening Storm". Outlook India meditiert über die Bedeutung des Cricket.
Merkur (Deutschland), 01.02.2003
Wo immer postmodernistisch, medienphilosophisch oder vernunftkritisch herumtheoretisiert werde, ist der slowenische Philosoph Slavoj Zizek dabei und sorgt mit "apart kontrapunktisch gesetzten Lacan- und Leninzitaten" für Radical Chic. Für Jörg Lau Grund, einmal gehörig mit Zizek abzurechnen, dessen "pseudowissenschaftliche Einlassungen" er zwischen Scharlatanerie und aufgeblasener Banalität schwanken sieht. Mal sieht Zizek nämlich im 11. September ein ideologiekritisches Unternehmen, mal bewundert er die "heroische Weise", mit der Lenin den Bolschewiki die Macht gesichert habe. "Dieser Autor scheint getrieben von einem unbedingten Willen zum Verbalradikalismus, auch noch um den Preis von Lüge und Geschichtsklitterei. Das hat schon etwas Verkommenes, geistig Verwahrlostes an sich. Nimmt man Zizek über Lenin beim Wort, so liegt hier nichts Geringeres vor als eine Apologie des politischen Massenmordes." Und einmal soll es gesagt sein: "Wem es allein auf Zitatpomp, kombinatorische Überraschungseffekte und Moralprotzerei ankommt, der produziert Bullshit im strengen Sinn des Wortes."
In weiteren Artikel schreibt Stephan Wackwitz über sein Lesen und Leben als junger Schmerzensmann und das vergebliche Warten auf den Messias. Katharina Rutschky findet den Poproman völlig zu unrecht geschmäht und sieht Benjamin von Stuckrad-Barre und Christian Kracht ganz in der Nähe des jungen Goethe, der mit dem Werther das Genre überhaupt begründet hat. Michael Rutschky porträtiert den großen Geschichtserzähler des 20. Jahrhunderts Walter Kempowski. Ralf Dahrendorf plaudert in seiner Politikkolumne wieder einmal aus dem britischen Oberhaus, von Heinrich VIII und darüber, wie sich die Lords gegen die Labour-Regierung auf die Seite von Asylbewerbern schlugen.
In weiteren Artikel schreibt Stephan Wackwitz über sein Lesen und Leben als junger Schmerzensmann und das vergebliche Warten auf den Messias. Katharina Rutschky findet den Poproman völlig zu unrecht geschmäht und sieht Benjamin von Stuckrad-Barre und Christian Kracht ganz in der Nähe des jungen Goethe, der mit dem Werther das Genre überhaupt begründet hat. Michael Rutschky porträtiert den großen Geschichtserzähler des 20. Jahrhunderts Walter Kempowski. Ralf Dahrendorf plaudert in seiner Politikkolumne wieder einmal aus dem britischen Oberhaus, von Heinrich VIII und darüber, wie sich die Lords gegen die Labour-Regierung auf die Seite von Asylbewerbern schlugen.
New Yorker (USA), 10.02.2003
 Jeffrey Goldberg beschäftigt sich mit der Frage, was CIA und Pentagon vor dem 11. September eigentlich über Al Qaida wussten. Akribisch rekonstruiert er unter anderem eine "Aufklärungsreise" des ehemaligen UN-Botschafters Bill Richardson 1998 nach Südostasien. Diese Reise, so Goldberg, "hätte ein diplomatischer Erfolg sein können, wenn sie nachrichtendienstlich nicht ein solcher Flop gewesen wäre". Goldberg dokumentiert in seinem Text auch Einschätzungen eines Vertreters der National Security Agency und des gegenwärtigen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, dessen Ministerium über die Frage von "Verbindungen zwischen Saddam und Al Qaida" mit der CIA schon lange im Clinch liege. CIA-Chef Tenet jedenfalls sei davon überzeugt, "dass Amerika den schlimmsten Terroranschlag von Al Qaida noch gar nicht erlebt" habe. "Ich befürchte", zitiert ihn Goldberg, "dass, was immer wir auch herausfinden, niemals reichen wird. (...) Wenn Sie im Nachrichtendienst nach Unfehlbarkeit suchen, werden Sie ständig Überraschungen und Schocks erleben. Sie haben es mit einem Feind zu tun, der sich extrem gut mit Ihrem Land auskennt."
Jeffrey Goldberg beschäftigt sich mit der Frage, was CIA und Pentagon vor dem 11. September eigentlich über Al Qaida wussten. Akribisch rekonstruiert er unter anderem eine "Aufklärungsreise" des ehemaligen UN-Botschafters Bill Richardson 1998 nach Südostasien. Diese Reise, so Goldberg, "hätte ein diplomatischer Erfolg sein können, wenn sie nachrichtendienstlich nicht ein solcher Flop gewesen wäre". Goldberg dokumentiert in seinem Text auch Einschätzungen eines Vertreters der National Security Agency und des gegenwärtigen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, dessen Ministerium über die Frage von "Verbindungen zwischen Saddam und Al Qaida" mit der CIA schon lange im Clinch liege. CIA-Chef Tenet jedenfalls sei davon überzeugt, "dass Amerika den schlimmsten Terroranschlag von Al Qaida noch gar nicht erlebt" habe. "Ich befürchte", zitiert ihn Goldberg, "dass, was immer wir auch herausfinden, niemals reichen wird. (...) Wenn Sie im Nachrichtendienst nach Unfehlbarkeit suchen, werden Sie ständig Überraschungen und Schocks erleben. Sie haben es mit einem Feind zu tun, der sich extrem gut mit Ihrem Land auskennt."Weiteres: Die Erzählung "Ice Man" kommt in dieser Woche von Haruki Murakami (mehr hier). Hendrik Hertzberg kommentiert Bushs Kriegspläne ("Blixkrieg"), und Roger Angell stöhnt über verwirrende New Yorker Telefonnummern, die neuerdings elf statt sieben Ziffern und/oder Buchstaben haben.
Nicholas Lemann bespricht die zweibändige Anthologie "Reporting Civil Rights: American Journalism 1941-1973", die mit einigen verklärenden Erinnerungen an die "Glanzzeiten" der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung aufräume. Die Lektüre der 188 chronologisch geordneten Artikel zeige vielmehr deutlich "das Durcheinander innerhalb der Bewegung, ihren Radikalismus, ihre Unorganisiertheit, ihre hohe Versagensquote und ihre fehlende innere Übereinstimmung".
Anthony Lane stellt eine Ausstellung mit Fotografien von August Sander (mehr hier) im Museum of Modern Art in San Francisco vor. Nancy Franklin begutachtet die beiden neuen TV-Serien "Kingpin" und "Dragnet". Besprochen wird eine Inszenierung von Shakespeares "Wintermärchen", und David Denby fragt sich anlässlich einer Retrospektive, ob Amerika jetzt "endlich bereit" für Fassbinder sei.
Nur in der Printausgabe: Ein "Letter from Iran" über einen irakischen Oppositionsführer, der von Bagdad träumt und sehnlich auf den Krieg wartet, ein Bericht über das Tanztheater von Merce Cunningham (mehr hier) und Twyla Tharp (mehr hier), ein Text über die Suche nach einer Heilmethode für Diabetes und Lyrik von Philip Levine, Maxine Kumin und Venus Khoury-Ghata.
New York Times (USA), 02.02.2003
 Heute sind sie ausgestorben, die Universalgelehrten vom Schlage eines Christopher Wren (mehr hier): Lisa Jardine stellt uns den 1632 geborenen Mathematiker, Astronomen und Erfinder in ihrer Biografie "On a Grander Scale" (erstes Kapitel) als geniales Geschöpf der Renaissance vor, der, bevor er sich der Architektur zuwandte und etwa die St. Pauls Kathedrale in London entwarf, von Isaac Newton als einer der drei fähigsten Köpfe der Geometrie bezeichnet wurde und in schon seinen Jugendjahren mit Oxforder Studienkollegen wie William Petty (mehr hier) und Robert Boyle (mehr hier) quasi nebenbei die legendäre Royal Society gegründet hatte. Witold Rybczynskit, selbst Architekturprofessor, glaubt der Renaissance-Spezialistin Jardine in seiner Rezension zwar schon, dass Wren weit mehr war als nur ein begabter Gebäudekonstrukteur, aber "es gibt keinen Zweifel daran, dass er nun mal mit seinen Bauten in die Geschichte eingegangen ist, und eine Biografie, die diese nicht ausgiebig würdigt, wirkt ein wenig luftig. Dieser Mangel wird kompensiert durch einen Reichtum an Informationen über periphere Themen und Individuen; dies ist ein Buch, in dem - metaphorisch gesagt - die Fußnoten ihre Fußnoten haben.
Heute sind sie ausgestorben, die Universalgelehrten vom Schlage eines Christopher Wren (mehr hier): Lisa Jardine stellt uns den 1632 geborenen Mathematiker, Astronomen und Erfinder in ihrer Biografie "On a Grander Scale" (erstes Kapitel) als geniales Geschöpf der Renaissance vor, der, bevor er sich der Architektur zuwandte und etwa die St. Pauls Kathedrale in London entwarf, von Isaac Newton als einer der drei fähigsten Köpfe der Geometrie bezeichnet wurde und in schon seinen Jugendjahren mit Oxforder Studienkollegen wie William Petty (mehr hier) und Robert Boyle (mehr hier) quasi nebenbei die legendäre Royal Society gegründet hatte. Witold Rybczynskit, selbst Architekturprofessor, glaubt der Renaissance-Spezialistin Jardine in seiner Rezension zwar schon, dass Wren weit mehr war als nur ein begabter Gebäudekonstrukteur, aber "es gibt keinen Zweifel daran, dass er nun mal mit seinen Bauten in die Geschichte eingegangen ist, und eine Biografie, die diese nicht ausgiebig würdigt, wirkt ein wenig luftig. Dieser Mangel wird kompensiert durch einen Reichtum an Informationen über periphere Themen und Individuen; dies ist ein Buch, in dem - metaphorisch gesagt - die Fußnoten ihre Fußnoten haben.Ganz entzückt ist Jeffrey Eugenides, Autor des viel gefeierten Romans "Middlesex" (Links dazu hier) davon , dass er, im Lieblingscafe von Joseph Roth (mehr hier) in Amsterdam sitzend, eine Sammlung seiner Feuilletons ("What I Saw". Reports from Berlin. 1920-1933) lesen konnte. "Das Schwierigste an dieser Besprechung ist, dass ich jeden Satz aus "What I Saw" zitieren möchte. Es ist wie mit Borges Universal Library; das die ganze Welt enthält: eine richtige Rezension dieses Buches wäre schlicht das Buch selbst. Der Wert dieser Feuilletons hat nichts zu tun mit der typografischen Perspektive, was zählt, ist ihre kontinuierliche Brillanz, ihr unwiderstehlicher Charme und ihre unverminderte Bedeutung." Eugenides gibt nebenbei auch eine aufschlussreiche Kurzdefinition des Feuilletons: "Keine Nachricht. Kein Stadtbericht. Das Gegenteil eines Editorials, beschreibend, philosophisch, mäandernd und poetisch."
Außerdem: Neil Gordon glaubt, Risa Millers gewiefter Debütroman "Welcome to Heavenly Heights" wird gehörig unterschätzt. In dem Buch beschreibt sie den Umzug eines jüdisch-orthodoxen Pärchens von Baltimore in eine mit allem Komfort ausgestattete, von waffenstrotzenden Helikoptern bewachte und dabei noch spottbillige, weil vom Staat und geheimnisvollen Gönnern gesponserte Siedlung nördlich von Jerusalem. Durchaus interessant, aber nicht völlig überzeugend findet John Noble Winford die These des ehemaligen britischen U-Boot-Kommandanten Gavin Menzies, die Chinesen hätten Amerika schon "1421" (erstes Kapitel), also siebzig Jahre vor Kolumbus, entdeckt. Und Walter Kirn ist sich sicher, dass niemand anderes eine so wundervolle Geschichte über die Bedeutung von Kleinigkeiten hätte schreiben können wie der Minaturist Nicholson Baker mit "A Box of Matches" es nun getan hat. (Erstes Kapitel und hier eine Lesung des Autors.)
Nouvel Observateur (Frankreich), 30.01.2003
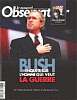 Im Debattenteil meldet sich in dieser Woche der englische Musiker Brian Eno (Roxy Music, Homepage) zu Bush, Amerika und der Irakkrise zu Wort. In seinem Text, der erstmals im Time Magazine erschien (hier), erläutert er seine These, wonach sich die USA "in einer Festung der Arroganz und Ignoranz verschanzt" haben, in der "Paranoia und Isolierung zur Lebensform" geworden seien. Die zentrale Frage, die ihn umtreibe, sei: "Wie kann ein Land, das so viel kulturellen und wirtschaftlichen Reichtum hervorgebracht hat, so dumm handeln?"
Im Debattenteil meldet sich in dieser Woche der englische Musiker Brian Eno (Roxy Music, Homepage) zu Bush, Amerika und der Irakkrise zu Wort. In seinem Text, der erstmals im Time Magazine erschien (hier), erläutert er seine These, wonach sich die USA "in einer Festung der Arroganz und Ignoranz verschanzt" haben, in der "Paranoia und Isolierung zur Lebensform" geworden seien. Die zentrale Frage, die ihn umtreibe, sei: "Wie kann ein Land, das so viel kulturellen und wirtschaftlichen Reichtum hervorgebracht hat, so dumm handeln?"In einem Gespräch stellen Zbigniew Brzezinski, ehemaliger Berater von US-Präsident Carter, und der ehemalige französische Außenminister Hubert Vedrine fest, dass "weder Saddam Hussein noch George W. Bush die Risiken eines neuen Konflikts bewusst" seien. Einig sind sie sich vor allem in der Einschätzung Brzezinskis, dass "ein von der internationalen Gemeinschaft unterstützter Krieg keinen Zusammenschluss des Ostens" zur Folge haben werde. Die Situation nach einem Krieg werde vielmehr "weniger von einem miltiärischen Sieg als von der 'Persönlichkeit' des politischen Gewinners abhängen".
Interessant zu lesen ist eine Reportage über Produktplacement im Film. Anlass ist der Start des Films "Taxi 3", den Luc Besson produzierte, und dessen "eigentlicher Star" ein weißer Peugeot 406 ist. "Ein Film ist ein Taxi", hat der Autor des Textes herausgefunden, "dessen Passagiere mehr oder weniger heimlich die Marken sind." Kein Wunder, wenn man die Verantwortliche für Produktplacement bei Master Partenariat hört: "Wir lesen das Drehbuch und fragen uns für jede Szene, welches Produkt man hier unterbringen könnte. Bei einer Frühstücksszene wären das etwa eine Marmelade der Firma X oder Cornflakes."
Besprochen werden zwei Bücher, die Porträts prominenter Zeitzeugen, autobiografische Erinnerungen und vermutlich auch ein wenig Klatsch in sich vereinen. So defilieren durch "Les jours s'en vont je demeure" (Gallimard) von Pierre Berge, langjähriger Geschäftspartner und Freund von Yves Saint Laurent, Louise de Vilmorin, Jean Cocteau, Jean Giono und Francois Mitterrand; unter den "beautiful poeple", denen man im Buch des Schriftstellers Marc Lambron begegnet ("Carnet de bal", Grasset), befinden sich Marguerite Duras und Orson Welles, Woody Allen und Robbe-Grillet, Dior und Monica Lewinsky sowie unzählige andere mehr. Vorgestellt wird außerdem die Autobiografie "Oublier le temps" (Seuil) von Theaterregisseur Peter Brook.
Spiegel (Deutschland), 03.02.2003
 Mit seinem Montagserscheinen ist der Spiegel für Wahlberichterstattung bekanntlich nicht gerade optimal positioniert. Diesmal aber ist's egal, weil klar war, wie es ausgehen würde. Und da ohnehin, innen- wie außenpolitisch, 100 für ihn nicht gerade angenehme Tage vorüber sind, wird, Verdruss im Gesicht, "Der einsame Kanzler" auf den Titel gerückt.
Mit seinem Montagserscheinen ist der Spiegel für Wahlberichterstattung bekanntlich nicht gerade optimal positioniert. Diesmal aber ist's egal, weil klar war, wie es ausgehen würde. Und da ohnehin, innen- wie außenpolitisch, 100 für ihn nicht gerade angenehme Tage vorüber sind, wird, Verdruss im Gesicht, "Der einsame Kanzler" auf den Titel gerückt. Nach Wochen ohne Online-Kultur mit Heftursprung gibt es diesmal eine ganze Menge. Der Schriftsteller Leon de Winter (mehr hier) widerspricht in polemischem Ton John Le Carres vor zwei Wochen erschienener Philippika gegen den Irak-Krieg. Sein Kronzeuge ist dabei der "der libanesisch-schiitisch-stämmige Wissenschaftler" Fouad Ajami, Professor für Nahost-Studien an der Johns Hopkins University. So schreibt Winter: "Aus le Carres Artikel sprechen die Ansichten und Obsessionen des antiamerikanischen intellektuellen Establishments in Europa; Ajami gehört zu den wenigen arabischen Wissenschaftlern, die weder Political Correctness noch eine etwaige Gefährdung des eigenen Lebens daran hindern können, auf die Eigenverantwortlichkeit der Araber hinzuweisen, die sich selbst in den vergangenen Jahrzehnten eine Serie von Tragödien zugefügt haben." Martialisch de Winters Schlussbild: "Deshalb muss man dem Ungeheuer den Kopf abschlagen - wenn der Westen das unterlässt, wird das Ungeheuer unsere Köpfe rollen lassen." Freigeschaltet ist auch das Interview mit dem irakischen Vizepräsidenten Taha Jassin Ramadan, der, eher nebenbei, für den Kriegsfall den Einsatz von tausenden Selbstmordattentätern ankündigt.
Außerdem: Ein Interview mit Leonardo Di Caprio, der auf die Frage, ob die USA das beste Land der Welt seien, diplomatisch antwortet: "Ich habe von meinen Eltern gelernt, nicht alles zu glauben, was man mir erzählt." Thomas Tuma hat die undankbare Aufgabe, die Spiegel-übliche Soße aus Hohn, Spott und windelweicher Kulturkritik über den RTL-Erfolg "Deutschland sucht den Superstar" zu gießen. Genaueres ist über den Scheich mit besten Terrorismus-Verbindungen zu erfahren, den sich Günter Netzer und die Sportrechte-Agentur Infront ins Boot geholt haben. Und Bill Gates hat 100 Schülern in München die Zukunft vorausgesagt.
Outlook India (Indien), 10.02.2003
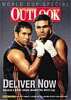 Das indische Wochenmagazin gewährt heute tiefste Einblicke in eine wahrhaft fremde Welt. Es steht nämlich die Cricket-Weltmeisterschaft (Homepage hier) unmittelbar bevor (sie wird von Anfang Februar bis Mitte März dauern) - und für dieses epochale Ereignis hat man das Heft mehr oder weniger freigeräumt.
Das indische Wochenmagazin gewährt heute tiefste Einblicke in eine wahrhaft fremde Welt. Es steht nämlich die Cricket-Weltmeisterschaft (Homepage hier) unmittelbar bevor (sie wird von Anfang Februar bis Mitte März dauern) - und für dieses epochale Ereignis hat man das Heft mehr oder weniger freigeräumt.Sehr grundsätzliche Fragen stellt sich Sandipan Deb in seinem umfangreichen Essay zum Thema: "Was ist der Grund für diese seltsame, undankbare, sinnlose, nur unsere Zeit kostende Leidenschaft, die wir Inder in unseren Herzen tragen, von der wir nicht loskommen, über die wir heftig in Streit geraten können? Warum vergessen wir all unsere Probleme, all die Schrecklichkeiten, die wir ertragen müssen, sobald die Rede auf Cricket kommt? (...) Ist es deshalb, weil wir sonst nichts haben? Nur dieses Spiel?" Es folgt eine ellenlange Aufzählung dessen, was alles schiefläuft in Indien (Armut, schlechte Straßen, korruptes Rechtssystem, Stromversorgung etc.). Bleibt, tatsächlich, nur Cricket: "Wir haben, unbewusst, denke ich, herausgefunden, dass unter allen menschlichen Tätigkeiten Cricket die eine ist, in der wir den Rest der Welt tatsächlich schlagen können. (...) Im Cricket sind wir in der Lage, das zu erreichen, was die USA auf dem Feld der Geopolitik erreichen."
In einer für den Uneingeweihten vielleicht etwas rätselhaften Tabelle wird erklärt, wir Indien auf jeden Fall schon mal ins Halbfinale gelangen kann. Eine eigene Kolumne - Captainspeak - hat der Kapitän des Teams Saurav Ganguly. Er ist, wen wundert's, voller Zuversicht.
Ein bisschen Platz ist dann doch noch für Politik. Michael Krepon warnt die indische Regierung vor der Taktik atomarer Abschreckung. Kritisch kommentiert wird wieder einmal Bushs Irak-Politik. Nur im Web gibt es die Rede, die Arundhati Roy beim Weltsozialforum in Porto Allegre über das "Empire" gehalten hat.
Economist (UK), 31.01.2003
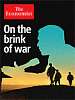 Frankreich war schon immer "schwierig", meint zähneknirschend der Economist. Und die derzeitige französische Außenpolitik sei da keine Ausnahme. Doch den USA ein europäisches Schnippchen schlagen zu wollen, könnte weitreichende Folgen haben. "Aus welchem Grund auch immer, Tatsache ist, dass Frankreich ein riskantes Spiel spielt. Die Drohung, sein UN-Vetorecht zu nutzen, könnte Amerika davon überzeugen, den Inspektoren mehr Zeit zu lassen. Sollte es jedoch tatsächlich zu einem Veto kommen und Amerika unbeeindruckt voranschreiten, würde das Veto und das System des Sicherheitsrats bedeutungslos werden - und Frankreichs Anspruch, der Wächter des Multilateralismus zu sein, könnte hohl erscheinen."
Frankreich war schon immer "schwierig", meint zähneknirschend der Economist. Und die derzeitige französische Außenpolitik sei da keine Ausnahme. Doch den USA ein europäisches Schnippchen schlagen zu wollen, könnte weitreichende Folgen haben. "Aus welchem Grund auch immer, Tatsache ist, dass Frankreich ein riskantes Spiel spielt. Die Drohung, sein UN-Vetorecht zu nutzen, könnte Amerika davon überzeugen, den Inspektoren mehr Zeit zu lassen. Sollte es jedoch tatsächlich zu einem Veto kommen und Amerika unbeeindruckt voranschreiten, würde das Veto und das System des Sicherheitsrats bedeutungslos werden - und Frankreichs Anspruch, der Wächter des Multilateralismus zu sein, könnte hohl erscheinen."Der Friedenstaube Colin Powell sind Klauen gewachsen, beobachtet der Economist. In der Tat sei dem ärgsten Verfechter der "militärischen Vorsicht" und der multilateralen Bündnispolitik nach dem deutsch-französischen Ausscheren der Geduldsfaden gerissen. Ob er damit nun zum Falken geworden ist, darüber möchte der Economist nicht entscheiden. Doch eins sei klar: "Wie jeder andere Aspekt der amerikanischen Außenpolitik hat sich auch die Powell-Doktrin an die Wirklichkeit der Al-Qaida anpassen müssen."
Alles spricht vom Krieg: So sicher ein letztendlicher Sieg über den Irak auch ist, es wird in vielerlei Hinsicht keine Neuauflage des letzten Golfkrieges sein, meint der Economist, denn die USA müssten sich auf unkonventionelle, "asymetrische" Faktoren in der irakischen Kriegsführung gefasst machen. Außerdem träumt der Economist von (sich noch in Entwicklung befindenden) elektromagnetische Waffen, die angeblich elektronische Systeme zerstören und Menschen nur "zeitweilig außer Gefecht setzen". Weiter wird danach gefragt, wie man Bioterrorismus entgegentreten kann. Klingt nach Krieg, ist es aber nicht: Der Economist grüßt "Caesar", ein neues, sauberes Atomenergie-Verfahren, das laut seinem Entwickler Claudio Filippone Strom aus Atommüll gewinnt. Und schließlich doch wieder Blut: Ein Nachruf auf den japanischen Regisseur Kinji Fukasaku, der mit seinen Filmen entscheidend zu "Japans Karneval der Grausamkeit" beigetragen hat.
Intelligenz ade! Der Economist erklärt, warum es höchste Zeit ist, den Mythos vom hochintelligenten Schachspieler zu begraben. Dass auch Schriftstellerei nichts für Intelligenzbestien ist, zu diesem Fazit kommt der Economist nach der Lektüre von "The Time of Our Singing" (mehr hier), dessen Autor, Richard Powers, Gewinner eines MacArthur "Genie"-Forschungsstipendiums ist.
Außerdem zu lesen: warum sich Großbritannien überlegt, aus dem Genfer Abkommen oder aus der Europäischen Menschenrechtskonvention auszutreten, worüber sich die palästinensischen Verteter in Kairo einigen wollten, aber nicht konnten, und wie Hernando de Soto beabsichtigt, dem Terrorismus mit dem Kapitalismus den Garaus zu machen.
Nur im Print zu lesen: ein Dossier zum bevorstehenden Irak-Krieg, mit unter anderem einem Kommentar zum Blix-Bericht. Außerdem, eine Einschätzung des israelischen Wahlergebnisses und die Analyse von Bushs "Rede zur Lage der Nation".
Times Literary Supplement (UK), 31.01.2003
 Peter Baehr empfiehlt jedem, der noch über den Irak mitreden möchte, so schnell wie möglich Kenneth Pollacks Buch "The Threatening Storm" zu lesen. Wie ein "Leuchtfeuer der Vernunft und Verantwortung" ragt es aus dem Nebel der vorurteilsbeladenen Debatte hervor, meint Baehr. Das Buch biete "nicht nur eine scharfsichtige Analyse von Saddams Terrormaschinerie und seiner militärischen Möglichkeiten, sondern auch den Blick eines kritischen Insiders auf die Debatten über den Irak, die innerhalb der Regierungen von Bush Senior und Clinton geführt wurden. Beileibe kein Apologet dokumentiert Pollack unnachgiebig das sträfliche Wunschdenken , das die Politik der USA und des Westens gegenüber dem Irak über Jahre hinweg begleitete." (Der Spiegel druckt gerade in einer Serie Auszüge aus dem Buch.)
Peter Baehr empfiehlt jedem, der noch über den Irak mitreden möchte, so schnell wie möglich Kenneth Pollacks Buch "The Threatening Storm" zu lesen. Wie ein "Leuchtfeuer der Vernunft und Verantwortung" ragt es aus dem Nebel der vorurteilsbeladenen Debatte hervor, meint Baehr. Das Buch biete "nicht nur eine scharfsichtige Analyse von Saddams Terrormaschinerie und seiner militärischen Möglichkeiten, sondern auch den Blick eines kritischen Insiders auf die Debatten über den Irak, die innerhalb der Regierungen von Bush Senior und Clinton geführt wurden. Beileibe kein Apologet dokumentiert Pollack unnachgiebig das sträfliche Wunschdenken , das die Politik der USA und des Westens gegenüber dem Irak über Jahre hinweg begleitete." (Der Spiegel druckt gerade in einer Serie Auszüge aus dem Buch.)Mit einer gewissen Skepsis hat David Schiff die Memoiren "An Improbable Life" des Dirigenten und Strawinsky-Vertrauten Robert Craft gelesen. Überrascht hat ihn die "Enthüllung", dass der eigentümliche Strawinsky/Craft-Sound, für den das Duo so berühmt wurde, von Craft stamme. Gefallen hat ihm diese biografische Version des magischen Realismus aber dennoch. "Crafts Lebensgeschichte ist eine Variante des amerikanischen Traums, aus der kurzen Zeit (nach Jay Gatsby und vor Bill Gates) in der Geschichte der anti-intellektuellen Republik, als ein Geistesleben noch genau so glamourös erscheinen konnte wie ein Landhaus auf Long Island. Aber der amerikanische Traum selbst ist eine Variante der Josephslegende. Ein Niemand, Benjamin Franklin oder Dorothy Gale, kommen in die Großstadt, wo sich Schwächen wundersamerweise in Stärken verwandeln. Als Craft Strawinskys Haus am Sunset Strip betrat, wechselte seine Welt von Schwarz-Weiß in Technikolor."
Weitere Artikel: Erich Segal bejubelt die neue, fünfte Ausgabe des "Shorter Oxford English Dictionary": "Man muss nicht logophil sein, um seine Freude an dieser gigantischen Produktion zu haben. Man muss nur stark genug sein, um die beiden Bände mit ihren 3.751 Seiten und einem Gewicht von 6,19 Kilo zu heben zu können." Und Clive James schließlich lobt Roman Polanskis Film "Der Pianist" als das Werk eines Genies - und zwar auf ganzer Linie.
Nur im Print: Edward N. Luttwaks "Machine-gun memories".
Espresso (Italien), 31.01.2003
 Andere Völker, andere Sitten: Umberto Eco gibt in seiner Bustina den Staatsoberhäuptern im Allgemeinen und Bush und Berlusconi im Besonderen einen Crashkurs in den grundverschiedenen kulturellen Anthropologien Italiens und den USA. Hintergrund ist der beiläufige Ausspruch Berlusconis, Amerika habe Italiens volle Unterstützung. Das Problem ist nun, dass Bush das wirklich glaubt, schreibt Eco, und zwar wörtlich. Denn die Amerikaner hätten schon seit jeher die Wahrheit als heilig angesehen und fest an sie geglaubt. "Nun ist es keineswegs, so, dass Bush nicht zu lügen wüsste wenn er zu seinen Bürgern spricht: aber das ist Massenkommunikation, den Prinzipien der Öffentlichkeit unterworfen, und es ist okay in der Öffentlichkeit zu lügen. Bei vertraulichen Treffen oder vor einer Autorität dagegen nicht. Was er nicht weiß ist, dass wenn wir sagen "Ruf mich an, damit wir uns wiedersehen" oder "Wenn Du mal wieder vorbeikommst, schau doch zum Essen rein", wir keinerlei Interesse daran haben, den Betreffenden wiederzusehen. Berlusconi nun hat ihm etwas versprochen, und er hat wirklich geglaubt, das er es ernst meinte, während unser Präsident solche Worte eher als ziemlich flüchtig ansieht."
Andere Völker, andere Sitten: Umberto Eco gibt in seiner Bustina den Staatsoberhäuptern im Allgemeinen und Bush und Berlusconi im Besonderen einen Crashkurs in den grundverschiedenen kulturellen Anthropologien Italiens und den USA. Hintergrund ist der beiläufige Ausspruch Berlusconis, Amerika habe Italiens volle Unterstützung. Das Problem ist nun, dass Bush das wirklich glaubt, schreibt Eco, und zwar wörtlich. Denn die Amerikaner hätten schon seit jeher die Wahrheit als heilig angesehen und fest an sie geglaubt. "Nun ist es keineswegs, so, dass Bush nicht zu lügen wüsste wenn er zu seinen Bürgern spricht: aber das ist Massenkommunikation, den Prinzipien der Öffentlichkeit unterworfen, und es ist okay in der Öffentlichkeit zu lügen. Bei vertraulichen Treffen oder vor einer Autorität dagegen nicht. Was er nicht weiß ist, dass wenn wir sagen "Ruf mich an, damit wir uns wiedersehen" oder "Wenn Du mal wieder vorbeikommst, schau doch zum Essen rein", wir keinerlei Interesse daran haben, den Betreffenden wiederzusehen. Berlusconi nun hat ihm etwas versprochen, und er hat wirklich geglaubt, das er es ernst meinte, während unser Präsident solche Worte eher als ziemlich flüchtig ansieht."Nur in der Printausgabe ist Andre Glucksmanns Kommentar "Nennt mich Kim, den großen Führer" zu lesen. Ebenso wie Renata Pisus zumindest groß klingende Reportage "Tokyo kolossal".
Express (Frankreich), 30.01.2003
 Der Express bringt in dieser Ausgabe ein langes Interview mit dem Fotografen und Filmemacher Raymond Depardon anlässlich seines neuen Films "Un homme sans l?Occident", der (mal wieder) in der Sahara spielt. Er verlangt vom Zuschauer vor allem eines: Zeit. "Natürlich ist das ganz gegenläufig zu dem, was man heute macht. Man braucht Zeit, um meine Fotos und meine Filme anzusehen. Paradoxerweise bin ich jemand, der immer an eine Erzählung gebunden ist: meine Fotos müssen für mich mit einer Geschichte verknüpft oder von einem Text begleitet sein. Roland Barthes sagte, dass die erklärenden Worte, die unter einem Bild stehen, nur eine Art Verankerung des Bildes sind, das die eigentliche Erzählung enthält. Diese Idee hat mir schon immer gefallen."
Der Express bringt in dieser Ausgabe ein langes Interview mit dem Fotografen und Filmemacher Raymond Depardon anlässlich seines neuen Films "Un homme sans l?Occident", der (mal wieder) in der Sahara spielt. Er verlangt vom Zuschauer vor allem eines: Zeit. "Natürlich ist das ganz gegenläufig zu dem, was man heute macht. Man braucht Zeit, um meine Fotos und meine Filme anzusehen. Paradoxerweise bin ich jemand, der immer an eine Erzählung gebunden ist: meine Fotos müssen für mich mit einer Geschichte verknüpft oder von einem Text begleitet sein. Roland Barthes sagte, dass die erklärenden Worte, die unter einem Bild stehen, nur eine Art Verankerung des Bildes sind, das die eigentliche Erzählung enthält. Diese Idee hat mir schon immer gefallen." In Frankreich hat man es als Soziologe zwischen so vielen Theorien wie beispielsweise denen von Alain Tourraine, Pierre Bourdieu oder Jean Baudrillard nicht ganz einfach. Eric Conan hat sich trotzdem aufgemacht und einen Soziologen gefunden, der noch an die Kraft dieser wissenschaftlichen Disziplin glaubt: Raymond Boudon. Vor den Präsidentschaftswahlen hat er mit einer Studie Aufsehen erregt. Sie zeigte, dass politische Irrtümer auf den starken Einfluss der Medien zurückzuführen sind, die die öffentliche Meinungsbildung beeinflussen. Nicht zuletzt deshalb gilt Boudons Werk in Frankreich als "lieu essentiel de la democratie". Einen Auszug aus einem seiner Bücher lesen Sie hier.
Weitere Artikel in der Bücherschau: Claro begibt sich in seinem neuen Roman "La chair electrique" auf die Spuren der Geschichte des elektrischen Stuhls. Einen Auszug lesen Sie hier. Vergleichbar mit einem Schluck Wodka ist der dritte Teil einer russisch-französischen Trilogie mit dem Titel "La terre et le ciel de Jacques Dorme" von Andrei Makine, findet Thierry Gandillot. Na dann Prost! Einen Auszug finden Sie hier.
Folio (Schweiz), 03.02.2003
 Vom Kompostklo zum Schweineplaneten: das NZZ-Folio macht einen Rundgang durch die bunte Haushaltswelt.
Vom Kompostklo zum Schweineplaneten: das NZZ-Folio macht einen Rundgang durch die bunte Haushaltswelt.Prostetnik Vogon Jeltz stammt nach eigener Aussage vom "Schweineplaneten" und verteidigt die Chaoten dieser Welt mit einem Manifest, das sich gewaschen hat (oder doch nicht?). Denn "leider ist diese Welt von den Ordentlichen beherrscht. (Selten hört man: 'Schlimm, diese geputzte Küche.') Wer unordentlich ist, ist in Opposition." Und so versorgt PVJ seine "Schweinebrüder" mit dem theoretischen Fundament zur Rebellion gegen den "Terror" der Ordnung, die nichts anderes als eine Spielart der Unmenschlichkeit ist: "Tatsächlich sind etwa schicke Lofts wunderbare Orte, sich steif und unwohl zu fühlen: Im Vergleich mit dem Interieur ist der Besucher ein Schandfleck. Was für ein Unterschied zu einer unaufgeräumten Küche: Hier strahlen noch die hässlichsten Gäste!"
Michael Marti hat sich den Geschlechterkampf auf dem Haushaltsschlachtfeld genauer angesehen. Was dabei herauskommt, ist so sehr in Einklang mit dem Klischee der Hausfrau und des Heimwerkers, dass man sich nur wundern kann: "Steigen die Männer in die Niederungen der Weiblichkeit hinab und wischen den Boden, packen die Wäsche in die Maschine, räumen die Wohnung auf, so tun sie es meistens in der Art eines Hilfsarbeiters: auf Geheiss, unter Anleitung und Aufsicht der Frau. Nur im Bereich 'handwerkliche und administrative Tätigkeiten' entwickeln die Herren Eigenverantwortung und leisten mehr als ihre Partnerinnen: Glühbirnen auswechseln, Rasen mähen, die Steuererklärung ausfüllen, das sind Herausforderungen, die der Durchschnittsmann als seiner würdig erachtet. Auch beliebt ist der Großeinkauf am Wochenende, besonders wenn das Auto benützt werden kann." Und auch wenn die (oft berufstätige) Frau noch den Großteil des Haushalts erledigt, gelobt fürs Schrubben wird sie eher selten, was dann zum Beispiel so klingt: "Ich habe Mühe, eine Akademikerin dafür zu loben, dass sie auf den Knien den Badezimmerboden putzt." Da hilft nur üben, üben, üben!
Weitere Artikel: Daniele Muscionico war auf exotischer Haushaltstour: bei der Pfarreihaushälterin Theresia Chin, in einem Männerhaushalt und in einem traditionell jüdischen Haushalt. Ursula von Arx ist zu Gast in einem umweltbewussten Haushalt. Isolde Schaad hat die Haushaltsgeräte bespitzelt und schreibt über deren "heimliches Treiben". Lilli Binzegger erzählt, wie der Haushaltsunterricht die Emanzipation erst so richtig zum Kochen brachte. Kaspar Meuli hat die kleinen Heinzelmännchen des Haushalts überrascht: die Reinigungsmittel. Da hat jemand den Begriff "Ironman" nicht verstanden: Jetzt gibt es auch Bügeln als Extremsportart, berichtet Andreas Dietrich.
Und schließlich bringt das NZZ-Folio noch ein paar Fakten auf den Tisch, unter anderem dass die Qualifikationsanforderungen nach arbeitspsychologischen Kriterien an eine Hausfrau bei 618 liegen (auf einer Skala bis 11000), an einen Polizisten allerdings nur bei 471.












