Magazinrundschau
Die Magazinrundschau
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
10.10.2006. Vanity Fair spürt dem Massaker von Haditha nach. Al-Sharq al-Awsat staunt, dass muslimische, intellektuelle Frauen das Bild des Islam in Amerika bestimmen. Outlook India pfeift auf die Tarnkappe der Fiktion. Der Spiegel weiß, was Putin in Deutschland einkaufen will. In Semana steht Orhan Pamuk zu seiner Bürgerlichkeit. du widmet sich Rebecca Horn. Cui prodest - wem nützt es, fragt die Gazeta Wyborcza nach dem Mord an Anna Politkowskaja. In der Weltwoche erklärt Lorenzo de Medici, warum es in Ordnung geht, dass sein Geschlecht ausstirbt. Die New York Times spielt Spore.
Vanity Fair | Times Literary Supplement | Foglio | Weltwoche | Point | New York Times | al-Sharq al-Awsat | Outlook India | Spiegel | Semana | DU | New Yorker | Polityka | Gazeta Wyborcza
Vanity Fair (USA), 09.10.2006
 In einer mindestens zwanzigseitigen Reportage spürt William Langewiesche dem Massaker von Haditha nach, bei dem die Kilo-Company der Marines 24 Iraker, darunter Frauen, Greise und Kleinkinder umgebracht haben - als Vergeltung für einen Anschlag auf ihre Patrouille. Das Pressecorps der Marines hatte bereits begonnen, den Vorfall zu vertuschen, bevor es vom zuständigen Commander Lucas McConnell den Bericht hatte. "Einen Monat später sah ein Reporter im Bagdader Büro des Time Magazines, Tim McGirk, ein grauenvolles Video, das erkennen ließ, dass Menschen in ihren Häusern erschossen und getötet worden waren. Angesichts der Natur dieses Krieges und seines täglichen Horrors hätte McGirk von dem Video nicht überrascht sein sollen, vor allem wenn er den Bericht des Captain McConnell gekannt hätte. Aber nach der bloßen Pressemeldung über eine hochgegangene Landmine war offensichtlich, dass etwas an der offiziellen Darstellung sehr falsch war. McGirks erste Nachforschungen beim Marine Corps wurden mit einer E-Mail abgebürstet, die ihn beschuldigte, auf die Propaganda der Aufständischen hereinzufallen, und ihm implizit unterstellte, in Zeiten des Krieges dem Feind in die Hände zu spielen. Wer immer die E-Mail schrieb, war eine Nummer zu klein für seinen Job. Schlechte Publicity hilft tatsächlich dem Aufstand, aber es ist das Töten von Unbeteiligten, das richtig sticht. Irak ist ein kleines Land mit starken Familienbindungen. Nach drei Jahren Krieg brauchen die Einheimischen für das Zählen der Opfer kein Time Magazine. Es waren eher die Amerikaner zu Hause, die Hilfe brauchten - ein klein wenig Einblick in das, was diesen Krieg stetig schlimmer macht."
In einer mindestens zwanzigseitigen Reportage spürt William Langewiesche dem Massaker von Haditha nach, bei dem die Kilo-Company der Marines 24 Iraker, darunter Frauen, Greise und Kleinkinder umgebracht haben - als Vergeltung für einen Anschlag auf ihre Patrouille. Das Pressecorps der Marines hatte bereits begonnen, den Vorfall zu vertuschen, bevor es vom zuständigen Commander Lucas McConnell den Bericht hatte. "Einen Monat später sah ein Reporter im Bagdader Büro des Time Magazines, Tim McGirk, ein grauenvolles Video, das erkennen ließ, dass Menschen in ihren Häusern erschossen und getötet worden waren. Angesichts der Natur dieses Krieges und seines täglichen Horrors hätte McGirk von dem Video nicht überrascht sein sollen, vor allem wenn er den Bericht des Captain McConnell gekannt hätte. Aber nach der bloßen Pressemeldung über eine hochgegangene Landmine war offensichtlich, dass etwas an der offiziellen Darstellung sehr falsch war. McGirks erste Nachforschungen beim Marine Corps wurden mit einer E-Mail abgebürstet, die ihn beschuldigte, auf die Propaganda der Aufständischen hereinzufallen, und ihm implizit unterstellte, in Zeiten des Krieges dem Feind in die Hände zu spielen. Wer immer die E-Mail schrieb, war eine Nummer zu klein für seinen Job. Schlechte Publicity hilft tatsächlich dem Aufstand, aber es ist das Töten von Unbeteiligten, das richtig sticht. Irak ist ein kleines Land mit starken Familienbindungen. Nach drei Jahren Krieg brauchen die Einheimischen für das Zählen der Opfer kein Time Magazine. Es waren eher die Amerikaner zu Hause, die Hilfe brauchten - ein klein wenig Einblick in das, was diesen Krieg stetig schlimmer macht." al-Sharq al-Awsat (Saudi Arabien / Vereinigtes Königreich), 04.10.2006
Al-Sharq al-Awsat ist die größte überregionale arabische Tageszeitung. Sie erscheint in London, befindet sich aber im Besitz eines saudischen Prinzen. Es sind die Kommentare, die den guten Ruf der Zeitung begründen. Einmal wöchentlich erscheint die Beilage "Kulturforum", die sich nicht nur Themen aus der arabischen Welt widmet.
Muhammad Ali Salih berichtet von dem Wirbel, den die Wahl der in Kanada geborenen Islamwissenschaftlerin Ingrid Mattson an die Spitze der Islamic Society for North America, der größten muslimischen Vereinigung in den USA, ausgelöst hat. Mattson, Irshad Manji, Asra Nomani, Ayaan Hirsi Ali - muslimische Frauen stehen in den USA immer mehr in der Öffentlichkeit: "Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes rückt die Rolle der muslimischen, intellektuellen Frau ins Licht der Öffentlichkeit. Welche Fragen werden von ihr gestellt, und welche Fragen werden durch sie aufgeworfen? Viele von ihnen sind bekannt und stehen im Licht der Medien, beteiligen sich an geistig-religiösen Auseinandersetzungen, denen man sich kaum mehr verschließen kann. Just zu diesem sensiblen Zeitpunkt der Geschichte Amerikas und der Welt, zu dem immer häufiger über die Fähigkeit des Islam, mit der Moderne zu koexistieren, diskutiert wird, wird der 'Amerika-Islam' zu einem öffentlichen Thema - ganz ähnlich wie in Europa, wo in den vergangenen Jahren heftig über den sogenannten 'Euro-Islam' gestritten wurde. Die Frauen allerdings - und die amerikanischen muslimischen Akademikerinnen im Besonderen - stellen diesmal den Löwenanteil an der Debatte." (Es gibt im Netz einige interessante Artikel von und über Ingrid Mattson. Auf der Website Why Islam erzählt sie, wie sie Muslimin wurde. Hier lange Auszüge aus einem Interview mit ihr auf PBS. Hier ein längeres Porträt im Christian Science Monitor.)
Weitere Artikel (alles auf Arabisch) beschäftigen sich mit dem schwedischen Lyriker Tomas Tranströmer und mit dem deutschen Theologen Hans Küng. Ali al-Azir beschreibt die unterschiedlichen Gestalten - von surrealistisch tätowiert bis verschleiert - die einem bei einer Busfahrt vom schicken Beiruter Stadtteil Hamra in die südlichen Vororte gegenübersitzen können. Und Al-Khayr Shawar fragt sich, warum der Erfolg algerischer Schriftstellerinnen oft nur von kurzer Dauer ist.
Muhammad Ali Salih berichtet von dem Wirbel, den die Wahl der in Kanada geborenen Islamwissenschaftlerin Ingrid Mattson an die Spitze der Islamic Society for North America, der größten muslimischen Vereinigung in den USA, ausgelöst hat. Mattson, Irshad Manji, Asra Nomani, Ayaan Hirsi Ali - muslimische Frauen stehen in den USA immer mehr in der Öffentlichkeit: "Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes rückt die Rolle der muslimischen, intellektuellen Frau ins Licht der Öffentlichkeit. Welche Fragen werden von ihr gestellt, und welche Fragen werden durch sie aufgeworfen? Viele von ihnen sind bekannt und stehen im Licht der Medien, beteiligen sich an geistig-religiösen Auseinandersetzungen, denen man sich kaum mehr verschließen kann. Just zu diesem sensiblen Zeitpunkt der Geschichte Amerikas und der Welt, zu dem immer häufiger über die Fähigkeit des Islam, mit der Moderne zu koexistieren, diskutiert wird, wird der 'Amerika-Islam' zu einem öffentlichen Thema - ganz ähnlich wie in Europa, wo in den vergangenen Jahren heftig über den sogenannten 'Euro-Islam' gestritten wurde. Die Frauen allerdings - und die amerikanischen muslimischen Akademikerinnen im Besonderen - stellen diesmal den Löwenanteil an der Debatte." (Es gibt im Netz einige interessante Artikel von und über Ingrid Mattson. Auf der Website Why Islam erzählt sie, wie sie Muslimin wurde. Hier lange Auszüge aus einem Interview mit ihr auf PBS. Hier ein längeres Porträt im Christian Science Monitor.)
Weitere Artikel (alles auf Arabisch) beschäftigen sich mit dem schwedischen Lyriker Tomas Tranströmer und mit dem deutschen Theologen Hans Küng. Ali al-Azir beschreibt die unterschiedlichen Gestalten - von surrealistisch tätowiert bis verschleiert - die einem bei einer Busfahrt vom schicken Beiruter Stadtteil Hamra in die südlichen Vororte gegenübersitzen können. Und Al-Khayr Shawar fragt sich, warum der Erfolg algerischer Schriftstellerinnen oft nur von kurzer Dauer ist.
Outlook India (Indien), 16.10.2006
 Elf Jahre Outlook India. Lauter Rückblicke zieren das Magazin, so auch literarisch: Sheela Reddy stellt fest, es war die Dekade der Sachbücher: "Die moderne Welt zu interpretieren ist nicht zuletzt ein höchst kreatives Geschäft, und wer könnte das besser als Rushdie oder Roy? Vielleicht können wir uns nicht mehr den Luxus erlauben, die sieben oder zehn Jahre zu warten, die Schriftsteller brauchen, ihre Parallelwelt und deren Charaktere zu schaffen - wir wollen sie jetzt, auch um den Preis der Romanhandlung und Romanwelt. .... Vielleicht liegt es am 9. September, oder die Zeit dafür war einfach gekommen, aber mit einem Mal haben die Schriftsteller ihre Geschichten vom Roman befreit. Erzählen, und selbst gutes Erzählen, braucht nicht länger die Tarnkappe der Fiktion." Autoren, die auf diese "Tarnkappe" verzichtet haben, sind laut Reddy Roy und Vikram Seth. Sollte sich deshalb nicht auch der Booker-Preis für Sachbücher öffnen, fragt sie.
Elf Jahre Outlook India. Lauter Rückblicke zieren das Magazin, so auch literarisch: Sheela Reddy stellt fest, es war die Dekade der Sachbücher: "Die moderne Welt zu interpretieren ist nicht zuletzt ein höchst kreatives Geschäft, und wer könnte das besser als Rushdie oder Roy? Vielleicht können wir uns nicht mehr den Luxus erlauben, die sieben oder zehn Jahre zu warten, die Schriftsteller brauchen, ihre Parallelwelt und deren Charaktere zu schaffen - wir wollen sie jetzt, auch um den Preis der Romanhandlung und Romanwelt. .... Vielleicht liegt es am 9. September, oder die Zeit dafür war einfach gekommen, aber mit einem Mal haben die Schriftsteller ihre Geschichten vom Roman befreit. Erzählen, und selbst gutes Erzählen, braucht nicht länger die Tarnkappe der Fiktion." Autoren, die auf diese "Tarnkappe" verzichtet haben, sind laut Reddy Roy und Vikram Seth. Sollte sich deshalb nicht auch der Booker-Preis für Sachbücher öffnen, fragt sie.Außerdem: Khushwant Singh bleibt schamhaft und erstellt seine persönliche Belletristik-Bestenliste der vergangenen elf Jahre. Tabish Khair porträtiert seinen Favoriten: Amitav Gosh. Und Aniruddha Bahal überblickt den Zustand der Presse und fordert mehr investigativen Journalismus (z. B. gegen Muftis, die gegen Bares Fatwas in die Welt setzen).
Spiegel (Deutschland), 09.10.2006
 Ein gruseliges Bild zeichnet der Spiegel vom bevorstehenden Besuch Wladimir Putins in Deutschland. "Wenn Putin am Dienstag dieser Woche zum Staatsbesuch in Deutschland eintrifft, tritt er nicht mehr als Bittsteller, sondern als Investor auf. Längst geht es nicht mehr ausschließlich darum, ob sich deutsche Großunternehmen wie E.on oder BASF an der Ausbeutung russischer Gasfelder beteiligen können. Jetzt weht der Wind aus einer anderen Richtung. Bald schon könnten Haushalte in Nordrhein-Westfalen oder Bayern ihre Gas- und Ölrechnungen an russische Firmen überweisen, die darauf drängen, sich in Deutschland endlich einkaufen zu können... Ganz oben auf der Einkaufsliste aber stehen deutsche Firmen. Wenn Putin zum Staatsbesuch nach Dresden und München einschwebt, wird er der Kanzlerin erneut seine Lieblingsidee vortragen: Hiesige Auto-, Chemie- oder Maschinenbaukonzerne dürfen sich stärker auf dem russischen Markt engagieren. Im Gegenzug beteiligt sich die Putin AG an deutschen Elektrizitätswerken, Autozulieferern oder Flugzeugbauern."
Ein gruseliges Bild zeichnet der Spiegel vom bevorstehenden Besuch Wladimir Putins in Deutschland. "Wenn Putin am Dienstag dieser Woche zum Staatsbesuch in Deutschland eintrifft, tritt er nicht mehr als Bittsteller, sondern als Investor auf. Längst geht es nicht mehr ausschließlich darum, ob sich deutsche Großunternehmen wie E.on oder BASF an der Ausbeutung russischer Gasfelder beteiligen können. Jetzt weht der Wind aus einer anderen Richtung. Bald schon könnten Haushalte in Nordrhein-Westfalen oder Bayern ihre Gas- und Ölrechnungen an russische Firmen überweisen, die darauf drängen, sich in Deutschland endlich einkaufen zu können... Ganz oben auf der Einkaufsliste aber stehen deutsche Firmen. Wenn Putin zum Staatsbesuch nach Dresden und München einschwebt, wird er der Kanzlerin erneut seine Lieblingsidee vortragen: Hiesige Auto-, Chemie- oder Maschinenbaukonzerne dürfen sich stärker auf dem russischen Markt engagieren. Im Gegenzug beteiligt sich die Putin AG an deutschen Elektrizitätswerken, Autozulieferern oder Flugzeugbauern."Weiteres: Der Titel greift Bob Woodwards neues Buch "State of Denial" (hier ein Auszug) auf und kolportiert allerhand Lügen und Halbwahrheiten, mit denen Washington die Lage im Irak schönredet. Und Markus Brauck berichtet, dass die 1414, unter der Gelegenheits-Paparazzis ihre Fotos an die Bild-Zeitung schicken können, vor allem die freien Fotografen aufbringt: "Für ein bundesweit veröffentlichtes Foto zahlt die Zeitung den Fotografen oft weniger als 150 Euro. Die Leser kriegen 500."
Semana (Kolumbien), 07.10.2006
 Der zur Zeit in Berlin lebende kolumbianische Schriftsteller Hector Abad Faciolince übt heftige Kritik an der Entscheidung des amerikanischen Senats, eine Mauer zwischen Mexiko und den USA zu errichten, um illegale Einwanderer abzuhalten. "Niemand hat die deutsche Mauer einst so heftig kritisiert wie die USA. Sie führten das stets als Beweis für das Scheitern der kommunistischen Gesellschaften an. Heute lässt George W. Bush, der schlechteste Präsident, den die USA je hatten, eine sehr viel längere Mauer errichten. Freilich bezeichnet man sie auf der Seite der USA nicht als 'wall' (Mauer), sondern mit dem Euphemismus 'fence' (Zaun). Angeblich würden die USA sich ohne diesen 'Zaun' mit Immigranten füllen, während in Mexiko nicht ein Mexikaner übrig bliebe - wann begreifen die Gringos, dass keineswegs alle Lateinamerikaner in den USA leben wollen? Wann merken sie, dass ihre Vorstädte zu neunzig Prozent nichts anderes sind als der Vorhof der Hölle?"
Der zur Zeit in Berlin lebende kolumbianische Schriftsteller Hector Abad Faciolince übt heftige Kritik an der Entscheidung des amerikanischen Senats, eine Mauer zwischen Mexiko und den USA zu errichten, um illegale Einwanderer abzuhalten. "Niemand hat die deutsche Mauer einst so heftig kritisiert wie die USA. Sie führten das stets als Beweis für das Scheitern der kommunistischen Gesellschaften an. Heute lässt George W. Bush, der schlechteste Präsident, den die USA je hatten, eine sehr viel längere Mauer errichten. Freilich bezeichnet man sie auf der Seite der USA nicht als 'wall' (Mauer), sondern mit dem Euphemismus 'fence' (Zaun). Angeblich würden die USA sich ohne diesen 'Zaun' mit Immigranten füllen, während in Mexiko nicht ein Mexikaner übrig bliebe - wann begreifen die Gringos, dass keineswegs alle Lateinamerikaner in den USA leben wollen? Wann merken sie, dass ihre Vorstädte zu neunzig Prozent nichts anderes sind als der Vorhof der Hölle?"Und der kolumbianische Schriftsteller Juan Gabriel Vasquez interviewt den türkischen Schriftsteller Orhan Pamuk: "Während des Prozesses wegen Ihrer Äußerungen zum Völkermord an den Armeniern spotteten Ihre Freunde, wenn Sie ins Gefängnis kämen, würden Sie endlich zu einem richtigen türkischen Schriftsteller." - "Das ist die traditionelle Sichtweise hierzulande. Man betrachtete mich bis dahin als einen bürgerlichen Schriftsteller, der abgehobene Großstadtgeschichten schreibt. Ich fragte zurück, ob es nicht besser wäre, der erste türkische Schriftsteller zu sein, der die Politik kritisiert, ohne dafür ins Gefängnis zu müssen."
DU (Schweiz), 01.10.2006
 Dieses du-Heft ist ganz der Künstlerin Rebecca Horn gewidmet. Im Interview beschreibt sie eine Arbeit, die sich mit dem Tod beschäftigt. "Um die Piazza del Plebiscito liegen die Katakomben von Neapel - die Menschen leben über den Gräbern. Die Neapolitaner betreiben einen richtigen Kult mit den Schädeln, die sie aus den Katakomben stehlen. Alle möglichen Dinge werden mit ihnen ausgehandelt - die Neapolitaner nennen sie Capuzzelle ('kleine Köpfchen'): Sie sollen bewirken, dass einer gut nach Hause kommt oder dass einer sein Abitur besteht, dass der Ehemann zurückkehrt und und und. Selbst ein Lottospiel mit Schädeln gibt es. Zuerst habe ich in Neapel den Friedhof 'La Fontanelle' besucht. Es sind Katakomben. Dieser Ort kam mir vor wie eine immense Bibliothek. Da gibt es die Armknochen und die Beinknochen, den Kopf - den Mittelteil des Körpers bewahren sie nicht auf -, und diese säuberlich sortierten Gebeine lagern auf Gestellen in riesigen Hallen. Da dachte ich bei mir, warum sollte man nicht einige dieser Seelen sozusagen befreien? Ich habe Schädel in Eisen gießen lassen, die dann wie kleine Gelehrte aus den Pflastersteinen herausschauten. Sie haben ihre ganz eigene Konversation betrieben."
Dieses du-Heft ist ganz der Künstlerin Rebecca Horn gewidmet. Im Interview beschreibt sie eine Arbeit, die sich mit dem Tod beschäftigt. "Um die Piazza del Plebiscito liegen die Katakomben von Neapel - die Menschen leben über den Gräbern. Die Neapolitaner betreiben einen richtigen Kult mit den Schädeln, die sie aus den Katakomben stehlen. Alle möglichen Dinge werden mit ihnen ausgehandelt - die Neapolitaner nennen sie Capuzzelle ('kleine Köpfchen'): Sie sollen bewirken, dass einer gut nach Hause kommt oder dass einer sein Abitur besteht, dass der Ehemann zurückkehrt und und und. Selbst ein Lottospiel mit Schädeln gibt es. Zuerst habe ich in Neapel den Friedhof 'La Fontanelle' besucht. Es sind Katakomben. Dieser Ort kam mir vor wie eine immense Bibliothek. Da gibt es die Armknochen und die Beinknochen, den Kopf - den Mittelteil des Körpers bewahren sie nicht auf -, und diese säuberlich sortierten Gebeine lagern auf Gestellen in riesigen Hallen. Da dachte ich bei mir, warum sollte man nicht einige dieser Seelen sozusagen befreien? Ich habe Schädel in Eisen gießen lassen, die dann wie kleine Gelehrte aus den Pflastersteinen herausschauten. Sie haben ihre ganz eigene Konversation betrieben."Außerdem online: Eine Einführung in Rebecca Horns Werk von Hans-Joachim Müller. Und Martin Mosebach erzählt, wie er Horn bei den Dreharbeiten zu ihrem Film "Buster's Bedroom" kennenlernte. Alle Artikel untereinander finden Sie hier. Im Heft ist außerdem ein Zeichnungszyklus von Horn abgedruckt, die "Landkarten der Seelen". Eine große Ausstellung von Rebecca Horn ist zur Zeit im Berliner Martin-Gropius-Bau zu sehen.
New Yorker (USA), 16.10.2006
 John Cassidy untersucht, ob der bisher als gestandener Konservativer geltende amerikanische Medienmogul Rupert Murdoch im Präsidentschaftswahljahr 2008 auf die linke Seite überschwenken will. Anzeichen dafür gibt es: Im Juli hat er "zum Entsetzen seiner rechten Verbündeten und liberalen Gegner gleichermaßen" ein Frühstück zur Mittelbeschaffung für die Kampagne zur Wiederwahl von Senatorin Hillary Rodham Clinton gegeben, das immerhin 60.000 Dollar einbrachte. Nun kocht die Gerüchteküche, ob er womöglich auch ihre Präsidentschaftskandidatur 2008 unterstützen will. Doch Murdoch lässt "die Leute gerne im Unklaren über seine Absichten". Bei einem Treffen mit Cassidy antwortet er auf die Frage, ob Hillary eine gute Präsidentin würde: "Ich weiß nicht. Sie ist sehr intelligent. Und ich glaube, sie wäre entscheidungsfreudig. Sie ist vielleicht auch entscheidungsfreudiger als Bill es gewesen ist. Wenn man sich ihre Geschichte ansieht, ist sie wohl um einiges liberaler als ich, aber ich weiß es nicht. Wir werden's sehen, wenn sie es schafft."
John Cassidy untersucht, ob der bisher als gestandener Konservativer geltende amerikanische Medienmogul Rupert Murdoch im Präsidentschaftswahljahr 2008 auf die linke Seite überschwenken will. Anzeichen dafür gibt es: Im Juli hat er "zum Entsetzen seiner rechten Verbündeten und liberalen Gegner gleichermaßen" ein Frühstück zur Mittelbeschaffung für die Kampagne zur Wiederwahl von Senatorin Hillary Rodham Clinton gegeben, das immerhin 60.000 Dollar einbrachte. Nun kocht die Gerüchteküche, ob er womöglich auch ihre Präsidentschaftskandidatur 2008 unterstützen will. Doch Murdoch lässt "die Leute gerne im Unklaren über seine Absichten". Bei einem Treffen mit Cassidy antwortet er auf die Frage, ob Hillary eine gute Präsidentin würde: "Ich weiß nicht. Sie ist sehr intelligent. Und ich glaube, sie wäre entscheidungsfreudig. Sie ist vielleicht auch entscheidungsfreudiger als Bill es gewesen ist. Wenn man sich ihre Geschichte ansieht, ist sie wohl um einiges liberaler als ich, aber ich weiß es nicht. Wir werden's sehen, wenn sie es schafft."Weitere Artikel: George Packer erklärt in einem Kommentar, warum er es für einen "strategischen Fehler" hält, Tariq Ramadan ein US-Visum zu verweigern. Ben McGrath beschreibt diversen Unsinn, der mit Fake-Videos im Internet-Videoportal YouTube getrieben wird und dem Unternehmen allmählich Sorgen um seinen Ruf bereitet.
Thomas Mallon porträtiert die Schriftstellerin und Kommunistin Jessica Mitford, deren Briefe in der Sammlung "Decca" (Knopf) erschienen sind. David Denby bespricht Todd Fields Film "Little Children" mit Kate Winslet und Martin Scorseses Thriller "The Departed". Zu lesen ist außerdem die Erzählung "The Photograph" von Roddy Doyle.
Nur im Print: ein Essay von Milan Kundera zur Frage "Was ist ein Romanautor?", eine Reportage über eine Baumerklimmung, ein Bericht über einen Ausbrecherkönig und Lyrik.
Polityka (Polen), 07.10.2006
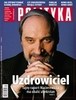 Für Aleksander Kaczorowski ist die Entscheidung, der jungen Autorin Dorota Maslowska den wichtigsten Literaturpreis Polens, den Nike Preis zu verleihen, gewagt, aber zukunftsweisend. "Bisher belohnte die Jury zu oft eher das Lebenswerk von Autoren, als tatsächlich das Buch des Jahres. Zudem hat der hoch dotierte Preis Konkurrenz in Polen bekommen, zum Beispiel durch den Mitteleuropäischen Literaturpreis Angelus, und es bläst ihm politischer Gegenwind ins Gesicht: zum ersten Mal seit 10 Jahren hat das staatliche Fernsehen auf eine Live-Übertragung der Preisverleihung verzichtet." Dennoch sei der Nike Preis ein großer Erfolg. Als er Mitte der Neunziger geschaffen wurde, galt Literatur als ein Hobby von wenigen. Jetzt verkaufen einige der Nominierten bis zu 100.000 Exemplare ihrer Bücher, so Kaczorowski.
Für Aleksander Kaczorowski ist die Entscheidung, der jungen Autorin Dorota Maslowska den wichtigsten Literaturpreis Polens, den Nike Preis zu verleihen, gewagt, aber zukunftsweisend. "Bisher belohnte die Jury zu oft eher das Lebenswerk von Autoren, als tatsächlich das Buch des Jahres. Zudem hat der hoch dotierte Preis Konkurrenz in Polen bekommen, zum Beispiel durch den Mitteleuropäischen Literaturpreis Angelus, und es bläst ihm politischer Gegenwind ins Gesicht: zum ersten Mal seit 10 Jahren hat das staatliche Fernsehen auf eine Live-Übertragung der Preisverleihung verzichtet." Dennoch sei der Nike Preis ein großer Erfolg. Als er Mitte der Neunziger geschaffen wurde, galt Literatur als ein Hobby von wenigen. Jetzt verkaufen einige der Nominierten bis zu 100.000 Exemplare ihrer Bücher, so Kaczorowski. Gazeta Wyborcza (Polen), 07.10.2006
 "Im Militärjargon sagt man dazu 'Killed in action'. Der Journalist hat aber keine Waffe, er hat nur die Feder. Anna Politkowskaja ist nicht die erste, und nicht die letzte Vertreterin ihrer Zunft, die für ihr Streben nach Wahrheit mit dem Leben zahlen musste", kommentiert den Mord an der russischen Journalistin der Publizist Leopold Unger. "Politkowskaja war aber keine Journalistin wie alle anderen. Ihr Tod erinnert eher an die Ermordung von Galina Starowojtowaja, der Grande Dame der russischen Demokratie, 1998. Der Mord von damals und der von heute machen deutlich, dass politische Auseinandersetzungen in Russland mit Hilfe von Provokation und Terrorismus gelöst werden. Die Frage bleibt offen: cui prodest?"
"Im Militärjargon sagt man dazu 'Killed in action'. Der Journalist hat aber keine Waffe, er hat nur die Feder. Anna Politkowskaja ist nicht die erste, und nicht die letzte Vertreterin ihrer Zunft, die für ihr Streben nach Wahrheit mit dem Leben zahlen musste", kommentiert den Mord an der russischen Journalistin der Publizist Leopold Unger. "Politkowskaja war aber keine Journalistin wie alle anderen. Ihr Tod erinnert eher an die Ermordung von Galina Starowojtowaja, der Grande Dame der russischen Demokratie, 1998. Der Mord von damals und der von heute machen deutlich, dass politische Auseinandersetzungen in Russland mit Hilfe von Provokation und Terrorismus gelöst werden. Die Frage bleibt offen: cui prodest?"Der "amerikanische Dissident Nr. 1", Noam Chomsky, verrät im Interview mit der polnischen Tageszeitung, warum er die USA für den führenden Terroristen-Staat in der Welt hält. "Amerika erkennt den Internationalen Strafgerichtshof nicht an; es gewährt verurteilten Terroristen Unterschlupf; es führt Invasionen und Wirtschaftskriege durch. Verglichen mit dem, was Lateinamerika in den letzten Jahrzehnten unter großen Einwirken der USA durchgemacht hat, war der Stalinismus in Polen nicht so schlimm." Es geht noch weiter: für Chomsky ist das Konzept der 'humanitären Intervention' ein Betrug, der schon von Hitler und Mussolini begangen wude. "Amerika ist nicht anders, vergessen Sie das Gerede vom Ausnahmecharakter. Jede Großmacht war immer eine Ausnahme auf die gleiche Art. Niemand mit gesundem Menschenverstand nimmt Deklarationen politischer Führer ernst."
Eigentlich entwickelt sich alles zum Besten, was deutsch-polnische Kontakte im Literaturbereich angeht, schreibt von der Frankfurter Buchmesse Konrad Godlewski. "Noch vor einigen Jahren schickten polnische Verleger ihre Bücher zum Ausstellen, heute haben über 20 einen eigenen Stand und weitere 50 präsentieren sich auf dem Stand des 'Buch-Instituts'. Zudem ist der deutschsprachige Markt der zweitwichtigste, was Übersetzungen aus der polnischen Sprache angeht." Aber die politischen Spannungen zwischen beiden Ländern können nicht ohne Einfluss auf die Kulturkontakte bleiben. Die Buchmesse wäre der beste Ort gewesen, um darüber zu diskutieren - leider war keine der zig Diskussionsrunden in Frankfurt diesem Thema gewidmet: Weder die deutsche noch die polnische Seite sind auf diese Idee gekommen.
Times Literary Supplement (UK), 07.10.2006
 Iain Elliot empfiehlt die Erinnerungen des britischen Botschafters Craig Murray (mehr hier) an seine Zeit in Usbekistan. Als Diplomat mit recht lockerem Lebenswandel und Unterstützer der demokratischen Opposition hatte er es sich ebenso mit dem Regime wie mit seinem Außenministerium verscherzt: "Einmal nahm er Simon Butt, den Chef des Eastern Departments, zu einem Treffen mit Dissidenten in Samarkand mit. Am nächsten Morgen fand ihr Gastgeber, Professor Mirsaidow, die Leiche seines 18-jährigen Enkels Avazow auf der Straße vor seinem Haus... Murray ist überzeugt, dass seine Schwierigkeiten mit dem Außenministerium daher rührten, dass die Amerikaner Präsident Islam Karimow als wertvollen Verbündeten im Kampf gegen den Terror ansahen, was es erforderlich machte ein Auge zuzudrücken, wenn es um den Terror gegen das eigene Volk ging. Im Gegenzug zur wirtschaftlichen und politischen Hilfe durften die USA die Karshi Airbase für ihre Operationen in Afghanistan nutzen. Die 'korrekte' Linie hieß daher, Karimow zu ermuntern, seine Menschenrechtsbilanz zu verbessern."
Iain Elliot empfiehlt die Erinnerungen des britischen Botschafters Craig Murray (mehr hier) an seine Zeit in Usbekistan. Als Diplomat mit recht lockerem Lebenswandel und Unterstützer der demokratischen Opposition hatte er es sich ebenso mit dem Regime wie mit seinem Außenministerium verscherzt: "Einmal nahm er Simon Butt, den Chef des Eastern Departments, zu einem Treffen mit Dissidenten in Samarkand mit. Am nächsten Morgen fand ihr Gastgeber, Professor Mirsaidow, die Leiche seines 18-jährigen Enkels Avazow auf der Straße vor seinem Haus... Murray ist überzeugt, dass seine Schwierigkeiten mit dem Außenministerium daher rührten, dass die Amerikaner Präsident Islam Karimow als wertvollen Verbündeten im Kampf gegen den Terror ansahen, was es erforderlich machte ein Auge zuzudrücken, wenn es um den Terror gegen das eigene Volk ging. Im Gegenzug zur wirtschaftlichen und politischen Hilfe durften die USA die Karshi Airbase für ihre Operationen in Afghanistan nutzen. Die 'korrekte' Linie hieß daher, Karimow zu ermuntern, seine Menschenrechtsbilanz zu verbessern."Weiteres: Andrew Motion plädiert dafür, die Original-Manuskripte von Schriftstellern aufzubewahren. Besprochen werden David Mattinglys Studie über die römische Besatzung Britanniens "Imperial Posession" und Richard Fords Roman "The Lay of the Land".
Foglio (Italien), 07.10.2006
Stefano di Michele betrachtet die Plakate, mit denen sich die politischen Parteien Italiens in den letzten Jahrzehnten beharkt haben. Ein Höhepunkt war die bleierne Zeit der Roten Brigaden in den Siebzigern. "Das wirksamste Plakat - ein auch optischer Bruch mit jeglicher Zweideutigkeit - der Pci (Kommunistische Partei Italiens) war das Foto eines Straßenpflasters mit dem mit Kreide gezeichneten Umriss eines Körpers und dem Barett eines Polizisten, der gleichsam aus dem Plakat hinaustrat und sich zum Betrachter umwandte: Sie schießen auf die Uniform und drinnen steckt ein Mensch. Sie schießen alle auf uns."
Nicht nur in den USA wird der Film- und Fernsehmarkt christlicher, beobachtet Maurizio Crippa, nennt aber für Italien selbst leider nur wenige Beispiele. "Wenn im vergangenen Jahr 'Karol' mit über 13 Millionen Zuschauern der meistgesehene Film war, besteht in diesem Jahr Mediaset auf die Quotenkrone und wird auf die 'Magierkönige' von Agostino Sacca mit einer weihnachtlichen 'Heiligen Familie' antworten, die durch die Präsenz von Alessandro Gassmann veredelt wird."
Giancarlo Dotto stellt den italienischen Boxer Primo Carnera vor, der als erster Muskelprotz im Kino Urvater aller Rambos und Conans war. Siegmund Ginzberg erzählt erst hier und dann hier von den Reisen Ibn Battutas, des arabischen Marco Polos.
Nicht nur in den USA wird der Film- und Fernsehmarkt christlicher, beobachtet Maurizio Crippa, nennt aber für Italien selbst leider nur wenige Beispiele. "Wenn im vergangenen Jahr 'Karol' mit über 13 Millionen Zuschauern der meistgesehene Film war, besteht in diesem Jahr Mediaset auf die Quotenkrone und wird auf die 'Magierkönige' von Agostino Sacca mit einer weihnachtlichen 'Heiligen Familie' antworten, die durch die Präsenz von Alessandro Gassmann veredelt wird."
Giancarlo Dotto stellt den italienischen Boxer Primo Carnera vor, der als erster Muskelprotz im Kino Urvater aller Rambos und Conans war. Siegmund Ginzberg erzählt erst hier und dann hier von den Reisen Ibn Battutas, des arabischen Marco Polos.
Weltwoche (Schweiz), 05.10.2006
 Lorenzo de Medici wird wahrscheinlich der letzte Sproß der großen italienischen Adels- und Mäzenatenfamilie sein. Der 55-Jährige erklärt Walter De Gregorio in einem mit Geschichte gespickten Interview, warum er das nicht bedauert. "Seit dem 12. Jahrhundert ist unsere Familie Teil der italienischen Geschichte, sie hat die europäische Kultur geprägt, die Menschen vom finsteren Mittelalter in die Aufklärung geführt. Es ist Zeit, abzutreten - mehr als achthundert Jahre sind genug." Unsterblich sei seine Familie sowieso schon. "Wahre Macht zeigt sich - das sage ich selbstverständlich ganz selbstlos -, wenn die Leute auch dann noch über einen reden, wenn man schon lange nichts mehr vollbracht hat. Die letzten fünfhundert Jahre haben die Medici nichts mehr erschaffen. Ich behaupte, dass man sich aber auch in den nächsten fünfhundert Jahren an uns erinnern wird."
Lorenzo de Medici wird wahrscheinlich der letzte Sproß der großen italienischen Adels- und Mäzenatenfamilie sein. Der 55-Jährige erklärt Walter De Gregorio in einem mit Geschichte gespickten Interview, warum er das nicht bedauert. "Seit dem 12. Jahrhundert ist unsere Familie Teil der italienischen Geschichte, sie hat die europäische Kultur geprägt, die Menschen vom finsteren Mittelalter in die Aufklärung geführt. Es ist Zeit, abzutreten - mehr als achthundert Jahre sind genug." Unsterblich sei seine Familie sowieso schon. "Wahre Macht zeigt sich - das sage ich selbstverständlich ganz selbstlos -, wenn die Leute auch dann noch über einen reden, wenn man schon lange nichts mehr vollbracht hat. Die letzten fünfhundert Jahre haben die Medici nichts mehr erschaffen. Ich behaupte, dass man sich aber auch in den nächsten fünfhundert Jahren an uns erinnern wird." Point (Frankreich), 05.10.2006
 In seinen Bloc-notes beschäftigt sich Bernard-Henri Levy heute mit dem Fall des französischen Gymnasiallehrers Robert Redeker, der sich wegen eines Artikels im Figaro mit islamistischen Todesdrohungen konfrontiert sieht. Für Levy gibt es hinsichtlich einer Reaktion keinerlei Zweifel: "Man diskutiert nicht mit einem Mann, der am Boden liegt, man hilft ihm auf... Ich pfeife darauf zu wissen, ob das, was Redeker gesagt hat, dumm oder besonnen war; ich will mich nicht fragen müssen, ob er ein guter oder schlechter Lehrer ist... Monsieur Redeker, über dessen Kopf seit seinem Text eine Art Fatwa schwebt, in Ländern, in denen die Menschrechte und die Rechte Voltaires gelten, verdient eine restlose Unterstützung, unbestritten und ohne Einschränkung." Für Levy zeigen Karikaturenstreit, der Eklat um die Papst-Rede und die vorauseilende Absetzung des "Idomeneo" in Berlin, dass "die geringste Schwäche in dieser Debatte, die geringste sprachliche oder gedankliche Reserve gegenüber dem unveräußerlichen Recht ... ein schreckliches Geschenk wäre, das man dem Gegner mitten in der gerade tobenden großen Schlacht macht".
In seinen Bloc-notes beschäftigt sich Bernard-Henri Levy heute mit dem Fall des französischen Gymnasiallehrers Robert Redeker, der sich wegen eines Artikels im Figaro mit islamistischen Todesdrohungen konfrontiert sieht. Für Levy gibt es hinsichtlich einer Reaktion keinerlei Zweifel: "Man diskutiert nicht mit einem Mann, der am Boden liegt, man hilft ihm auf... Ich pfeife darauf zu wissen, ob das, was Redeker gesagt hat, dumm oder besonnen war; ich will mich nicht fragen müssen, ob er ein guter oder schlechter Lehrer ist... Monsieur Redeker, über dessen Kopf seit seinem Text eine Art Fatwa schwebt, in Ländern, in denen die Menschrechte und die Rechte Voltaires gelten, verdient eine restlose Unterstützung, unbestritten und ohne Einschränkung." Für Levy zeigen Karikaturenstreit, der Eklat um die Papst-Rede und die vorauseilende Absetzung des "Idomeneo" in Berlin, dass "die geringste Schwäche in dieser Debatte, die geringste sprachliche oder gedankliche Reserve gegenüber dem unveräußerlichen Recht ... ein schreckliches Geschenk wäre, das man dem Gegner mitten in der gerade tobenden großen Schlacht macht".Zu lesen ist in Le Point außerdem ein Porträt des inzwischen 82jährigen Mittelalterexperten Jacques Le Goff, der mit einem Buch für Kinder und Jugendliche versucht, sein Wissen der "Generation PlayStation" nahezubringen. ("Le Moyen Age explique aux enfants", Seuil)
New York Times (USA), 08.10.2006
Ist die Welt nach dem 11. September wirklich eine andere? In einem Essay erklärt der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, dass zumindest die Sicherheitspolitik der USA heute nicht fantasievoller ist als im Kalten Krieg. Edward Shils unter dem Eindruck der Ära McCarthy entstandendem Buch "The Torment of Secrecy: The Background and Consequences of American Security Policies" von 1956 entnimmt Fukuyama, "dass die USA Bedrohungen von außerhalb schon früher gern übertrieben und sich Verschwörungstheorien ausgedacht haben. Dies rechtfertigte die Schaffung eines Geheim-Staates, der die Grundrechte und den freien Datenaustausch aushöhlte, die Fundamente des Erfolges für die USA als Gesellschaft ... Solche Erfahrungen zeigen, dass die Regierung ihren Kenntnisstand transparent machen muss; nur so können wir die anstehenden Herausforderungen richtig einschätzen."
William Kennedy stellt Cormac McCarthys neuen Roman "The Road" vor, der in biblischen Bildern schildert, wie Vater und Sohn die Welt sehen - nach der Apokalypse: "Alle Farben, außer des Feuers und des Blutes, existieren nur noch in der Erinnerung oder in Träumen. Feuerstürme haben Städte und Wälder verschlungen ... Wilde Orchideen stehen, aschfarbene Abbilder ihrer selbst, wartend, dass der Wind sie zu Staub macht." (Hier ein Feature zu McCarthy)
Außerdem: Tom Reiss erinnert der Detailreichtum in den Memoiren des Historikers Fritz Stern (Auszug "Five Germanys I Have Known") an Stefan Zweigs "Die Welt von Gestern". Und Thomas Mallon bespricht Biografien "der beiden Hepburns" (William J. Manns "Kate" und Donald Spotos "Enchantment") und findet, Audrey und Katharine könnten verschiedenartiger nicht sein.
 Was der Renaissance die Zentralperspektive war, ist uns der "lange Zoom" - bestes Beispiel: Google Earth. Oder Spore, das neue Spiel des SimCity-Machers Will Wright, das fürs New York Times Magazine Steven Johnson probegespielt hat: "Zuerst bist du ein Einzeller ... Hast du genug 'DNA-Punkte' gesammelt, wird es spannend - du kannst den "Kreaturenschöpfer" benutzen ... Im nächsten Level kommt das fertige Geschöpf in ein vollfunktionsfähiges Ökosystem ... Schließlich erlangst du eine UN-ähnliche Perspektive, wenn es darum geht, einen ganzen von rivalisierenden Zivilisationen zerrütteten Planeten zu einen. Hast du das "Krieg der Zivilisationen"-Stadium Richtung "Ende der Geschichte" verlassen, gewährt das Spiel dir die ultimative Hegelsche Belohnung: Ein Raumschiff. Los geht?s zu anderen Planeten ..."
Was der Renaissance die Zentralperspektive war, ist uns der "lange Zoom" - bestes Beispiel: Google Earth. Oder Spore, das neue Spiel des SimCity-Machers Will Wright, das fürs New York Times Magazine Steven Johnson probegespielt hat: "Zuerst bist du ein Einzeller ... Hast du genug 'DNA-Punkte' gesammelt, wird es spannend - du kannst den "Kreaturenschöpfer" benutzen ... Im nächsten Level kommt das fertige Geschöpf in ein vollfunktionsfähiges Ökosystem ... Schließlich erlangst du eine UN-ähnliche Perspektive, wenn es darum geht, einen ganzen von rivalisierenden Zivilisationen zerrütteten Planeten zu einen. Hast du das "Krieg der Zivilisationen"-Stadium Richtung "Ende der Geschichte" verlassen, gewährt das Spiel dir die ultimative Hegelsche Belohnung: Ein Raumschiff. Los geht?s zu anderen Planeten ..."
Weiteres: Mark Sundeen porträtiert den demokratischen Spitzenpolitiker und Gouverneur von Montana, Brian Schweitzer. In einem unter die Haut gehenden Text untersucht Charles Siebert beunruhigende Veränderungen im Seelenleben der Elefanten.
William Kennedy stellt Cormac McCarthys neuen Roman "The Road" vor, der in biblischen Bildern schildert, wie Vater und Sohn die Welt sehen - nach der Apokalypse: "Alle Farben, außer des Feuers und des Blutes, existieren nur noch in der Erinnerung oder in Träumen. Feuerstürme haben Städte und Wälder verschlungen ... Wilde Orchideen stehen, aschfarbene Abbilder ihrer selbst, wartend, dass der Wind sie zu Staub macht." (Hier ein Feature zu McCarthy)
Außerdem: Tom Reiss erinnert der Detailreichtum in den Memoiren des Historikers Fritz Stern (Auszug "Five Germanys I Have Known") an Stefan Zweigs "Die Welt von Gestern". Und Thomas Mallon bespricht Biografien "der beiden Hepburns" (William J. Manns "Kate" und Donald Spotos "Enchantment") und findet, Audrey und Katharine könnten verschiedenartiger nicht sein.
 Was der Renaissance die Zentralperspektive war, ist uns der "lange Zoom" - bestes Beispiel: Google Earth. Oder Spore, das neue Spiel des SimCity-Machers Will Wright, das fürs New York Times Magazine Steven Johnson probegespielt hat: "Zuerst bist du ein Einzeller ... Hast du genug 'DNA-Punkte' gesammelt, wird es spannend - du kannst den "Kreaturenschöpfer" benutzen ... Im nächsten Level kommt das fertige Geschöpf in ein vollfunktionsfähiges Ökosystem ... Schließlich erlangst du eine UN-ähnliche Perspektive, wenn es darum geht, einen ganzen von rivalisierenden Zivilisationen zerrütteten Planeten zu einen. Hast du das "Krieg der Zivilisationen"-Stadium Richtung "Ende der Geschichte" verlassen, gewährt das Spiel dir die ultimative Hegelsche Belohnung: Ein Raumschiff. Los geht?s zu anderen Planeten ..."
Was der Renaissance die Zentralperspektive war, ist uns der "lange Zoom" - bestes Beispiel: Google Earth. Oder Spore, das neue Spiel des SimCity-Machers Will Wright, das fürs New York Times Magazine Steven Johnson probegespielt hat: "Zuerst bist du ein Einzeller ... Hast du genug 'DNA-Punkte' gesammelt, wird es spannend - du kannst den "Kreaturenschöpfer" benutzen ... Im nächsten Level kommt das fertige Geschöpf in ein vollfunktionsfähiges Ökosystem ... Schließlich erlangst du eine UN-ähnliche Perspektive, wenn es darum geht, einen ganzen von rivalisierenden Zivilisationen zerrütteten Planeten zu einen. Hast du das "Krieg der Zivilisationen"-Stadium Richtung "Ende der Geschichte" verlassen, gewährt das Spiel dir die ultimative Hegelsche Belohnung: Ein Raumschiff. Los geht?s zu anderen Planeten ..." Weiteres: Mark Sundeen porträtiert den demokratischen Spitzenpolitiker und Gouverneur von Montana, Brian Schweitzer. In einem unter die Haut gehenden Text untersucht Charles Siebert beunruhigende Veränderungen im Seelenleben der Elefanten.
Vanity Fair | Times Literary Supplement | Foglio | Weltwoche | Point | New York Times | al-Sharq al-Awsat | Outlook India | Spiegel | Semana | DU | New Yorker | Polityka | Gazeta Wyborcza












