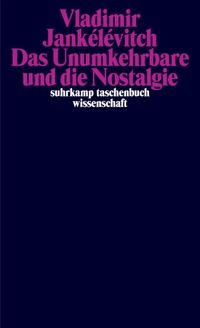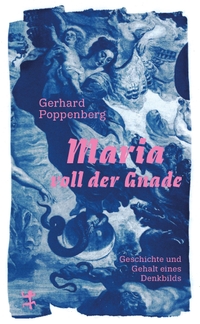Magazinrundschau
Es gibt nur Innen
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
16.12.2013. Der ukrainische Schriftsteller Mykola Rjabtschuk erklärt, warum derzeit nur die kriminelle Kaste von Europa profitiert. The New Republic liest ein Buch über die Dänen als rettende "Ausnahme". Al Ahram empfiehlt eine Re-Lektüre des Reformers Muhammad Abduh. Brooklyn Rail deutet die Zeichen in Katastrophenfilmen. Im Guardian fegt SF-Autor Brian Aldiss ein paar Spinnweben zur Seite. Das Wallstreet Journal erzählt die Geschichte der Lobotomie in den USA. Die New York Times zeigt Google eine lange Nase und navigiert mit OpenStreetMap.
Eurozine (Österreich), 13.12.2013
 Der ukrainische Schriftsteller Mykola Rjabtschuk hat die bisher besten Argumente, warum Europa die Ukraine aufnehmen sollte. Er verweist auf eine besondere Ungerechtigkeit: "Innerhalb weniger Jahre riss der enge Zirkel um Präsident Janukowitsch (genannt 'die Familie') alle Macht an sich, zerstörte das Rechtssystem, häufte qua Korruption enorme Ressource an und beschnitt die Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten. Eigentlich müsste es ein Segen sein, dass diese Leute das Abkommen mit der EU zurückzogen und dass ein Land mit einem solchen Regime nicht von Europa aufgenommen wird. Das Problem ist aber, dass sie schon in Europa sind - mit ihren Villen, dem gestohlenen Geld und den Diplomatenpässen, was die Visafreiheit für den Rest der Ukraine in ihren Augen unnötig macht. Sie profitieren von der Rechtsstaatlichkeit und dem Eigentumsrecht im Westen, während sie diese Dinge in ihrem eigenen Land systematisch unterminieren. Nicht sie, sondern die 40 Millionen Ukrainer werden von Europa ausgeschlossen, während die herrschende Elite la dolce vita in den Resorts des Westen genießt und das verarmte Land bis auf den letzten Tropen aussaugt."
Der ukrainische Schriftsteller Mykola Rjabtschuk hat die bisher besten Argumente, warum Europa die Ukraine aufnehmen sollte. Er verweist auf eine besondere Ungerechtigkeit: "Innerhalb weniger Jahre riss der enge Zirkel um Präsident Janukowitsch (genannt 'die Familie') alle Macht an sich, zerstörte das Rechtssystem, häufte qua Korruption enorme Ressource an und beschnitt die Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten. Eigentlich müsste es ein Segen sein, dass diese Leute das Abkommen mit der EU zurückzogen und dass ein Land mit einem solchen Regime nicht von Europa aufgenommen wird. Das Problem ist aber, dass sie schon in Europa sind - mit ihren Villen, dem gestohlenen Geld und den Diplomatenpässen, was die Visafreiheit für den Rest der Ukraine in ihren Augen unnötig macht. Sie profitieren von der Rechtsstaatlichkeit und dem Eigentumsrecht im Westen, während sie diese Dinge in ihrem eigenen Land systematisch unterminieren. Nicht sie, sondern die 40 Millionen Ukrainer werden von Europa ausgeschlossen, während die herrschende Elite la dolce vita in den Resorts des Westen genießt und das verarmte Land bis auf den letzten Tropen aussaugt."Weiteres: Ivan Krastev sieht die Ukraine am Ende ihres internationalen Schlingerkurs angekommen, der sie nach Europa bringen sollte, aber nicht von Russland entfernen. Anton Schechowzow erklärt, dass die Proteste nicht von der Opposition angeführt werden, sondern von der Zivilgesellschaft.
New Republic (USA), 09.12.2013
 Bo Lidegaard, Redakteur der dänischen Tageszeitung Politiken, hat mit 'Die Ausnahme' ein Buch veröffentlicht, dass sich mit der Frage auseinandersetzt, warum gerade die Dänen "ihre" Juden unter deutscher Besatzung gerettet haben. "'Die Ausnahme' sollte jeder lesen, der wissen will, genau welche Mischung aus gemeinsamen sozialen und politischen Überzeugungen es möglich macht, in Zeiten entsetzlicher Dunkelheit Zivilcourage und einen ungewöhnlichen Anstand zu bewahren", empfiehlt der kanadische Historiker und Politiker Michael Ignatieff. Doch wendet er auch ein, dass die Geschichte in Teilen komplexer ist, als Lidegaard sie erzählt: "Die zentrale Zweitdeutigkeit liegt darin, dass die Deutschen die Juden gewarnt und die meisten hatten fliehen lassen. Lidegaard behauptet, das sei geschehen, weil die Dänen sich geweigert hätten, den Deutschen zu helfen, aber es kann auch andersherum funktioniert haben: Erst als die Dänen begriffen, dass die Deutschen einige Juden gehen ließen, fanden sie die Courage, dem Rest der jüdischen Gemeinde bei der Flucht zu helfen. 'Die Ausnahme' ist eine faszinierende Studie über die Zweideutigkeit von Rechtschaffenheit."
Bo Lidegaard, Redakteur der dänischen Tageszeitung Politiken, hat mit 'Die Ausnahme' ein Buch veröffentlicht, dass sich mit der Frage auseinandersetzt, warum gerade die Dänen "ihre" Juden unter deutscher Besatzung gerettet haben. "'Die Ausnahme' sollte jeder lesen, der wissen will, genau welche Mischung aus gemeinsamen sozialen und politischen Überzeugungen es möglich macht, in Zeiten entsetzlicher Dunkelheit Zivilcourage und einen ungewöhnlichen Anstand zu bewahren", empfiehlt der kanadische Historiker und Politiker Michael Ignatieff. Doch wendet er auch ein, dass die Geschichte in Teilen komplexer ist, als Lidegaard sie erzählt: "Die zentrale Zweitdeutigkeit liegt darin, dass die Deutschen die Juden gewarnt und die meisten hatten fliehen lassen. Lidegaard behauptet, das sei geschehen, weil die Dänen sich geweigert hätten, den Deutschen zu helfen, aber es kann auch andersherum funktioniert haben: Erst als die Dänen begriffen, dass die Deutschen einige Juden gehen ließen, fanden sie die Courage, dem Rest der jüdischen Gemeinde bei der Flucht zu helfen. 'Die Ausnahme' ist eine faszinierende Studie über die Zweideutigkeit von Rechtschaffenheit."Al Ahram Weekly (Ägypten), 12.12.2013
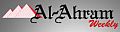 Mohamed Soffar liest "Die bittere Wahrheit", einen Aufsatz des islamischen Gelehrten und Reformers Muhammad Abduh (1849-1905), im Licht von Kants Aufsatz "Was ist Aufklärung?". Beide, so Soffar beschäftigen sich mit der Frage, wie der Intellektuelle mit politischen Autoritäten umgehen soll. Anders als Kant sah Abduh den Staat, den er nur als despotischen kannte, nicht als potentiellen Verbündeten gegen einen rückständigen Klerus. Und hier wird es dann überraschend: "Mit der britischen Besetzung Ägyptens, erschien am politischen Horizont Abduhs ein Gegengewicht zum despotischen Staat. Die Besatzung versorgte Abduh mit dem Partner, der ihm bisher für einen Sozialvertrag gefehlt hatte, ein Partner, der das historische und politische Äquivalent zur Autorität der absoluten Könige im westlichen Experiment war. Und ähnlich wie die westlichen Intellektuellen würde Abduh, indem er sich taktisch mit der britischen Besatzungsmacht gegen die orientalischen Prinzen verbündet, Unterstützung für sein Reformprojekt erhalten. Am Ende würde er beide Autoritäten abschaffen 'ohne Schaden anzurichten und zur rechten Zeit', wie er selbst schrieb." Doch die bittere Wahrheit war und ist, dass sich die Ägypter ihren despotischen Herren immer wieder bereitwillig unterwerfen, fürchtet Soffar.
Mohamed Soffar liest "Die bittere Wahrheit", einen Aufsatz des islamischen Gelehrten und Reformers Muhammad Abduh (1849-1905), im Licht von Kants Aufsatz "Was ist Aufklärung?". Beide, so Soffar beschäftigen sich mit der Frage, wie der Intellektuelle mit politischen Autoritäten umgehen soll. Anders als Kant sah Abduh den Staat, den er nur als despotischen kannte, nicht als potentiellen Verbündeten gegen einen rückständigen Klerus. Und hier wird es dann überraschend: "Mit der britischen Besetzung Ägyptens, erschien am politischen Horizont Abduhs ein Gegengewicht zum despotischen Staat. Die Besatzung versorgte Abduh mit dem Partner, der ihm bisher für einen Sozialvertrag gefehlt hatte, ein Partner, der das historische und politische Äquivalent zur Autorität der absoluten Könige im westlichen Experiment war. Und ähnlich wie die westlichen Intellektuellen würde Abduh, indem er sich taktisch mit der britischen Besatzungsmacht gegen die orientalischen Prinzen verbündet, Unterstützung für sein Reformprojekt erhalten. Am Ende würde er beide Autoritäten abschaffen 'ohne Schaden anzurichten und zur rechten Zeit', wie er selbst schrieb." Doch die bittere Wahrheit war und ist, dass sich die Ägypter ihren despotischen Herren immer wieder bereitwillig unterwerfen, fürchtet Soffar.Außerdem: Nehad Selaiha bespricht Aufführungen beim 11. Saquia Theaterfestival.
Brooklyn Rail (USA), 16.12.2013
 Das Motiv der Ruine und des katastrophischen Niedergangs genießt derzeit in Kunst und Film Hochkonjunktur, beobachtet David Geers, der zur Erörterung dieses Phänomens viele klingende Namen heranzieht, auch wenn er mit deren abstrakten Lösungsvorschlägen nicht ganz zufrieden ist: "Vielleicht besteht die Aufgabe darin, diese filmischen und künstlerischen Attacken tatsächlich wörtlich nehmen - als Fantasie einer Wunscherfüllung -, um die darin verborgenen utopischen Sehnsüchte kenntlich zu machen. Wenn wir alleine die Zerstörung unserer Städte im Film betrachten, könnten wir uns, beispielsweise, auch eine Zukunft ohne Wahrzeichen vorstellen, da eine mögliche, vereinte Menschheit diese Insignien nationaler Identität als unwichtig erachten könnte. Wie die kollektiven Erschütterungen der globalen Wirtschaft bereits zu erkennen geben, ist ein solcher Vereinigungsprozess, zumindest wirtschaftlich, bereits im vollen Gang. Er muss lediglich bewusst wahrgenommen werden, wird aber stattdessen als Spielszenario oder Generalprobe traumatisch nachgestellt. Genauso erblicken wir in dem Gespenst eines oft technologisch hochgerüsteten Alien-Gegners den Schimmer einer künftigen Post-Humanität, die sich bereits in den Fortschritten der vom Krieg angetriebenen Medizin und den 3D-Printern abzeichnet."
Das Motiv der Ruine und des katastrophischen Niedergangs genießt derzeit in Kunst und Film Hochkonjunktur, beobachtet David Geers, der zur Erörterung dieses Phänomens viele klingende Namen heranzieht, auch wenn er mit deren abstrakten Lösungsvorschlägen nicht ganz zufrieden ist: "Vielleicht besteht die Aufgabe darin, diese filmischen und künstlerischen Attacken tatsächlich wörtlich nehmen - als Fantasie einer Wunscherfüllung -, um die darin verborgenen utopischen Sehnsüchte kenntlich zu machen. Wenn wir alleine die Zerstörung unserer Städte im Film betrachten, könnten wir uns, beispielsweise, auch eine Zukunft ohne Wahrzeichen vorstellen, da eine mögliche, vereinte Menschheit diese Insignien nationaler Identität als unwichtig erachten könnte. Wie die kollektiven Erschütterungen der globalen Wirtschaft bereits zu erkennen geben, ist ein solcher Vereinigungsprozess, zumindest wirtschaftlich, bereits im vollen Gang. Er muss lediglich bewusst wahrgenommen werden, wird aber stattdessen als Spielszenario oder Generalprobe traumatisch nachgestellt. Genauso erblicken wir in dem Gespenst eines oft technologisch hochgerüsteten Alien-Gegners den Schimmer einer künftigen Post-Humanität, die sich bereits in den Fortschritten der vom Krieg angetriebenen Medizin und den 3D-Printern abzeichnet."Outlook India (Indien), 23.12.2013
 Im jüngeren Bollywood-Kino häufen sich die Darstellungen sexuell selbstbewusster und aktiver Frauen, schreibt Namrata Joshi. In der Filmbranche selbst gibt es dazu stark schwankende Meinungen: "Markiert dieses sexuelle Durchsetzungsvermögen eine weitere Errungenschaft auf dem langen Weg zur Emanzipation? Oder handelt es sich einfach nur um eine weitere Pose, die Bollywood-Heldinnen einzunehmen gezwungen sind? Während Paoli Dam zwar der Ansicht ist, dass diese neue 'Aggressivität' die heutige Realität unabhängiger und selbstbewusster Frauen wiederspiegelt, weiß sie doch auch, dass die Darstellungen noch immer am patriarchalen Kater einer von Männern dominierten Industrie leiden. ... Kein Wunder, dass bei Filmemacher Dibakar Banerji ein Hauch von Zweifel und Vorsicht mitklingt. 'Unsere Filme reflektieren die Neigungen, Werte, Vorurteile und Ansichten der Filmemacher, von denen die meisten patriarchal-feudale Männer sind. Frauen sind für sie eine wertvolle wirtschaftliche Resource und es dreht sich alles darum, sie auf kommerziell möglichst wertvolle Weise zu 'bearbeiten'. ... Wir sehen hier eine gefährliche Mischung des alten patriarchalen Systems mit dem glitzernden, modernen Kosumismus.'"
Im jüngeren Bollywood-Kino häufen sich die Darstellungen sexuell selbstbewusster und aktiver Frauen, schreibt Namrata Joshi. In der Filmbranche selbst gibt es dazu stark schwankende Meinungen: "Markiert dieses sexuelle Durchsetzungsvermögen eine weitere Errungenschaft auf dem langen Weg zur Emanzipation? Oder handelt es sich einfach nur um eine weitere Pose, die Bollywood-Heldinnen einzunehmen gezwungen sind? Während Paoli Dam zwar der Ansicht ist, dass diese neue 'Aggressivität' die heutige Realität unabhängiger und selbstbewusster Frauen wiederspiegelt, weiß sie doch auch, dass die Darstellungen noch immer am patriarchalen Kater einer von Männern dominierten Industrie leiden. ... Kein Wunder, dass bei Filmemacher Dibakar Banerji ein Hauch von Zweifel und Vorsicht mitklingt. 'Unsere Filme reflektieren die Neigungen, Werte, Vorurteile und Ansichten der Filmemacher, von denen die meisten patriarchal-feudale Männer sind. Frauen sind für sie eine wertvolle wirtschaftliche Resource und es dreht sich alles darum, sie auf kommerziell möglichst wertvolle Weise zu 'bearbeiten'. ... Wir sehen hier eine gefährliche Mischung des alten patriarchalen Systems mit dem glitzernden, modernen Kosumismus.'"Guardian (UK), 14.12.2013
 Stuart Kelly trifft in Oxford den SF-Autor Brian Aldiss zum Interview, der über Tolstois "Auferstehung" zum Vegetarier wurde, die erfolgreichsten Bücher aus purer Verzweiflung schreibt und es sehr genießt, unter Alleswissern zu leben: "Am liebsten sind mir meine 'Helliconia'-Bücher aus den frühen Achtzigern (die Romane unternehmen den dramatischen Versuch, die Geschichte einer ganzen Zivilisation zu erzählen, und beschreiben einen Planeten, auf dem die Jahreszeiten Äonen dauern), an ihnen habe ich sehr hart gearbeitet. Zwei Jahre lang habe ich nichts als Fragen gestellt! Der Vorteil am Leben in Oxford ist, dass man an jede beliebige alte Tür klopfen kann, und wenn sich die Tür öffnet und die Spinnweben aufreißen, dann steht da jemand, der einfach alles zum Thema so und so weiß. Einmal war ich Mittagessen mit dem Rektor eines Colleges, der eine Geschichte der Welt geschrieben hatte. Ich fragte ihn, ob eine Zivilisation 5.000 Jahre überdauern kann und er gab mir eine sehr brauchbare Antwort: 'Es kommt darauf an.'"
Stuart Kelly trifft in Oxford den SF-Autor Brian Aldiss zum Interview, der über Tolstois "Auferstehung" zum Vegetarier wurde, die erfolgreichsten Bücher aus purer Verzweiflung schreibt und es sehr genießt, unter Alleswissern zu leben: "Am liebsten sind mir meine 'Helliconia'-Bücher aus den frühen Achtzigern (die Romane unternehmen den dramatischen Versuch, die Geschichte einer ganzen Zivilisation zu erzählen, und beschreiben einen Planeten, auf dem die Jahreszeiten Äonen dauern), an ihnen habe ich sehr hart gearbeitet. Zwei Jahre lang habe ich nichts als Fragen gestellt! Der Vorteil am Leben in Oxford ist, dass man an jede beliebige alte Tür klopfen kann, und wenn sich die Tür öffnet und die Spinnweben aufreißen, dann steht da jemand, der einfach alles zum Thema so und so weiß. Einmal war ich Mittagessen mit dem Rektor eines Colleges, der eine Geschichte der Welt geschrieben hatte. Ich fragte ihn, ob eine Zivilisation 5.000 Jahre überdauern kann und er gab mir eine sehr brauchbare Antwort: 'Es kommt darauf an.'"Außerdem: Julian Barnes kürt John Williams' tieftraurigen Roman "Stoner", der gerade in Europa, nicht aber in den USA, wiederentdeckt wird, zum Buch des Jahres. Michael Newton sieht noch einmal Stanley Donens Film "Charade", den letzten Hollywoodfilm mit Charme und Anmut. Rachel Cooke erzählt, dass "Emil und die Detektive" ihr erstes Lieblingskinderbuch war. Besprochen werden u.a. Roger Knights Geschichtsband "Britain Against Napoleon: The Organisation of Victory, 1793-1815" und Hannah Greigs Kulturgeschichte "Beau Monde: Fashionable Society in Georgian London".
Rue89 (Frankreich), 15.12.2013
 Kate Barry, die erste Tochter von Jane Birkin, hat sich letzte Woche im Alter von 46 Jahren das Leben genommen. Sophie Caillat präsentiert auf Rue89 eine Dokumentation über Barry, die von Yamina Benguigui, der heutigen französischen Integrationsministerin, Ende der neunziger Jahre gedreht wurde. Barry erklärt darin, warum sie auf dem Land ein Heim für Drogensüchtige gegründet hat, das nach dem Muster der Anonymen Alkoholiker funktioniert. "So schön und sensibel wie ihre Schwestern Charlotte Gainsbourg und Lou Doillon, scheint sie doch so viel zerbrechlicher", schreibt Caillat. Das Heim funktionierte allerdings nach strikten Regeln: "Man versucht nicht zu verstehen, warum jemand gefallen ist, sondern nur, wie er wieder herauskommen kann, obwohl doch das eine manchmal nicht ohne das andere geht. Die Familie des Patienten wird in die Therapie einbezogen und dabei stets von Schuld freigesprochen. Entstanden aus der Verhaltenstherapie konfrontiert diese Methode eine Person direkt mit dem Heilungsprozess. In diesem Kampf entsteht ein enormer Druck, jeder Tag ist eine Schlacht, die zu gewinnen ist."
Kate Barry, die erste Tochter von Jane Birkin, hat sich letzte Woche im Alter von 46 Jahren das Leben genommen. Sophie Caillat präsentiert auf Rue89 eine Dokumentation über Barry, die von Yamina Benguigui, der heutigen französischen Integrationsministerin, Ende der neunziger Jahre gedreht wurde. Barry erklärt darin, warum sie auf dem Land ein Heim für Drogensüchtige gegründet hat, das nach dem Muster der Anonymen Alkoholiker funktioniert. "So schön und sensibel wie ihre Schwestern Charlotte Gainsbourg und Lou Doillon, scheint sie doch so viel zerbrechlicher", schreibt Caillat. Das Heim funktionierte allerdings nach strikten Regeln: "Man versucht nicht zu verstehen, warum jemand gefallen ist, sondern nur, wie er wieder herauskommen kann, obwohl doch das eine manchmal nicht ohne das andere geht. Die Familie des Patienten wird in die Therapie einbezogen und dabei stets von Schuld freigesprochen. Entstanden aus der Verhaltenstherapie konfrontiert diese Methode eine Person direkt mit dem Heilungsprozess. In diesem Kampf entsteht ein enormer Druck, jeder Tag ist eine Schlacht, die zu gewinnen ist."New York Magazine (USA), 16.12.2013
 Dan P. Lee begleitet den britischen Künstler und Filmemacher Steve McQueen bei der Werbekampagne für sein Sklavereidrama "12 Years a Slave" durch Los Angeles. Auch wenn McQueen, der 1999 mit dem renommierten Turner Prize ausgezeichnet wurde, in Hollywood vieles fremd ist, beteiligt er sich doch mit Eifer daran, seinen Film für die Oscars zu promoten, beobachtet Lee: "Darin wird wohl McQueens Herkunft aus der Arbeiterklasse deutlich. 'Wenn mir jemand einen Preis verleihen will', verriet er mir über den Turner, 'dann nehme ich ihn an.' Er glaubt nicht an das Außenseitertum in der Kunst. 'Es gibt nur Innen. Auch wenn du sagst, dass du draußen bist, bist du eigentlich drin. Was kann man also innerhalb dieser Gegenbenheiten tun, um sie zu seinem Vorteil zu nutzen?'"
Dan P. Lee begleitet den britischen Künstler und Filmemacher Steve McQueen bei der Werbekampagne für sein Sklavereidrama "12 Years a Slave" durch Los Angeles. Auch wenn McQueen, der 1999 mit dem renommierten Turner Prize ausgezeichnet wurde, in Hollywood vieles fremd ist, beteiligt er sich doch mit Eifer daran, seinen Film für die Oscars zu promoten, beobachtet Lee: "Darin wird wohl McQueens Herkunft aus der Arbeiterklasse deutlich. 'Wenn mir jemand einen Preis verleihen will', verriet er mir über den Turner, 'dann nehme ich ihn an.' Er glaubt nicht an das Außenseitertum in der Kunst. 'Es gibt nur Innen. Auch wenn du sagst, dass du draußen bist, bist du eigentlich drin. Was kann man also innerhalb dieser Gegenbenheiten tun, um sie zu seinem Vorteil zu nutzen?'"Interview (USA), 01.12.2013
 In den neunziger Jahren wurde Spike Jonze mit Musikvideos (etwa für die Beastie Boys, Fatboy Slim und Björk) bekannt, bevor er 1999 mit "Being John Malkovich" sein Spielfilmdebüt gab. Nicole Holofcener, selbst Regisseurin, sprach mit ihm über seinen neuen Film "Her" und den Unterschied zwischen dem Drehen von Filmen und Musikvideos. Dazu Jonze: "Ich glaube, der Prozess ist derselbe. Ich arbeite mit Leuten, die ich liebe, die begabt sind und die mich absolut besser machen, ob es jetzt die Schauspieler sind oder mein Cutter Eric Zumbrunnen oder mein Kameramann Hoyte Van Hoytema oder die Beastie Boys oder Charlie Kaufman. Es geht darum, mit Leuten zu arbeiten, die mich besser machen. Davon, dass ich Zugriff auf ihre Ideen habe, lerne ich so viel. Weißt Du, meine Aufgabe als Regisseur ist es, so viele Leute wie möglich zu ermutigen, ihre Ideen einzubringen, und diese dann zu kuratieren, zu entscheiden, welche dieser Ideen die richtigen sind für das, woran wir gerade arbeiten."
In den neunziger Jahren wurde Spike Jonze mit Musikvideos (etwa für die Beastie Boys, Fatboy Slim und Björk) bekannt, bevor er 1999 mit "Being John Malkovich" sein Spielfilmdebüt gab. Nicole Holofcener, selbst Regisseurin, sprach mit ihm über seinen neuen Film "Her" und den Unterschied zwischen dem Drehen von Filmen und Musikvideos. Dazu Jonze: "Ich glaube, der Prozess ist derselbe. Ich arbeite mit Leuten, die ich liebe, die begabt sind und die mich absolut besser machen, ob es jetzt die Schauspieler sind oder mein Cutter Eric Zumbrunnen oder mein Kameramann Hoyte Van Hoytema oder die Beastie Boys oder Charlie Kaufman. Es geht darum, mit Leuten zu arbeiten, die mich besser machen. Davon, dass ich Zugriff auf ihre Ideen habe, lerne ich so viel. Weißt Du, meine Aufgabe als Regisseur ist es, so viele Leute wie möglich zu ermutigen, ihre Ideen einzubringen, und diese dann zu kuratieren, zu entscheiden, welche dieser Ideen die richtigen sind für das, woran wir gerade arbeiten."The Atlantic (USA), 12.12.2013
 Warum nennt man ausführliche Reportagen und umfassende journalistische Beiträge seit neuestem "Long-Form"-Journalismus, fragt sich ärgerlich James Bennet, während die an Umfang vergleichbare Kurzgeschichte ganz im Gegenteil ihre eigene Kürze herausstellt? "Ich denke, dieser taxonomische Irrweg ist ein Anzeichen für den sich fortsetzenden kommerziellen Umbruch und das wacklige Selbstvertrauen, er mag an beidem vielleicht sogar beteiligt sein. Die Geschichte des Übergangs von einer Industrie, die in der Erinnerung so überschwänglich und ambitioniert war, dass sie aus eigener Kraft verkünden konnte, einen 'New Journalism' zu erfinden, hin zu einer Industrie, die mit geballten Fäusten etwas zu bewahren versucht, das sich 'Long-Form Journalism' nennt, klingt nicht gerade nach einer Long-Form-Geschichte mit Happy End. 'New Journalism', das ist ein aufregendes Versprechen an eine größere Welt. 'Long-Form' klingt wie die murmelnde Beschwörung einer Priesterschaft, die im Vergehen begriffen ist." Sein Alternativvorschlag? "Magazine Journalism." Dagegen haben wir nichts einzuwenden.
Warum nennt man ausführliche Reportagen und umfassende journalistische Beiträge seit neuestem "Long-Form"-Journalismus, fragt sich ärgerlich James Bennet, während die an Umfang vergleichbare Kurzgeschichte ganz im Gegenteil ihre eigene Kürze herausstellt? "Ich denke, dieser taxonomische Irrweg ist ein Anzeichen für den sich fortsetzenden kommerziellen Umbruch und das wacklige Selbstvertrauen, er mag an beidem vielleicht sogar beteiligt sein. Die Geschichte des Übergangs von einer Industrie, die in der Erinnerung so überschwänglich und ambitioniert war, dass sie aus eigener Kraft verkünden konnte, einen 'New Journalism' zu erfinden, hin zu einer Industrie, die mit geballten Fäusten etwas zu bewahren versucht, das sich 'Long-Form Journalism' nennt, klingt nicht gerade nach einer Long-Form-Geschichte mit Happy End. 'New Journalism', das ist ein aufregendes Versprechen an eine größere Welt. 'Long-Form' klingt wie die murmelnde Beschwörung einer Priesterschaft, die im Vergehen begriffen ist." Sein Alternativvorschlag? "Magazine Journalism." Dagegen haben wir nichts einzuwenden.Magyar Narancs (Ungarn), 28.11.2013
 Mit über hundert Büchern und einer Gesamtauflage von fast 15 Millionen ist György Moldova der meistgelesene zeitgenössische ungarische Schriftsteller. Er ist eine Identifikationsfigur für diejenigen, die ansonsten kaum jemanden haben: Menschen mit linker Identität, für urbane, antiliberale Antidemokraten und kommunistische Kreise sowie für rassistischen Antirassisten, die ihre Kritik am Rassismus davon abhängig machen, welche Gruppe er betrifft. Sándor Révész nähert sich in einer umfangreichen Abhandlung diesem Phänomen: "Folgende Parameter erklären die außerordentliche Beliebtheit und Wirkungskraft von Moldova in der Kádár-Ära: Die meisterhafte Bedienung des populärliterarischen Werkzeugs, die strikte Verfechtung der Monokausalität, die Gleichzeitigkeit von Gefügigkeit gegenüber dem System und partiellem Widerstand, die Befriedigung der Bedürfnisse nach Konformität und Kritik. Daneben gibt es aber auch die stetige thematische Pionierarbeit. Moldova hat über unzählige Themen öffentlich wirksam zum ersten Mal geschrieben: über 1956, die Judenfrage, die Romafrage, die unzureichende Kriminalitätsbekämpfung, verschiedene Industriezweige, öffentliche Leistungen, die dramatische Lage peripherer Regionen, Korruption, IM-Netzwerke, Ferenc Puskás, Che Guevara, die 'Aussiedlung' der Deutschen, Kulakengeschichten, Strafbataillonen des Militärs, Zwangskollektivierung in der Landwirtschaft, Krise des Fußballs, der moderne Israel... "
Mit über hundert Büchern und einer Gesamtauflage von fast 15 Millionen ist György Moldova der meistgelesene zeitgenössische ungarische Schriftsteller. Er ist eine Identifikationsfigur für diejenigen, die ansonsten kaum jemanden haben: Menschen mit linker Identität, für urbane, antiliberale Antidemokraten und kommunistische Kreise sowie für rassistischen Antirassisten, die ihre Kritik am Rassismus davon abhängig machen, welche Gruppe er betrifft. Sándor Révész nähert sich in einer umfangreichen Abhandlung diesem Phänomen: "Folgende Parameter erklären die außerordentliche Beliebtheit und Wirkungskraft von Moldova in der Kádár-Ära: Die meisterhafte Bedienung des populärliterarischen Werkzeugs, die strikte Verfechtung der Monokausalität, die Gleichzeitigkeit von Gefügigkeit gegenüber dem System und partiellem Widerstand, die Befriedigung der Bedürfnisse nach Konformität und Kritik. Daneben gibt es aber auch die stetige thematische Pionierarbeit. Moldova hat über unzählige Themen öffentlich wirksam zum ersten Mal geschrieben: über 1956, die Judenfrage, die Romafrage, die unzureichende Kriminalitätsbekämpfung, verschiedene Industriezweige, öffentliche Leistungen, die dramatische Lage peripherer Regionen, Korruption, IM-Netzwerke, Ferenc Puskás, Che Guevara, die 'Aussiedlung' der Deutschen, Kulakengeschichten, Strafbataillonen des Militärs, Zwangskollektivierung in der Landwirtschaft, Krise des Fußballs, der moderne Israel... "Wall Street Journal (USA), 14.12.2013
 In einer dreiteiligen Reportage berichtet Michael M. Phillips über ein nahezu vergessenes Kapitel der amerikanischen Medizingeschichte, das jetzt aufgetauchte geheime Dokumente belegen: die Lobotomie an 2000 traumatisierten Kriegsveteranen während des Zweiten Weltkriegs und in den 1950er Jahren. Bei dieser Operation werden Nerven gekappt, die vom Stirnlappen zum Zentrum des Gehirns verlaufen. "Während des Zweiten Weltkriegs hatte Lobotomie die von lobpreisenden Ärzten und Medien befeuerte Reputation, sie sei die beste Möglichkeit, das Leben von Menschen zu verbessern, deren Geisteskrankheiten sie ansonsten möglicherweise zu einem Leben in geschlossenen Anstalten verurteilt hätten. Einige Eltern von Veteranen forderten diese Operation geradezu für ihre gestörten Söhne. Viele lernten zu spät, dass Lobotomie ein fragwürdiger Segen war. Die Operation konnte die Gewaltausbrüche und die Ängste des Patienten reduzieren, sie konnte aber auch für immer seine Persönlichkeit und seine Unabhängigkeit zerstören. 'Er funktionierte einfach nicht mehr so wie früher', sagt Donald Rawlings, dessen Onkel Eldon Rawlings, ein Navy Veteran, lobotomisiert worden war und seine letzten Jahre damit verbrachte, einen Mopp durch sein Altersheim zu schieben. 'Sein Hirn war völlig verquirlt.'"
In einer dreiteiligen Reportage berichtet Michael M. Phillips über ein nahezu vergessenes Kapitel der amerikanischen Medizingeschichte, das jetzt aufgetauchte geheime Dokumente belegen: die Lobotomie an 2000 traumatisierten Kriegsveteranen während des Zweiten Weltkriegs und in den 1950er Jahren. Bei dieser Operation werden Nerven gekappt, die vom Stirnlappen zum Zentrum des Gehirns verlaufen. "Während des Zweiten Weltkriegs hatte Lobotomie die von lobpreisenden Ärzten und Medien befeuerte Reputation, sie sei die beste Möglichkeit, das Leben von Menschen zu verbessern, deren Geisteskrankheiten sie ansonsten möglicherweise zu einem Leben in geschlossenen Anstalten verurteilt hätten. Einige Eltern von Veteranen forderten diese Operation geradezu für ihre gestörten Söhne. Viele lernten zu spät, dass Lobotomie ein fragwürdiger Segen war. Die Operation konnte die Gewaltausbrüche und die Ängste des Patienten reduzieren, sie konnte aber auch für immer seine Persönlichkeit und seine Unabhängigkeit zerstören. 'Er funktionierte einfach nicht mehr so wie früher', sagt Donald Rawlings, dessen Onkel Eldon Rawlings, ein Navy Veteran, lobotomisiert worden war und seine letzten Jahre damit verbrachte, einen Mopp durch sein Altersheim zu schieben. 'Sein Hirn war völlig verquirlt.'"New York Times (USA), 15.12.2013
 So wie Ärzte vor gut siebzig Jahren Lobotomie als Wundermittel gegen psychische Störungen propagierten, so propagieren heute Pharmakonzerne und Ärzte Medikamente gegen das ADHS-Syndrom, erzählt Alan Schwarz in einer großen Reportage. Inzwischen werden die Medikamente oft für Kinder mit jeder Art von vermeintlich abweichendem Verhalten ("ist manchmal unkonzentriert") verschrieben. Jetzt sind auch die Erwachsenen dran: "Weil Studien gezeigt haben, das ADHS bei mehreren Familienmitgliedern vorliegen kann, nutzen die Pharmakonzerne den Markt für Kindern, um den für Erwachsene zu erschließen. Ein Pamphlet von 2008 von Janssen, dem Hersteller von Concerta - mit der Überschrift 'Wie die Eltern so das Kind?' - behauptet, 'ADHS ist eine häufig vererbte Störung', obwohl Studien zeigen, dass auf die meisten Eltern von ADHS-Kindern diese Diagnose nicht zutrifft."
So wie Ärzte vor gut siebzig Jahren Lobotomie als Wundermittel gegen psychische Störungen propagierten, so propagieren heute Pharmakonzerne und Ärzte Medikamente gegen das ADHS-Syndrom, erzählt Alan Schwarz in einer großen Reportage. Inzwischen werden die Medikamente oft für Kinder mit jeder Art von vermeintlich abweichendem Verhalten ("ist manchmal unkonzentriert") verschrieben. Jetzt sind auch die Erwachsenen dran: "Weil Studien gezeigt haben, das ADHS bei mehreren Familienmitgliedern vorliegen kann, nutzen die Pharmakonzerne den Markt für Kindern, um den für Erwachsene zu erschließen. Ein Pamphlet von 2008 von Janssen, dem Hersteller von Concerta - mit der Überschrift 'Wie die Eltern so das Kind?' - behauptet, 'ADHS ist eine häufig vererbte Störung', obwohl Studien zeigen, dass auf die meisten Eltern von ADHS-Kindern diese Diagnose nicht zutrifft."Adam Fisher schildert in einer beeindruckenden Reportage den geradezu gargantuesken Aufwand, den Google treibt, um die Welt von oben und unten und allen Seiten und in den kleinsten Details zu kartografieren, bis sie - wie in der Erzählung "Über die Genauigkeit von Wissenschaft" von Jorge Luis Borges - identisch wird mit ihrer Karte. Allerdings gibt es hier etwas, das man sich auch in anderen von Monopolisten beherrschten Gebieten des Netzes wünschens würde: einen Konkurrenten aus der Open Source-Szene, OpenStreetMap, eine Art Wikipedia für Kartennarren, und ein Projekt das beträchtlichen Erfolg hat, seit Google seine Programmierschnittstelle für Google Maps teilweise kostenpflichtig gemacht hat. Seitdem sind nämlich Unternehmen wie Apple und Foursquare zu O.S.M ausgewichen - ohne es sich unter den Nagel reißen zu können: "Die O.S.M.-Daten sind kostenlos, aber ihre Nutzung hat einen Widerhaken. Jede Verbesserung oder Änderung an den O.S.M.Karten muss zur Zentrale zurückgesandt werden. Das ist eine clevere Taktik, die die Konkurrenten dazu zwingt, entweder Google allein zu bekämpfen oder sich einem Bündnis anzuschließen, das bei Erfolg zugleich die Unmöglichkeit eines Monopols im Kartenwesen sicherstellen wird."
Außerdem in einer sehr reichhaltigen Woche der New York Times: Grauenhaft und unheimlich liest sich Jon Mooallems Reportage über die "Crazy Ants", Ameisen, die in riesigen Massen über ganze texanische Landstriche herfallen. Gerne kriechen sie in elektrische Geräte oder wandern einem die Waden hoch: "In Südamerika, wo Wissenschaftler ihren Ursprung vermuten, haben sie Hühnern die Nasenhöhlen verstopft. Sie kriechen auch in die Augen von Kühen. Bis heute sind sie nicht aufzuhalten." Ernüchternd liest sich Ben Sisarios Recherche zu Musikstreaming-Diensten wie Spotify, deren zahlbare Angebote offenbar nur zögernd benutzt werden und den Musikern zu wenig Tantiemen bringen.
Kommentieren