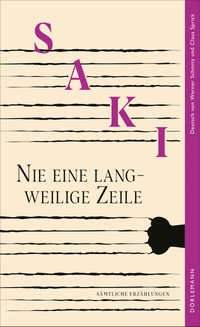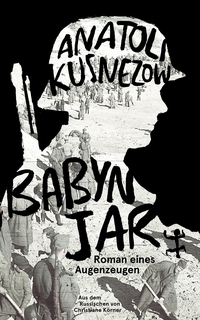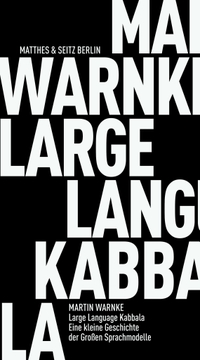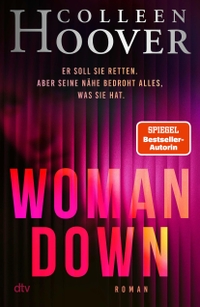Magazinrundschau
Gesten der Freiheit
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
16.07.2013. In le Monde sieht Olivier Roy die Muslimbrüder in der Sackgasse. Inzwischen lassen sich die Libyer vom Sturz Mursis inspirieren, berichtet Al Ahram. In The New Republic hat Adam Kirsch beim Freispruch George Zimmermans ein grässliches Déjà vu. Im Espresso bewundert Roberto Saviano Zigarette und Buch der tunesischen Aktivistin Amina. In El Pais Semanal fühlt sich Bernardo Bertolucci ein wenig antiquiert. Der New Yorker jagt Eierdiebe.
Le Monde (Frankreich), 11.07.2013
 Im Rahmen der Debatte "Steckt der politische Islam in einer Sackgasse?" bescheinigt der Politologe und Islam-Experte Olivier Roy den Muslimbrüdern Scheitern auf der ganzen Linie, politisch sowieso, aber auch, was ihre religiöse Position angeht. Roy schreibt: "Die Ausbreitung des Salafismus ist paradoxerweise Ausdruck des Auftauchens eines individualistischeren, weniger politisierten, wenn auch sehr strengen Islam. Das religiöse Feld demokratisiert sich, ohne notwendigerweise das Feld einer religiöser Reform oder Säkularisierung zu durchlaufen. Und wenn die alte Generation der Muslimbrüder, die die religiöse Wortführerschaft in der Politik gepachtet zu haben glaubte, nicht begreift, was gerade geschieht, haben doch ein Großteil der jüngeren Anhänger und Führungskader der Bruderschaft verstanden, dass es Zeit war, dass die islamistische Partei sich reformiert. Das Schicksal des politischen Islam ist aufgezeigt. Man könnte hoffen, dem Paradigma zu entkommen, das das politische Leben in Ägypten und der arabischen Welt seit dreißig Jahren belastet hat: vorgeblich laizistische Diktaturen contra einen vorgeblich revolutionären Islamismus."
Im Rahmen der Debatte "Steckt der politische Islam in einer Sackgasse?" bescheinigt der Politologe und Islam-Experte Olivier Roy den Muslimbrüdern Scheitern auf der ganzen Linie, politisch sowieso, aber auch, was ihre religiöse Position angeht. Roy schreibt: "Die Ausbreitung des Salafismus ist paradoxerweise Ausdruck des Auftauchens eines individualistischeren, weniger politisierten, wenn auch sehr strengen Islam. Das religiöse Feld demokratisiert sich, ohne notwendigerweise das Feld einer religiöser Reform oder Säkularisierung zu durchlaufen. Und wenn die alte Generation der Muslimbrüder, die die religiöse Wortführerschaft in der Politik gepachtet zu haben glaubte, nicht begreift, was gerade geschieht, haben doch ein Großteil der jüngeren Anhänger und Führungskader der Bruderschaft verstanden, dass es Zeit war, dass die islamistische Partei sich reformiert. Das Schicksal des politischen Islam ist aufgezeigt. Man könnte hoffen, dem Paradigma zu entkommen, das das politische Leben in Ägypten und der arabischen Welt seit dreißig Jahren belastet hat: vorgeblich laizistische Diktaturen contra einen vorgeblich revolutionären Islamismus." Al Ahram Weekly (Ägypten), 09.07.2013
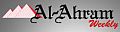 In Libyen fühlen sich Oppositionsgruppen inspiriert vom Sturz Mursis in Ägypten. Die Lage ist in Libyen zwar etwas anders, aber die Strategien, die der "Revolution vom 30. Juni" zum Erfolg verhalf, werden eifrig nachgeahmt, berichtet Kamal Abdallah. So sagt ihm Nasser Al-Hawari, Direktor der libyschen Menschenrechtsorganisation Observatory und Gründer der Rafd [Widerstand]-Bewegung, "'Rafd hoffe, seine Forderungen auf ähnliche Weise durchzusetzen: indem wir die Leute mobilisieren, sich in großer Zahl in den Städten auf den Plätzen zu versammeln, um friedlich für ihre Rechte einzutreten'. Al-Hawari sagt, der Hauptzweck von Rafd sei es, deutlich zu machen, dass das libysche Volk jede Form von Gewalt ablehnt, die den Menschen bestimmte Sichtweisen aufzwingen will, die demokratischen Werten widersprechen."
In Libyen fühlen sich Oppositionsgruppen inspiriert vom Sturz Mursis in Ägypten. Die Lage ist in Libyen zwar etwas anders, aber die Strategien, die der "Revolution vom 30. Juni" zum Erfolg verhalf, werden eifrig nachgeahmt, berichtet Kamal Abdallah. So sagt ihm Nasser Al-Hawari, Direktor der libyschen Menschenrechtsorganisation Observatory und Gründer der Rafd [Widerstand]-Bewegung, "'Rafd hoffe, seine Forderungen auf ähnliche Weise durchzusetzen: indem wir die Leute mobilisieren, sich in großer Zahl in den Städten auf den Plätzen zu versammeln, um friedlich für ihre Rechte einzutreten'. Al-Hawari sagt, der Hauptzweck von Rafd sei es, deutlich zu machen, dass das libysche Volk jede Form von Gewalt ablehnt, die den Menschen bestimmte Sichtweisen aufzwingen will, die demokratischen Werten widersprechen."New Republic (USA), 15.07.2013
Adam Kirsch fühlt sich durch den Freispruch George Zimmermans an eine Geschichte erinnert, die James Agee 1936 im Vorspann zu seinem Reportageband über drei arme weiße Farmpächter erzählte. Unterwegs in Alabama mit dem Fotografen Walker Evans kam er an einer kleinen Kirche für Schwarze vorbei, die sie gern fotografieren wollten. Ein Stück vor ihnen auf der Straße ging ein junges schwarzes Paar. Agee rannte hinter den beiden her, um zu fragen, wenn sie um Erlaubnis bitten müssten. Das Paar erstarrte in blankem Terror, und Agee erkannte seinen Fehler zu spät: "In Alabama 1936 war ein weißer Mann, der hinter einem schwarzen Paar herrennt, ein Agressor, ein potentieller Killer. Er ist bestürzt von 'der Nacktheit, der Tiefe und der Bedeutung ihrer Angst und ... meinem Horror und Mitleid und Selbsthass'. Nichts, was er sagt, kann die beiden von seinen guten Absichten überzeugen. Nachdem er dieses Kapitel gelesen hat, fragt sich der Leser nicht mehr, warum 'Let us praise famous men' weißen Pächtern gewidmet ist und nicht schwarzen. Agee hat gezeigt, dass die Rassengrenze so hoch, die Angst und das Misstrauen so instinktiv ist, dass sie unüberwindbar sind. Und es kommt mir so vor, als sei das, was George Zimmerman wollte und was das Gesetz will, indem es ihn schützt, die Aufrechterhaltung dieser Angst ist, über die Agee schreibt. Als er sich entschied Trayvon Martin aus keinem anderen Grund als racial profiling nachzugehen, ging Zimmerman davon aus, dass er ein Recht hatte, das Agee ablehnte - das Recht eines weißen Mannes, einen schwarzen Mann erstarren zu lassen. Martins Fehler war es zu denken, dass 2013 nicht 1936 ist, dass sich die rassische Dynamik geändert habe und er sich nicht ängstlich vor jedem weißen Mann ducken müsse, der hinter ihm herrennt."
Früher waren die Rechten die Puritaner, die sich ständig sorgten und alle möglichen Vorschriften im Kopf hatten. Heute sind es die Linken, seufzt Mark Oppenheimer nach einer Geburtstagsparty für einen Dreijährigen, auf der den kleinen Gästen die Cupcakes und der Saft entzogen wurde, weil sie ungesund seien. Oppenheimer erinnert sich an Zeiten, als man deutlich entspannter war und dies auch noch als politischen Akt betrachtete: "Meine Freunde und ich aßen - nicht jeden Tag, aber vielleicht einmal die Woche - bei McDonalds oder Dominos. Warum? Weil unsere Eltern keine Lust hatten, die ganze Zeit zu kochen. Meine Mutter und ihre Freundinnen kochten - die Ehemänner meist nicht - aber sie sahen Kochen nicht als progressiven Akt an. Ihre politische Auffassung war eine andere: Sie sahen es nicht als ihren Job an, den ganzen Tag zu Hause zu sein und nahrhafte Mahlzeiten für ihre Familien zu kochen. Etwas bei Dominos zu bestellen und sich nicht weiter zu kümmern, war ein feministischer Akt. Viele der Mütter arbeiteten nicht außer Haus, aber wenn sie bei Dominos bestellten, konnten sie zum monatlichen Treffen ihrer Frauengruppe gehen oder einen Tee bei Friendlys trinken. Das war prima. Zeit für sich selbst zu finden, war Grund genug, den Kindern ab und zu Junk Food zu servieren. Zeit für sich selbst zu finden, war ein politischer Akt."
Und: Christopher Caldwell bespricht ausführlich und sehr lobend zwei neue Bücher über das Leben im kommunistischen Osteuropa: Anne Applebaums "Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe 1944-56", eine Geschichte der sowjetischen Herrschaft über Osteuropa, und Marci Shores "The Taste of Ashes" über die Geschichte der Juden in Osteuropa und vor allem in Polen nach dem zweiten Weltkrieg.
Früher waren die Rechten die Puritaner, die sich ständig sorgten und alle möglichen Vorschriften im Kopf hatten. Heute sind es die Linken, seufzt Mark Oppenheimer nach einer Geburtstagsparty für einen Dreijährigen, auf der den kleinen Gästen die Cupcakes und der Saft entzogen wurde, weil sie ungesund seien. Oppenheimer erinnert sich an Zeiten, als man deutlich entspannter war und dies auch noch als politischen Akt betrachtete: "Meine Freunde und ich aßen - nicht jeden Tag, aber vielleicht einmal die Woche - bei McDonalds oder Dominos. Warum? Weil unsere Eltern keine Lust hatten, die ganze Zeit zu kochen. Meine Mutter und ihre Freundinnen kochten - die Ehemänner meist nicht - aber sie sahen Kochen nicht als progressiven Akt an. Ihre politische Auffassung war eine andere: Sie sahen es nicht als ihren Job an, den ganzen Tag zu Hause zu sein und nahrhafte Mahlzeiten für ihre Familien zu kochen. Etwas bei Dominos zu bestellen und sich nicht weiter zu kümmern, war ein feministischer Akt. Viele der Mütter arbeiteten nicht außer Haus, aber wenn sie bei Dominos bestellten, konnten sie zum monatlichen Treffen ihrer Frauengruppe gehen oder einen Tee bei Friendlys trinken. Das war prima. Zeit für sich selbst zu finden, war Grund genug, den Kindern ab und zu Junk Food zu servieren. Zeit für sich selbst zu finden, war ein politischer Akt."
Und: Christopher Caldwell bespricht ausführlich und sehr lobend zwei neue Bücher über das Leben im kommunistischen Osteuropa: Anne Applebaums "Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe 1944-56", eine Geschichte der sowjetischen Herrschaft über Osteuropa, und Marci Shores "The Taste of Ashes" über die Geschichte der Juden in Osteuropa und vor allem in Polen nach dem zweiten Weltkrieg.
Espresso (Italien), 15.07.2013
 Roberto Saviano schreibt in seiner Kolumne über die tunesische Aktivistin Amina, die im Gefängnis sitzt, weil sie das Wort "Femen" auf eine Mauer gesprüht hat. Er kommentiert ein bekanntes Foto, das sie mit entblößtem Oberkörper zeigt: "Als ich das Foto mit Aminas nackten Brüsten, dem Buch und der Zigarette gesehen habe, sind mir vor allem das Buch und die Zigarette als symbolischer Bruch erschienen. Nicht nur der Körper der Frau gehorcht niemand anderem - weder den Männern der Familie noch irgendwelchen moralischen Regeln - das gleiche gilt für ihren Geist und ihr Verhalten. Was in anderen Breiten banal ist, macht Amina zu einer gefährlichen Kriminellen. Eine Zigarette zu rauchen und zu lesen, sind Gesten der Freiheit, die sich Amina gegen die herrschenden Regeln erlaubt hat."
Roberto Saviano schreibt in seiner Kolumne über die tunesische Aktivistin Amina, die im Gefängnis sitzt, weil sie das Wort "Femen" auf eine Mauer gesprüht hat. Er kommentiert ein bekanntes Foto, das sie mit entblößtem Oberkörper zeigt: "Als ich das Foto mit Aminas nackten Brüsten, dem Buch und der Zigarette gesehen habe, sind mir vor allem das Buch und die Zigarette als symbolischer Bruch erschienen. Nicht nur der Körper der Frau gehorcht niemand anderem - weder den Männern der Familie noch irgendwelchen moralischen Regeln - das gleiche gilt für ihren Geist und ihr Verhalten. Was in anderen Breiten banal ist, macht Amina zu einer gefährlichen Kriminellen. Eine Zigarette zu rauchen und zu lesen, sind Gesten der Freiheit, die sich Amina gegen die herrschenden Regeln erlaubt hat."London Review of Books (UK), 18.07.2013
 Leben wir in reformatorischen oder revolutionären Zeiten, fragt sich Slavoj Zizek beim Überblick über die momentane Proteslage weltweit. Dabei fällt ihm auf, dass nicht nur in Nationen wie Griechenland rebelliert, wo es den Leuten an die blanke Existenz geht, sondern insbesondere auch in zuletzt enorm aufstrebenden Nationen wie der Türkei oder Brasilien. In revolutionäre und reformatorische Bewegungen möchte Zizek die Bewegungen allerdings nicht spalten - er sieht vielmehr alle an einem Strang: "Als sich 2011 die Proteste in Europa und dem Nahen Osten entflammten, insistierten viele, dass man diese nicht als Vertreter einer einzigen, globalen Bewegung sehen sollte. Vielmehr, argumentierte man, handelt es sich um Antworten auf spezifische Situationen. ... Es ist klar ersichtlich, warum eine solche Vereinzelung des Protests für die Verteidiger des Status Quo attraktiv ist: Es gibt keine globale Bedrohung gegen die globale Ordnung als solche, nur eine Abfolge verschiedener Probleme vor Ort. Der globale Kapitalismus ist ein komplexer Prozess, der verschiedene Länder auf verschiedene Weise betrifft. Was die Proteste in all ihren vielfältigen Facetten eint, ist, dass sie allesamt Reaktionen gegen verschiedene Aspekte der kapitalistischen Globalisierung darstellen."
Leben wir in reformatorischen oder revolutionären Zeiten, fragt sich Slavoj Zizek beim Überblick über die momentane Proteslage weltweit. Dabei fällt ihm auf, dass nicht nur in Nationen wie Griechenland rebelliert, wo es den Leuten an die blanke Existenz geht, sondern insbesondere auch in zuletzt enorm aufstrebenden Nationen wie der Türkei oder Brasilien. In revolutionäre und reformatorische Bewegungen möchte Zizek die Bewegungen allerdings nicht spalten - er sieht vielmehr alle an einem Strang: "Als sich 2011 die Proteste in Europa und dem Nahen Osten entflammten, insistierten viele, dass man diese nicht als Vertreter einer einzigen, globalen Bewegung sehen sollte. Vielmehr, argumentierte man, handelt es sich um Antworten auf spezifische Situationen. ... Es ist klar ersichtlich, warum eine solche Vereinzelung des Protests für die Verteidiger des Status Quo attraktiv ist: Es gibt keine globale Bedrohung gegen die globale Ordnung als solche, nur eine Abfolge verschiedener Probleme vor Ort. Der globale Kapitalismus ist ein komplexer Prozess, der verschiedene Länder auf verschiedene Weise betrifft. Was die Proteste in all ihren vielfältigen Facetten eint, ist, dass sie allesamt Reaktionen gegen verschiedene Aspekte der kapitalistischen Globalisierung darstellen."John Lanchester will die Banken retten, indem er sie in die Pflicht nehmen will, bei ihren Investitionen mehr Eigenkapital zu verwenden. Eleanor Birne besucht die Ausstellung "Curiosity" in der Turner Contemporary. Stephen Holmes liest ein neues Buch über die CIA unter Obama und schlussfolgert dabei in der Frage, ob Obamas Drohnenpolitik nicht eigentlich nur die Fortsetzung von Bushs Krieg gegen den Terror darstelle: "Obamas Hinwendung zum Drohneneinsatz ist eine logische Konsequenz aus Obamas Schwur, sich von den Landkriegen und Invasionen aus der Bush-Ära abzugrenzen."
Nepszabadsag (Ungarn), 13.07.2013
 Mit einem politischen Akt betreten Ungarn und Serbien nach siebzig Jahren auch offiziell den Weg der Versöhnung. János Áder, der Präsident der Republik Ungarn bat um Vergebung im serbischen Abgeordnetenhaus für die ungarischen Verbrechen während der Horthy-Ära. Und das serbische Abgeordnetenhaus verurteilte in einer Erklärung die Hinrichtung unschuldiger Ungarn. Die symbolische Geste könnte als Beispiel für die gesamte Region dienen, aber was sie im alltäglichen Leben bedeuten wird, ist schwer vorherzusehen. Der Schriftsteller László Végel kommentiert: "Als ich Material für meinen Roman 'Neoplanta - Novi Sad. Eine Stadt am Rande Europas' sammelte, haben mir mehrere älter Menschen ihre streng gehüteten Familiengeheimnisse verraten: Dass der eine oder andere Vorfahre den Einzug der Horthy-Armee in die Vojvodina herzlich bejubelte und vier Jahre später auf dem Hauptplatz in der selben Weise den Einzug der Partisanen begrüßte. (...) Mich hat interessiert, wie die Stimmung in der Zeit von 1941 war. Ich wollte aber dann wissen, warum sie weiterhin die Geschichten ihrer Vorfahren verheimlichen wollen. Das ist die größte Schande, sagten sie. (...) (...) Nach dem Versöhnungsakt betonen manche, dass die Kollektivschuld der Ungarn in der Vojvodina endgültig Vergangenheit ist, (...) aber schon nach 1945 sprach das Tito-System nicht mehr vom Kollektivschuld. Es ging mit der Vergangenheit auf die schlimmste Art und Weise um: Es machte ein Tabu aus ihr. Die Frage ist, was in den neuen Schulbüchern stehen wird."
Mit einem politischen Akt betreten Ungarn und Serbien nach siebzig Jahren auch offiziell den Weg der Versöhnung. János Áder, der Präsident der Republik Ungarn bat um Vergebung im serbischen Abgeordnetenhaus für die ungarischen Verbrechen während der Horthy-Ära. Und das serbische Abgeordnetenhaus verurteilte in einer Erklärung die Hinrichtung unschuldiger Ungarn. Die symbolische Geste könnte als Beispiel für die gesamte Region dienen, aber was sie im alltäglichen Leben bedeuten wird, ist schwer vorherzusehen. Der Schriftsteller László Végel kommentiert: "Als ich Material für meinen Roman 'Neoplanta - Novi Sad. Eine Stadt am Rande Europas' sammelte, haben mir mehrere älter Menschen ihre streng gehüteten Familiengeheimnisse verraten: Dass der eine oder andere Vorfahre den Einzug der Horthy-Armee in die Vojvodina herzlich bejubelte und vier Jahre später auf dem Hauptplatz in der selben Weise den Einzug der Partisanen begrüßte. (...) Mich hat interessiert, wie die Stimmung in der Zeit von 1941 war. Ich wollte aber dann wissen, warum sie weiterhin die Geschichten ihrer Vorfahren verheimlichen wollen. Das ist die größte Schande, sagten sie. (...) (...) Nach dem Versöhnungsakt betonen manche, dass die Kollektivschuld der Ungarn in der Vojvodina endgültig Vergangenheit ist, (...) aber schon nach 1945 sprach das Tito-System nicht mehr vom Kollektivschuld. Es ging mit der Vergangenheit auf die schlimmste Art und Weise um: Es machte ein Tabu aus ihr. Die Frage ist, was in den neuen Schulbüchern stehen wird."Economist (UK), 13.07.2013
 Der Arabische Frühling ist trotz der jüngsten Entwicklungen kein Fehler gewesen, insistiert der Economist: Zum einen verlaufen demokratische Umwälzungen stets gewalttätig und langwierig, zum anderen beschönigt man die nicht hinnehmbaren Zustände vor den Umstürzen, lautet die Argumentation. Dennoch hält der Economist den Sturz Mursis für das Scheitern einer zentralen Säule jeder kommenden Demokratie in der Region: "Man kann die Muslimbrüder nicht ignorieren. Im Gegenteil, man muss sie im Mainstream absorbieren. Deshalb ist der ägyptische Staatsstreich so tragisch. Wären die Muslimbrüder an der Macht geblieben, hätten sie womöglich den für die Regierung eines Landes notwendigen Pragmatismus und Toleranz gelernt. Stattdessen wurden ihre Vorbehalte gegenüber demokratischer Politik bestärkt. Jetzt ist es an Tunesien, dem ersten arabischen Land, dass sich des Jochs der Autokratie entledigt hat, zu beweisen, dass arabische Islamisten Länder auch anständig regieren können. Das Land befindet sich derzeit auf genau dem Weg, sich eine Verfassung zu geben, die als Grundlage für eine anständige, alle einschließende Demokratie dienen könnte. Sollte sich der Rest der arabischen Welt in diese Richtung bewegen, wird es viele Jahre dauern, dies umzusetzen."
Der Arabische Frühling ist trotz der jüngsten Entwicklungen kein Fehler gewesen, insistiert der Economist: Zum einen verlaufen demokratische Umwälzungen stets gewalttätig und langwierig, zum anderen beschönigt man die nicht hinnehmbaren Zustände vor den Umstürzen, lautet die Argumentation. Dennoch hält der Economist den Sturz Mursis für das Scheitern einer zentralen Säule jeder kommenden Demokratie in der Region: "Man kann die Muslimbrüder nicht ignorieren. Im Gegenteil, man muss sie im Mainstream absorbieren. Deshalb ist der ägyptische Staatsstreich so tragisch. Wären die Muslimbrüder an der Macht geblieben, hätten sie womöglich den für die Regierung eines Landes notwendigen Pragmatismus und Toleranz gelernt. Stattdessen wurden ihre Vorbehalte gegenüber demokratischer Politik bestärkt. Jetzt ist es an Tunesien, dem ersten arabischen Land, dass sich des Jochs der Autokratie entledigt hat, zu beweisen, dass arabische Islamisten Länder auch anständig regieren können. Das Land befindet sich derzeit auf genau dem Weg, sich eine Verfassung zu geben, die als Grundlage für eine anständige, alle einschließende Demokratie dienen könnte. Sollte sich der Rest der arabischen Welt in diese Richtung bewegen, wird es viele Jahre dauern, dies umzusetzen."Rue89 (Frankreich), 14.07.2013
 Rue89 stellt ein interessantes Dossier zu den Fotoausstellungen des jährlichen Festivals in Arles zusammen. Im Hauptartikel verweist Pierre Haski auf sechs der wichtigsten Ausstellungen. Schon letzte Woche berichtete er über die seiner Meinung nach wichtigste dieser Ausstellungen, die Arbeit von Alfredo Jaar, der in der Eglise des Frères-Prêcheurs vor allem weiße Screens zeigt und - in Worten! - die Geschichten einiger Fotografen und Fotos erzählt, etwa die des Fotografen Kevin Carter, der für ein Foto eines sterbenden Kindes im Sudan 1993 einen Pulitzer-Preis bekam - hinter dem Kind wartete ein Geier geduldig auf seinen Moment: "Nach diesem Preis war Carter von Kritikern angegriffen worden. Hatte er dem kleinen Mädchen Überlebenshilfe geleistet? Wozu ist dieses Foto gut, wenn dem Mädchen nicht geholfen wurde? Hat der Fotograf Ästhetik über Solidarität gestellt? Kevin Carter hat das nicht ausgehalten. Er hat sich umgebracht und hinterließ einen Abschiedsbrief: 'Es tut mir leid.' Jaar erzählt diese Geschichte ohne Pathos, und darum bestürzt sie einen noch mehr."
Rue89 stellt ein interessantes Dossier zu den Fotoausstellungen des jährlichen Festivals in Arles zusammen. Im Hauptartikel verweist Pierre Haski auf sechs der wichtigsten Ausstellungen. Schon letzte Woche berichtete er über die seiner Meinung nach wichtigste dieser Ausstellungen, die Arbeit von Alfredo Jaar, der in der Eglise des Frères-Prêcheurs vor allem weiße Screens zeigt und - in Worten! - die Geschichten einiger Fotografen und Fotos erzählt, etwa die des Fotografen Kevin Carter, der für ein Foto eines sterbenden Kindes im Sudan 1993 einen Pulitzer-Preis bekam - hinter dem Kind wartete ein Geier geduldig auf seinen Moment: "Nach diesem Preis war Carter von Kritikern angegriffen worden. Hatte er dem kleinen Mädchen Überlebenshilfe geleistet? Wozu ist dieses Foto gut, wenn dem Mädchen nicht geholfen wurde? Hat der Fotograf Ästhetik über Solidarität gestellt? Kevin Carter hat das nicht ausgehalten. Er hat sich umgebracht und hinterließ einen Abschiedsbrief: 'Es tut mir leid.' Jaar erzählt diese Geschichte ohne Pathos, und darum bestürzt sie einen noch mehr."Chronicle (USA), 10.07.2013
Dass Hollywood zwischen der Machtergreifung der Nazis und dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs keine Filme gegen die Nazis drehte, ist bekannt. Der Historiker Ben Urwand arbeitet nun an einem Buch, in dem er belegen will, dass die Haltung der Studios über finanziell motivierten Opportunismus weit hinausging, wie Alexander C. Kafka berichtet: "Vor allem durch den Vizekonsul des Dritten Reiches in Los Angeles, Georg Gyssling, gaben die Nazi-Hollywood-Beziehungen Hitler und seinem Propagandaminister Joseph Goebbels die effektive Entscheidungsgewalt darüber, welche Filme realisiert, welche Szenen rausgeschnitten, welche Stars und Filmemacher auf die schwarze Liste gesetzt wurden. Dabei verlangten die Deutschen ein Mitspracherecht nicht nur über amerikanische Filme, die in Deutschland gezeigt wurden, sondern überall auf der Welt." Das Buch, obwohl noch gar nicht erschienen, ist bereits heftig umstritten, so Kafka weiter. Auch hatten politische Filme nur einen Bruchteil des Erfolgs Musicals, Komödien oder Western: "Wenn Sie eine Botschaft verschicken möchten, benutzen Sie Western Union", zitiert Kafka Samuel Goldwyn.
El Pais Semanal (Spanien), 14.07.2013
 Bernardo Bertolucci, inzwischen 73 Jahre alt und im Rollstuhl lebend, denkt im Interview über Italien und die Gegenwart nach: "Ich verbringe viel Zeit damit, die Gegenwart zu beobachten. Doch ich beobachte, ohne anwesend zu sein. Ich sehe viel. Und ich habe das Gefühl, dass sich ein sehr starker Wandel vollzogen hat, nur haben wir es nicht bemerkt. Was die Linke angeht: Nach den letzten Wahlen hat sie Selbstmord begangen. Wo lag der Fehler? Ich weiß es nicht. Aber ich würde geradezu von Mutation sprechen. Selbst die Art, Filme zu beurteilen, ist heute völlig anders, was vielleicht daran liegt, dass wir früher nicht ständig mit Bildern bombardiert wurden. Dadurch ist es für einen Film heute viel schwerer, zu überraschen. Als ich 15 war, dachte ich bei dem Wort 'Chinese' an die Chinesen aus Abenteuerromanen. Und ich war so fasziniert, dass ich später nach China gereist bin, um 'Der letzte Kaiser' zu drehen, unvorstellbar, ha ha ha… Aber wie auch immer, in meinem nun schon so langen Leben habe ich viele scheinbar unglaubliche Dinge gesehen und erlebt, und vielleicht ist meine Generation - aber auch die jüngeren Generationen - deshalb unfähig, genau zu begreifen, was vor sich geht. Wir analysieren die Dinge aus einer ein wenig… antiquierten Perspektive."
Bernardo Bertolucci, inzwischen 73 Jahre alt und im Rollstuhl lebend, denkt im Interview über Italien und die Gegenwart nach: "Ich verbringe viel Zeit damit, die Gegenwart zu beobachten. Doch ich beobachte, ohne anwesend zu sein. Ich sehe viel. Und ich habe das Gefühl, dass sich ein sehr starker Wandel vollzogen hat, nur haben wir es nicht bemerkt. Was die Linke angeht: Nach den letzten Wahlen hat sie Selbstmord begangen. Wo lag der Fehler? Ich weiß es nicht. Aber ich würde geradezu von Mutation sprechen. Selbst die Art, Filme zu beurteilen, ist heute völlig anders, was vielleicht daran liegt, dass wir früher nicht ständig mit Bildern bombardiert wurden. Dadurch ist es für einen Film heute viel schwerer, zu überraschen. Als ich 15 war, dachte ich bei dem Wort 'Chinese' an die Chinesen aus Abenteuerromanen. Und ich war so fasziniert, dass ich später nach China gereist bin, um 'Der letzte Kaiser' zu drehen, unvorstellbar, ha ha ha… Aber wie auch immer, in meinem nun schon so langen Leben habe ich viele scheinbar unglaubliche Dinge gesehen und erlebt, und vielleicht ist meine Generation - aber auch die jüngeren Generationen - deshalb unfähig, genau zu begreifen, was vor sich geht. Wir analysieren die Dinge aus einer ein wenig… antiquierten Perspektive." New Yorker (USA), 22.07.2013
 Unter der nun wirklich vielversprechenden Überschrift "Operation Ostern - Auf der Jagd nach kriminellen Eiersammlern" berichtet Julian Rubinstein über die Arbeit schottischer und britischer Oologen - Vogeleierkundler -, denen Eierdiebe das Leben sauer machen. Dabei ist dieser Verstoß gegen den Naturschutz der einzige, der strafrechtlich verfolgt wird. Rubinstein traf Mark Thomas und Guy Shorrock, zwei Ermittler der Royal Society for the Protection of Birds, die berichten: "Die meisten Eiersammler scheinen nicht am Verkauf oder am Handel interessiert zu sein, sondern allein daran, sie zu besitzen. 'Das sind keine normalen Kriminellen', erklärt Shorrock ... 'Aber wir wissen, wer sie sind.' Thomas und Shorrock waren schon bei vielen Sammlern zu Hause, bei manchen mehrmals. Es hat fast etwas von einer großen Familie. Daniel Lingham, der bei sich daheim 3600 Eier gehortet hatte, brach in Tränen aus, als Thomas und die Polizei 2004 bei ihm aufkreuzten. 'Gott sei Dank, dass Sie gekommen sind', sagte er. 'Ich kann einfach nicht damit aufhören.'
Unter der nun wirklich vielversprechenden Überschrift "Operation Ostern - Auf der Jagd nach kriminellen Eiersammlern" berichtet Julian Rubinstein über die Arbeit schottischer und britischer Oologen - Vogeleierkundler -, denen Eierdiebe das Leben sauer machen. Dabei ist dieser Verstoß gegen den Naturschutz der einzige, der strafrechtlich verfolgt wird. Rubinstein traf Mark Thomas und Guy Shorrock, zwei Ermittler der Royal Society for the Protection of Birds, die berichten: "Die meisten Eiersammler scheinen nicht am Verkauf oder am Handel interessiert zu sein, sondern allein daran, sie zu besitzen. 'Das sind keine normalen Kriminellen', erklärt Shorrock ... 'Aber wir wissen, wer sie sind.' Thomas und Shorrock waren schon bei vielen Sammlern zu Hause, bei manchen mehrmals. Es hat fast etwas von einer großen Familie. Daniel Lingham, der bei sich daheim 3600 Eier gehortet hatte, brach in Tränen aus, als Thomas und die Polizei 2004 bei ihm aufkreuzten. 'Gott sei Dank, dass Sie gekommen sind', sagte er. 'Ich kann einfach nicht damit aufhören.'Weitere Artikel: Christine Smallwood bespricht den neuen Roman "Big Brother" der in London lebenden amerikanischen Autorin Lionel Shriver, in dem sie das Schicksal ihres eigenen fettleibigen Bruders verarbeitet. Und Anthony Lane sah im Kino den Science-Fiction-Film "Pacific Rim" von Guillermo del Toro, den Thriller "Only God Forgives" von Nicolas Winding Refn und Joshua Oppenheimers Dokumentarfilm "The Act of Killing".
Kommentieren