Magazinrundschau
Unverkennbar Siebenbürgisch
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
27.07.2010. Die ungarischen Magazine feiern Herta Müllers Roman "Atemschaukel". In den Blättern plädiert Jürgen Habermas für eine Ausweitung des Begriffs der Menschenrechte. Wie ernst oder ironisch ist Nabokovs Gedicht "Pale Fire", fragt Slate. Wie aktuell ist Dostojewski?, fragt Tygodnik Powszechny. Das TLS lernt von der amerikanischen Anarchistin Voltairine de Cleyre, die Liebe nicht durch zu engen Kontakt zu vulgarisieren. Przekroj analysiert den Zustand des türkischen Kinos. In der NYT erklärt Jay Rosen, warum das ewige Gedächtnis des Internets dem schönsten amerikanischen Ideal widerspricht.
Magyar Narancs (Ungarn), 15.07.2010
 Vor kurzem ist die ungarische Übersetzung von Herta Müllers Roman "Atemschaukel" erschienen. Die ungarische Schriftstellerin Noemi Kiss würdigt ihn als Kunstwerk und großartige Prosadichtung: "Wie in ihren früheren Werken, ist ihr Text auch hier durch eine eigenartige Poesie gekennzeichnet; er ist nicht geschmeidig, im Gegenteil: er setzt die konventionelle Rede einer erhöhten Irritation aus. Bei ihr stehen die Sprache und das Erzählte immer derart in einem Einklang, dass ihr Zusammenwirken unangenehm wird. Durch unvergleichbare Bilder und Wortzusammensetzungen erzeugt Herta Müller ihre eigene Poetik - und damit einen deutschen 'Dialekt', der metaphorisch immer dasselbe, die Ausgeliefertheit der an die Peripherie gedrängten Menschen und die Heimatlosigkeit einer Minderheit erzählt."
Vor kurzem ist die ungarische Übersetzung von Herta Müllers Roman "Atemschaukel" erschienen. Die ungarische Schriftstellerin Noemi Kiss würdigt ihn als Kunstwerk und großartige Prosadichtung: "Wie in ihren früheren Werken, ist ihr Text auch hier durch eine eigenartige Poesie gekennzeichnet; er ist nicht geschmeidig, im Gegenteil: er setzt die konventionelle Rede einer erhöhten Irritation aus. Bei ihr stehen die Sprache und das Erzählte immer derart in einem Einklang, dass ihr Zusammenwirken unangenehm wird. Durch unvergleichbare Bilder und Wortzusammensetzungen erzeugt Herta Müller ihre eigene Poetik - und damit einen deutschen 'Dialekt', der metaphorisch immer dasselbe, die Ausgeliefertheit der an die Peripherie gedrängten Menschen und die Heimatlosigkeit einer Minderheit erzählt."Elet es Irodalom (Ungarn), 23.07.2010
 Herta Müller gehörte zur deutschen Minderheit im rumänischen Siebenbürgen. Der Autor Zsolt Lang gehört dort zur ungarischen Minderheit. Aber Herta Müllers Sprache lässt ihn sofort eine gewisse Verwandtschaft erkennen: "Verblüffend ist auch, wie bei Herta Müller die Sprache durch die Rede hindurch sich selbst zuhört. Und diese lauschende Sprache ist unverkennbar Siebenbürgisch. Wenn diese siebenbürgische Sprache den Zug betrachtet, kommt ihr der rumänische 'tren' in den Sinn, der wie die deutsche 'Träne' klingt. Ein Deutscher aus Siebenbürgen sieht im deutschen Wort 'Schaukel' weniger den Wippstuhl, als vielmehr eine hin und her schaukelnde Wiege. Und das rumänische Wort für 'Wiege' (leagăn) weist im Klang wiederum Ähnlichkeiten mit dem Wort 'Lager' auf."
Herta Müller gehörte zur deutschen Minderheit im rumänischen Siebenbürgen. Der Autor Zsolt Lang gehört dort zur ungarischen Minderheit. Aber Herta Müllers Sprache lässt ihn sofort eine gewisse Verwandtschaft erkennen: "Verblüffend ist auch, wie bei Herta Müller die Sprache durch die Rede hindurch sich selbst zuhört. Und diese lauschende Sprache ist unverkennbar Siebenbürgisch. Wenn diese siebenbürgische Sprache den Zug betrachtet, kommt ihr der rumänische 'tren' in den Sinn, der wie die deutsche 'Träne' klingt. Ein Deutscher aus Siebenbürgen sieht im deutschen Wort 'Schaukel' weniger den Wippstuhl, als vielmehr eine hin und her schaukelnde Wiege. Und das rumänische Wort für 'Wiege' (leagăn) weist im Klang wiederum Ähnlichkeiten mit dem Wort 'Lager' auf.""Die dritte Republik geht zu Ende", meint der Verfassungsrechtler Gabor Halmai, nachdem er die Zeichen an der Wand gelesen hat: Die Regierung übernimmt die Kontrolle der Medien, in jüngsten Regierungserklärungen werden die vergangenen zwei Jahrzehnten als "chaotische Zeit des Übergangs" gewertet, die es nun zu überwinden gelte, das Amt des Staatsoberhaupts sowie vakante Posten des Verfassungsgerichts werden mit Parteisoldaten bzw. Vertrauensmännern der Regierungspartei Fidesz besetzt. Besonders traurig sei dabei, so Halmai weiter, dass die Einstellung der Bevölkerung diesen Prozess unterstütze, was bald zu lateinamerikanischen oder russischen Verhältnissen in Ungarn führen könnte: "Wie in diesen Ländern werden auch bei uns die Werte der Rechtsstaatlichkeit von der Mehrheit der Bevölkerung nicht geschätzt. Eine vor kurzem durchgeführte Umfrage ergab, dass die Mehrheit der Befragten 'kein demokratisches Denken aufwies'. 75 Prozent beispielsweise war für eine 'Regierung der harten Hand, die keine Parteidebatten zulässt' und 52 Prozent waren der Meinung, dass es in der heutigen Situation 'einer einzigen, starken, die gesamte Gesellschaft umfassenden Partei' bedürfe. Als Universitätsprofessor habe ich den Eindruck, dass es diesbezüglich auch in den Reihen der künftigen Akademiker nicht viel besser aussieht."
Blätter f. dt. u. int. Politik (Deutschland), 01.08.2010
 Jürgen Habermas plädiert in einem jüngst in Frankfurt gehaltenen Vortrag für eine Ableitung des Begriffs der Menschenrechte aus dem jüngeren Begriff der Menschenwürde um so neue Grundrechte, etwa sozialer Art, in den klassischen Begriff der Menschenrechte einzuführen. "Die Erfahrung verletzter Menschenwürde hat eine Entdeckungsfunktion - etwa angesichts unerträglicher sozialer Lebensverhältnisse und der Marginalisierung verarmter sozialer Klassen; angesichts der Ungleichbehandlung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz, der Diskriminierung von Fremden, von kulturellen, sprachlichen, religiösen und rassischen Minderheiten; auch angesichts der Qual junger Frauen aus Immigrantenfamilien, die sich von der Gewalt eines traditionellen Ehrenkodexes befreien müssen; oder angesichts der brutalen Abschiebung von illegalen Einwanderern und Asylbewerbern. Im Lichte historischer Herausforderungen werden jeweils andere Bedeutungsaspekte der Menschenwürde aktualisiert; diese aus verschiedenen Anlässen spezifizierten Züge der Menschenwürde können dann ebenso zu einer weiter gehenden Ausschöpfung des normativen Gehalts verbürgter Grundrechte wie zur Entdeckung und Konstruktion neuer Grundrechte führen." (Der Artikel ist für eine Woche freigeschaltet.)
Jürgen Habermas plädiert in einem jüngst in Frankfurt gehaltenen Vortrag für eine Ableitung des Begriffs der Menschenrechte aus dem jüngeren Begriff der Menschenwürde um so neue Grundrechte, etwa sozialer Art, in den klassischen Begriff der Menschenrechte einzuführen. "Die Erfahrung verletzter Menschenwürde hat eine Entdeckungsfunktion - etwa angesichts unerträglicher sozialer Lebensverhältnisse und der Marginalisierung verarmter sozialer Klassen; angesichts der Ungleichbehandlung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz, der Diskriminierung von Fremden, von kulturellen, sprachlichen, religiösen und rassischen Minderheiten; auch angesichts der Qual junger Frauen aus Immigrantenfamilien, die sich von der Gewalt eines traditionellen Ehrenkodexes befreien müssen; oder angesichts der brutalen Abschiebung von illegalen Einwanderern und Asylbewerbern. Im Lichte historischer Herausforderungen werden jeweils andere Bedeutungsaspekte der Menschenwürde aktualisiert; diese aus verschiedenen Anlässen spezifizierten Züge der Menschenwürde können dann ebenso zu einer weiter gehenden Ausschöpfung des normativen Gehalts verbürgter Grundrechte wie zur Entdeckung und Konstruktion neuer Grundrechte führen." (Der Artikel ist für eine Woche freigeschaltet.)La regle du jeu (Frankreich), 26.07.2010
Predrag Matvejevitch, einer der bekanntesten Intellektuellen Kroatiens, muss übermorgen vielleicht ins Gefängnis. Er hatte einen ultranationalistischen kroatischen Lyriker als "katholischen Taliban" bezeichnet und wurde von diesem auf Beleidigung verklagt - ein Tatbestand, auf den in Kroatien Gefängnis steht. Bernard-Henri Levys Blog La regle du jeu hat einen Haufen superprominenter Autoren wie Umberto Eco, Claudio Magris und Salman Rushdie um sich geschart, um dagegen zu protestieren. Maria de Franca erzählt, was vorgefallen ist: "Matvejevitch betrachtet diese Strafe als ungerecht und eines Rechtsstaates für unwürdig. Er plädiert für die Freiheit des Wortes und lehnt sich auf gegen das, was er eine 'strafbare Metapher' nennt. Darum legt er nicht Berufung ein. Der Premierminister sieht die steigende Indignation im Ausland und hat sich gegen die Strafe ausgesprochen... Ist es akzeptabel, dass ein Land, das so kurz vor der Aufnahme in die EU steht, jemanden wie einen Kriminellen behandelt, nur weil er öffentlich gegen einen ultranationalistischen Poeten Stellung bezogen hat?" Auch Matvejevitchs Text, der ihm die Klage eingebracht hat ist auf RDJ übersetzt.
Der iranisch-französische Journalist Armin Arefi kommentiert Berichte der Los Angeles Times (hier) über die anhaltend florierenden Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und dem Iran. Trotz jüngst beschlossener Boykottmaßnahmen soll der wirtschaftliche Austausch zwischen den Ländern noch gewachsen sein. Die Times zitiert einen Sprecher der deutsch-iranischen Handelskammer, der die Beziehungen als traditionell und "gewachsen" verteidigt. "Diese 'traditionelle' und 'nachhaltige' Beziehung ist um so problemantischer, wenn man die Rolle Deutschland im Zweiten Weltkrieg und antiisraelischen und negationistischen Diatrieben des iranischen Präisdenten Achmadinedschad bedenkt."
Der iranisch-französische Journalist Armin Arefi kommentiert Berichte der Los Angeles Times (hier) über die anhaltend florierenden Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und dem Iran. Trotz jüngst beschlossener Boykottmaßnahmen soll der wirtschaftliche Austausch zwischen den Ländern noch gewachsen sein. Die Times zitiert einen Sprecher der deutsch-iranischen Handelskammer, der die Beziehungen als traditionell und "gewachsen" verteidigt. "Diese 'traditionelle' und 'nachhaltige' Beziehung ist um so problemantischer, wenn man die Rolle Deutschland im Zweiten Weltkrieg und antiisraelischen und negationistischen Diatrieben des iranischen Präisdenten Achmadinedschad bedenkt."
Slate (USA), 23.07.2010
Etwas großspurig kündigt Ron Rosenbaum in Slate eine neue große Kontroverse um Nabokov an. Anlass ist ihm eine Ausgabe des großen Gedichts "Pale Fire", das vom postmodernenen Kommentarapparat, der das Gedicht im Roman gleichen Namens umgibt, befreit ist. Rosenbaums Frage hinter dem Artikel und der prächtigen Ausgabe: Wie ernst oder ironisch ist Nabokovs Gedicht eigentlich gemeint? "Vielleicht sah Nabokov 'Pale Fire' und Pale Fire zugleich als trenn- und untrennbar. Vielleicht schrieb er das Gedicht zuerst, in der Absicht, dass es um seiner selbst willen gelesen wird, und hatte dann erst die Idee, einen Roman drum herum zu bauen, um damit eine seine großartigsten Romanfiguren, Kinbote, zu schaffen..." Hier der einzige Hinweis auf die Ausgabe der Gingko Press, die auf der Website des Verlags leider nicht angezeigt wird: eine Zeichnung der Buchgestalterin Joan Holabird.
Tygodnik Powszechny (Polen), 25.07.2010
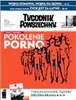 Das Büchermagazin der polnischen Wochenzeitung Tygodnik Powszechny widmet sich schwerpunktmäßig der Renaissance Fjodor M. Dostojewskis in Polen. In seinem lesenswerten Essay "Dostojewski: Reloaded" untersucht der Literaturwissenschaftler Przemyslaw Czaplinski die Aktualität des russischen Schriftstellers: "Es gibt kaum ein Problem unserer Zeit, das Dostojewski nicht schon thematisiert hätte: Freiheit, die Konsequenzen der Existenz beziehungsweise Nichtexistenz Gottes, die Aufopferung des Einzelnen fürs Wohl der Allgemeinheit, Revolution als Aufhebung der Definition vom Menschen. Heutige Dilemmata kann man versuchen zu verstehen, in dem man versucht, seine Romane zu verstehen." Dostojewski habe darin die moderne Welt, als sie Fahrt aufnahm, mit all ihrer Grausamkeit, ihren Utopien und ihrer Gottlosigkeit mit dem christlichen Konzept der Vergebung konfrontiert. Dass man versucht, diesen Zusammenstoß von Unmenschlichkeit und Geist in einen Roman zu verwandeln, wäre eine angemessene Auseinandersetzung mit Dostojewskis Erbe, so Czaplinski.
Das Büchermagazin der polnischen Wochenzeitung Tygodnik Powszechny widmet sich schwerpunktmäßig der Renaissance Fjodor M. Dostojewskis in Polen. In seinem lesenswerten Essay "Dostojewski: Reloaded" untersucht der Literaturwissenschaftler Przemyslaw Czaplinski die Aktualität des russischen Schriftstellers: "Es gibt kaum ein Problem unserer Zeit, das Dostojewski nicht schon thematisiert hätte: Freiheit, die Konsequenzen der Existenz beziehungsweise Nichtexistenz Gottes, die Aufopferung des Einzelnen fürs Wohl der Allgemeinheit, Revolution als Aufhebung der Definition vom Menschen. Heutige Dilemmata kann man versuchen zu verstehen, in dem man versucht, seine Romane zu verstehen." Dostojewski habe darin die moderne Welt, als sie Fahrt aufnahm, mit all ihrer Grausamkeit, ihren Utopien und ihrer Gottlosigkeit mit dem christlichen Konzept der Vergebung konfrontiert. Dass man versucht, diesen Zusammenstoß von Unmenschlichkeit und Geist in einen Roman zu verwandeln, wäre eine angemessene Auseinandersetzung mit Dostojewskis Erbe, so Czaplinski.Die Schriftstellerin Inga Iwasiow setzt sich etwas ironisch mit der polnischen Rezeption des großen russischen Romanciers auseinander: "Der Neid durchmischt sich mit unseren ambivalenten Gefühlen gegenüber der russischen Kultur: Wir lieben und hassen sie, bewundern sie und machen uns über sie lustig. Wir lieben sie so sehr, weil wir sie gleichzeitig kleinreden können, indem wir auf die Grausamkeit verweisen, auf das Lebensniveau, die Verachtung gegenüber dem Menschen, die Sünden an kleineren Nationen. In jedem polnischen Buch findet sich der Satz, dass Dostojewski Polen hasste, aber Polnisch sprach. Das beruhigt uns etwas, denn nichts schmerzt uns so sehr, wie fehlende Sensibilität gegenüber dem Charme unserer Sprache. Dieser ach-so-große Dostojewski kannte, ja: bewunderte wohl heimlich unsere Kultur, er las Mickiewicz, vielleicht kopierte er gar." Die Frage nach dem "polnischen Dostojewski" führt Iwasiow allerdings zur Schlussfolgerung, dass nur eine Schriftstellerin, etwa Zofia Nalkowska, die Tragik der Existenz nach dem 19. Jahrhundert entsprechend nachvollziehen und darstellen konnte.
Außerdem nachzulesen: Grzegorz Jankowicz erzählt die Geschichte von Vladimir Nabokovs Kritik an Dostojewski und seiner Art der Literatur.
Times Literary Supplement (UK), 23.07.2010
"Abenteuerlichen Träumerinnen mit hinreißenden Namen" ist Daphne Spain (!) in Sheila Rowbothams (!) Buch "Women who invented the twentieth century" begegnet. Eine kleine Kostprobe: "Die amerikanische Anarchistin Voltairine de Cleyre, deren Vater sie nach dem Aufklärer benannte, war eine glühende Verfechterin der freien Liebe. Niemals sollte es erlaubt sein, 'die Liebe zu vulgarisieren durch die verbreitete Unanständigkeit eines fortgesetzt engen Kontaktes', behauptete sie, die auch nie besonders erpicht auf Kinder war, sich über mütterliche Instinkte mokierte und die Kinderlosen verteidigte. Dann gab es die britische Autorin Margaret Storm Jameson, die 45 Romane schrieb, bevor sie im Alter von 95 Jahren starb. Und Elsie Clews Parsons, eine Amerikanerin, die über Sex schrieb, bevor es irgendjemand in der besseren Gesellschaft darüber sprach. Die britische Sozialreformerin Clementina Black erklärte, das Fahrrad würde mehr für die Unabhängigkeit der Frauen tun als alles, was explizit diesem Ziel dienen sollte."
"Auch wenn Koestler immer ein Snob war, verhielt er sich niemals so uniform wie einer", hält Jeremy Treglown nach Lektüre von Michael Scammells Arthur-Koestler-Biografie fest. Roger Cardinal liest eine französische Neuausgabe von Lautreamonts schaurigen "Gesängen des Maldoror", die "noch immer sehr erfolgreich "das Verhältnis von Autor und Leser sabotieren, wenn nicht gar die Etikette der Literatur".
"Auch wenn Koestler immer ein Snob war, verhielt er sich niemals so uniform wie einer", hält Jeremy Treglown nach Lektüre von Michael Scammells Arthur-Koestler-Biografie fest. Roger Cardinal liest eine französische Neuausgabe von Lautreamonts schaurigen "Gesängen des Maldoror", die "noch immer sehr erfolgreich "das Verhältnis von Autor und Leser sabotieren, wenn nicht gar die Etikette der Literatur".
Nepszabadsag (Ungarn), 24.07.2010
 "Tararabumbia" - so heißt die Theater-Performance von Dmitri Krymov, die zum 150. Geburtstag Anton Tschechows im Januar in Moskau uraufgeführt wurde - eine Hommage an den Dramatiker, in der auf einem Fließband über 80 Schauspieler in mehr als 300 verschiedenen Kostümen erscheinen - Figuren aus den Werken und aus dem Leben Tschechows, aber auch "Delegationen" aus dem befreundeten Land Shakespeares und dem Karneval von Venedig. Der Dichter und Kritiker Akos Szilagyi hat die Aufführung während des internationalen Tschechow-Festivals Anfang Juni besucht und sieht darin auch eine Parabel auf Russland: "'Tararabumbia' ist mehr als nur der respektlose Respekt, den die Theaterwelt Tschechow zollt. Es ist ein Todesmysterium, ja sogar eine geschichtsphilosophische Parabel, die von dem auf 'das Fließband der Geschichte' montierten Russland handelt. Das Fließband wird immer schneller, das Land steht aber - oder vielmehr: marschiert - an Ort und Stelle. Auch dann, wenn es seine Beine gerade am schnellsten hebt. Weil es niemals die Gesellschaft, die Menschen sind, die es beschleunigen, sondern der Staat. Der Staat ist aber nur in der Lage, das Fließband zu beschleunigen. Die Kostüme und die Schauplätze ändern sich, das Fließband und die Absurdität der Bewegung ohne Vorankommen bleiben die gleichen. Russland ist vorerst nicht in der Lage, vom Fließband abzusteigen, ohne das Fließband würde es in der Unbeweglichkeit erstarren und der Zerfall würde beginnen. Also muss es bewegt werden, und es muss immer vom Staat bewegt werden. Russland bewegt sich nur, wenn es getragen wird. Wenn es vom Fließband bewegt wird. Doch das Fließband führt immer nur in dieselbe Richtung: in den Abgrund."
"Tararabumbia" - so heißt die Theater-Performance von Dmitri Krymov, die zum 150. Geburtstag Anton Tschechows im Januar in Moskau uraufgeführt wurde - eine Hommage an den Dramatiker, in der auf einem Fließband über 80 Schauspieler in mehr als 300 verschiedenen Kostümen erscheinen - Figuren aus den Werken und aus dem Leben Tschechows, aber auch "Delegationen" aus dem befreundeten Land Shakespeares und dem Karneval von Venedig. Der Dichter und Kritiker Akos Szilagyi hat die Aufführung während des internationalen Tschechow-Festivals Anfang Juni besucht und sieht darin auch eine Parabel auf Russland: "'Tararabumbia' ist mehr als nur der respektlose Respekt, den die Theaterwelt Tschechow zollt. Es ist ein Todesmysterium, ja sogar eine geschichtsphilosophische Parabel, die von dem auf 'das Fließband der Geschichte' montierten Russland handelt. Das Fließband wird immer schneller, das Land steht aber - oder vielmehr: marschiert - an Ort und Stelle. Auch dann, wenn es seine Beine gerade am schnellsten hebt. Weil es niemals die Gesellschaft, die Menschen sind, die es beschleunigen, sondern der Staat. Der Staat ist aber nur in der Lage, das Fließband zu beschleunigen. Die Kostüme und die Schauplätze ändern sich, das Fließband und die Absurdität der Bewegung ohne Vorankommen bleiben die gleichen. Russland ist vorerst nicht in der Lage, vom Fließband abzusteigen, ohne das Fließband würde es in der Unbeweglichkeit erstarren und der Zerfall würde beginnen. Also muss es bewegt werden, und es muss immer vom Staat bewegt werden. Russland bewegt sich nur, wenn es getragen wird. Wenn es vom Fließband bewegt wird. Doch das Fließband führt immer nur in dieselbe Richtung: in den Abgrund."Przekroj (Polen), 20.07.2010
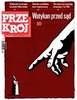 In Wroclaw (Breslau) hat das Filmfestival "Era New Horizons" begonnen. Thematischer Schwerpunkt ist das türkische Kino, das man, schreibt Lukasz Wojcik, in zwei Arten einteilen könne: Das der "besseren", kosmopolitischen, nach Europa strebenden Türkei, und das der "asiatischen" Türkei, die authentisch, aber unberechenbar sei. "Diese zweite Türkei, obwohl zahlenmäßig überlegen, kommt im neuen türkischen Kino nur als Synonym für Religiösität (Rückständigkeit), Konservatismus (Gewalt in der Familie) und Schmutz vor. Die 'bessere' Türkei beherrscht die 'schlechtere' insofern, als das die zweite keine Kinematographie hervor gebracht hat, die im Stande wäre, der Welt ihre Version der Ereignisse zu zeigen." Das, was nach Westen dringe, seien stattdessen Filme von Ümit Ünal oder Pelin Esmer, die ein Land wie aus den Büchern von Orhan Pamuk zeigten - was in Europa leicht verstanden werde. Damit kreieren viele international anerkannte türkische Filmemacher ihr eigenes Bild des Landes und die Macht der Beschreibung liegt weiter in den Händen westlich orientierter Eliten, so Wojcik.
In Wroclaw (Breslau) hat das Filmfestival "Era New Horizons" begonnen. Thematischer Schwerpunkt ist das türkische Kino, das man, schreibt Lukasz Wojcik, in zwei Arten einteilen könne: Das der "besseren", kosmopolitischen, nach Europa strebenden Türkei, und das der "asiatischen" Türkei, die authentisch, aber unberechenbar sei. "Diese zweite Türkei, obwohl zahlenmäßig überlegen, kommt im neuen türkischen Kino nur als Synonym für Religiösität (Rückständigkeit), Konservatismus (Gewalt in der Familie) und Schmutz vor. Die 'bessere' Türkei beherrscht die 'schlechtere' insofern, als das die zweite keine Kinematographie hervor gebracht hat, die im Stande wäre, der Welt ihre Version der Ereignisse zu zeigen." Das, was nach Westen dringe, seien stattdessen Filme von Ümit Ünal oder Pelin Esmer, die ein Land wie aus den Büchern von Orhan Pamuk zeigten - was in Europa leicht verstanden werde. Damit kreieren viele international anerkannte türkische Filmemacher ihr eigenes Bild des Landes und die Macht der Beschreibung liegt weiter in den Händen westlich orientierter Eliten, so Wojcik.Nur im Print: ein Gespräch mit Krzysztof Wodiczko, der in Wroclaw anlässlich des Festivals seine Projekte mit Irakkriegsveteranen weiter entwickelt. Ihm gehe es nicht um Kunst, gesteht er zum Ende des Interviews, sondern darum, das Leben zu beeinflussen. Und: Nachdem er als Werbetexter zu Geld gekommen ist, startete Rafal Betlejewski seine Karriere als Aktionskünstler. Anfang des Jahres erregte er mit seiner Aktion "Du fehlst mir, Jude" große Aufmerksamkeit (mehr dazu hier). Sein neuestes Projekt: die Verbrennung einer Scheune zum 69. Jahrestag des Mordes von Jedwabne, stieß auf breite Kritik: "Eine solche, im Fernsehen live übertragene, Aktion führt nicht zu einer Reflexion darüber, was die Opfer erlebt haben. In einer Picknickatmosphäre kann man die Wahrheit über lebendig verbrannte Menschen nicht berühren", sagte ein Vertreter der jüdischen Minderheit. Ein wichtiges Tabu sprach Betlejewski jedoch an: Viele polnische Künstler meiden bis heute das Thema Holocaust.
Prospect (UK), 21.07.2010
Peter Jukes hat ein langes Porträt des sozialdemokratisch-linken Historikers, vom Zionisten zum Anti-Zionisten gewandelten Juden und nach seiner ALS-Erkrankung inzwischen komplett gelähmten, seitdem aber fast noch öffentlicheren Intellektuellen Tony Judt verfasst. Es beruht unter anderem auf einem E-Mail-Interview aus diesem Jahr, das ebenfalls komplett nachzulesen und hoch interessant ist. Neben vielen anderen Dingen geht es darin auch um die Rolle des öffentlichen Intellektuellen. Judt erklärt: "Paradoxerweise sind öffentliche Intellektuelle dann am besten, wenn sie ein Fundament in einer spezifischen Sprache, Kultur und Debatte haben. So war Camus Franzose, Habermas ist Deutscher, Sen ist Bengale und Orwell war zutiefst Englisch. Das machte ihre grenzüberschreitenden Unternehmungen plausibel, ganz genauso wie Havel oder Michnik ihre street credibility der Herkunft als mutige Dissidenten an einem sehr spezifischen Ort und zu einer spezifischen Zeit hatten. Das Gegenteil ist der lächerliche Slavoj Zizek: ein 'globaler' öffentlicher Intellektueller, der deshalb nirgendwo und zu gar keinem Thema von besonderem Interesse ist. Wenn er die Zukunft des öffentlichen Intellektuellen ist, dann gibt es keine."
Polityka (Polen), 23.07.2010
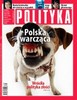 Nichtreligiöse Kinder haben es schwer auf polnischen Schulen. Das könnte sich jetzt ändern, berichtet Joanna Podgorska (hier auf Deutsch). Ein polnisches Elternpaar hat vor dem Europäischen Gerichtshof wegen Diskriminierung geklagt, weil ihrem Sohn an der Schule nicht Ethikunterricht als Ausweichfach angeboten wird und Recht bekommen: "'Jahrelang hat der Gerichtshof sich bemüht, nicht in die delikate Angelegenheit des Verhältnisses von Staat und Kirche einzugreifen', erklärt Dr. Adam Bodnar, Sekretär der Helsinki-Föderation für Menschenrechte, die die Grzelaks in Straßburg unterstützt hat. 'In letzter Zeit hat sich jedoch die Situation verändert. Die Richter sind der Meinung, dass die Rechte und Bedürfnisse konfessionsloser Menschen nicht länger ignoriert werden dürfen. Ein Durchbruch war der Fall eines Kruzifixes, das in einer italienischen Schule angebracht war.' Der Fall der Grzelaks zog sich acht Jahre hin, doch das Urteil des Gerichtshofes ist eindeutig. Der Strich auf dem Zeugnis in der Rubrik Religion/Ethik ist eine Form der Diskriminierung."
Nichtreligiöse Kinder haben es schwer auf polnischen Schulen. Das könnte sich jetzt ändern, berichtet Joanna Podgorska (hier auf Deutsch). Ein polnisches Elternpaar hat vor dem Europäischen Gerichtshof wegen Diskriminierung geklagt, weil ihrem Sohn an der Schule nicht Ethikunterricht als Ausweichfach angeboten wird und Recht bekommen: "'Jahrelang hat der Gerichtshof sich bemüht, nicht in die delikate Angelegenheit des Verhältnisses von Staat und Kirche einzugreifen', erklärt Dr. Adam Bodnar, Sekretär der Helsinki-Föderation für Menschenrechte, die die Grzelaks in Straßburg unterstützt hat. 'In letzter Zeit hat sich jedoch die Situation verändert. Die Richter sind der Meinung, dass die Rechte und Bedürfnisse konfessionsloser Menschen nicht länger ignoriert werden dürfen. Ein Durchbruch war der Fall eines Kruzifixes, das in einer italienischen Schule angebracht war.' Der Fall der Grzelaks zog sich acht Jahre hin, doch das Urteil des Gerichtshofes ist eindeutig. Der Strich auf dem Zeugnis in der Rubrik Religion/Ethik ist eine Form der Diskriminierung."New York Times (USA), 25.07.2010
 Das Netz vergisst nichts. Keine Fotos, auf denen wir besoffen posieren, keine albernen Bemerkungen, keine dummen Kommentare. Und damit haben wir ein Problem, stellt der Journalismusprofessor (Korrektur: nicht Juraprofessor) Jay Rosen im Magazine fest, denn dieses Nichtvergessen ist total unamerikanisch: "Wir wissen seit Jahren, dass das Web beispiellosen Voyeurismus, Exhibitionismus und versehentliche Indiskretion erlaubt, aber wir beginnen erst jetzt zu verstehen, was uns ein Zeitalter kostet, in dem so viel von dem was wir sagen und was andere über uns sagen in permanenten und digitalen Dateien landet. Die Tatsache, dass das Internet nie vergisst, bedroht auf einem geradezu existenziellem Level unsere Fähigkeit, unsere Identitäten zu kontrollieren; und uns die Möglichkeit offenzuhalten, uns neu zu erfinden und von vorn anzufangen; unsere gefleckten Vergangenheiten zu überwinden." Rosen beschreibt detailliert, was für technische Möglichkeiten es demnächst geben wird, uns auszuspionieren, und die Strategien, die dagegen entwickelt werden. Aber viel helfen wird es nicht, fürchtet er.
Das Netz vergisst nichts. Keine Fotos, auf denen wir besoffen posieren, keine albernen Bemerkungen, keine dummen Kommentare. Und damit haben wir ein Problem, stellt der Journalismusprofessor (Korrektur: nicht Juraprofessor) Jay Rosen im Magazine fest, denn dieses Nichtvergessen ist total unamerikanisch: "Wir wissen seit Jahren, dass das Web beispiellosen Voyeurismus, Exhibitionismus und versehentliche Indiskretion erlaubt, aber wir beginnen erst jetzt zu verstehen, was uns ein Zeitalter kostet, in dem so viel von dem was wir sagen und was andere über uns sagen in permanenten und digitalen Dateien landet. Die Tatsache, dass das Internet nie vergisst, bedroht auf einem geradezu existenziellem Level unsere Fähigkeit, unsere Identitäten zu kontrollieren; und uns die Möglichkeit offenzuhalten, uns neu zu erfinden und von vorn anzufangen; unsere gefleckten Vergangenheiten zu überwinden." Rosen beschreibt detailliert, was für technische Möglichkeiten es demnächst geben wird, uns auszuspionieren, und die Strategien, die dagegen entwickelt werden. Aber viel helfen wird es nicht, fürchtet er.
Kommentieren







