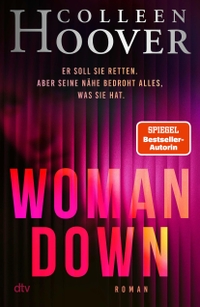Magazinrundschau
Die Magazinrundschau
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
05.01.2004. Arthur Miller staunt in The Nation über Castros Verlangen nach Liebe. Auch Schweine weinen, behauptet Jeremy Rifkin im Espresso. Folio weiß, wo Sterben strafbar ist. Der New Yorker porträtiert Howard Dean. Die New York Times Book Review liegt Stephen King zu Füßen. Clarin erinnert an die Zapatistas. "Es gibt nichts Nervenderes als den Akt", erklärt Gerard Depardieu in Le Point.
The Nation | Economist | Times Literary Supplement | New York Times | Espresso | New Yorker | London Review of Books | Clarin | Point | Folio | Radar | Spiegel
The Nation (USA), 12.01.2004
 Im März 2000 besuchte Arthur Miller zusammen mit einer kleinen Gruppe "Auserwählter" Kuba. Darüber hat er jetzt ein Buch geschrieben ("Cuba on the Verge: An Island in Transition", Bulfinch), aus dem The Nation den Epilog veröffenlicht. Hier sein erster Blick auf Fidel Castro: "Abgesehen von seinem Anzug war mein erster Eindruck, wenn er kein revolutionärer Politiker geworden wäre, hätte er auch gut ein Filmstar werden können. Er hat diese absolut Selbstbesessenheit, dieses Verlangen nach Liebe und Zustimmung und den überwältigenden Machthunger, der aus totaler Zustimmung entsteht. In diesem überfüllten Vorzimmer war sein Gefolge, wie bei den meisten Führern auf der Welt, außerordentlich liebenswürdig, und man spürte sofort, dass sie dem Führer absolut ergeben waren. Was immer er sonst ist, Castro ist eine aufregende Person und hätte vermutlich eine Karriere auf der Leinwand machen können."
Im März 2000 besuchte Arthur Miller zusammen mit einer kleinen Gruppe "Auserwählter" Kuba. Darüber hat er jetzt ein Buch geschrieben ("Cuba on the Verge: An Island in Transition", Bulfinch), aus dem The Nation den Epilog veröffenlicht. Hier sein erster Blick auf Fidel Castro: "Abgesehen von seinem Anzug war mein erster Eindruck, wenn er kein revolutionärer Politiker geworden wäre, hätte er auch gut ein Filmstar werden können. Er hat diese absolut Selbstbesessenheit, dieses Verlangen nach Liebe und Zustimmung und den überwältigenden Machthunger, der aus totaler Zustimmung entsteht. In diesem überfüllten Vorzimmer war sein Gefolge, wie bei den meisten Führern auf der Welt, außerordentlich liebenswürdig, und man spürte sofort, dass sie dem Führer absolut ergeben waren. Was immer er sonst ist, Castro ist eine aufregende Person und hätte vermutlich eine Karriere auf der Leinwand machen können."Espresso (Italien), 08.01.2004
 Das Geheimnis des Glücks, verkündet Giovanni Zucconi, hat nichts mit Geld zu tun, sondern mit "Chaos und Liebe". Das haben (nicht nur italienische) Ökonomen ausgerechnet. Glücklicher wird auch, wer sich öffentlich engagiert. "Nach einer langen Periode, von der zweiten Hälfte der Siebziger bis zum Ende der Neunziger, in der die Indikatoren des Privaten und der Subjektivität (der Kult des Unternehmens, die Mystifikation des Individuums, der Hedonismus) überwogen, ist der Zyklus des privaten Glücks nun an seinem Ende angelangt." Also raus auf die Straße und gegen Berlusconi marschiert! Macht glücklich.
Das Geheimnis des Glücks, verkündet Giovanni Zucconi, hat nichts mit Geld zu tun, sondern mit "Chaos und Liebe". Das haben (nicht nur italienische) Ökonomen ausgerechnet. Glücklicher wird auch, wer sich öffentlich engagiert. "Nach einer langen Periode, von der zweiten Hälfte der Siebziger bis zum Ende der Neunziger, in der die Indikatoren des Privaten und der Subjektivität (der Kult des Unternehmens, die Mystifikation des Individuums, der Hedonismus) überwogen, ist der Zyklus des privaten Glücks nun an seinem Ende angelangt." Also raus auf die Straße und gegen Berlusconi marschiert! Macht glücklich.Jeremy Rifkin, Autor und Präsident der Foundation on Economic Trends in Washington, freut sich über die nun wissenschaftlich belegte Erkenntnis, dass alle Tiere Gefühle haben. Die Einsicht, dass "auch Schweine weinen", bedeute eine "neue Phase in der Entwicklung der Menschheit". Pikanterweise wurden die betreffenden Studien von Fast-Food-Konzernen in Auftrag gegeben, die allerdings über die Ergebnisse nicht sehr erfreut sein dürften.
Natürlich wird der Zusammenbruch des Parmalat-Konzerns diskutiert. Im Aufmacher erregt sich Massimo Riva über die unnützen Streitereien der Kreditgeber. Und Michele Serra erzählt in einer bösen Glosse, wie mit der "legendären Kuh Nummer eins" alles angefangen hat. "Erschöpft vom Konsum von 50 Litern Milch am Tag und zerrüttet von Koliken, hat Tanzi eine wahrhaft geniale Idee: warum die Milch nicht verkaufen?"
Außerdem druckt der Espresso das Manifest der Sozialökologin Vandana Shiva (mehr zu ihrem Insitut RFSTE) ab, in dem sie eine "Demokratie der Erde" fordert, die die absterbenden Wirtschafts- und Politikformen der Gegenwart durch eine unbedingte Souveränität der Bürger ersetzen soll. Riccardo Bocca schlägt Alarm: Immer mehr bedenkliche chemische Verbindungen werden verarbeitet, ohne dass wir etwas davon erfahren. Monica Maggi erklärt, wie erotische Ikonen wie Marilyn Monroe unsterblich werden: Als Barbie-Puppe.
New Yorker (USA), 12.01.2004
 Mark Singer porträtiert Howard Dean, den "instinktgesteuerten" Präsidentschaftskandidaten der Demokraten (hier seine offizielle Website). Darin ist natürlich alles zu erfahren, was es überhaupt nur zu erfahren gibt, von Deans Park-Avenue-Kindheit bis zu seiner Zeit als Gouverneur von Vermont. Singer zeichnet das Bild eines Politikers, der vielleicht nicht gerade dickschädelig ist, sich aber doch ziemlich wohl in seiner eigenen Haut fühlt - und der sich von seinen Parteirivalen nicht verunsichern lässt: "Berüchtigt die Rede vom Dezember, in der Dean erklärte, die Gefangennahme von Saddam habe Amerika nicht sicherer gemacht. Liebermann antwortete als erster; in einer ätzenden Erklärung bemerkte er, dass sich Dean in seinem eigenen Spinnennetz der Verleugnung verheddert hätte. Kerry und Clark gaben ähnlich starke Verurteilungen ab, aber Dean weigerte sich, zurückzustecken. Tatsächlich verschärfte er noch seine Rhetorik. In einer Rede zwei Wochen später, bemerkte er vor einem Publikum in Iowa, dass die Regierung die nationale Sicherheitsstufe auf 'hohes Risiko' angehoben habe, Code Orange. 'Wenn wir jetzt sicherer sind, wie kommt es, dass wir noch einmal zehn Soldaten verloren haben und Sicherheitsalarm ausrufen mussten?'"
Mark Singer porträtiert Howard Dean, den "instinktgesteuerten" Präsidentschaftskandidaten der Demokraten (hier seine offizielle Website). Darin ist natürlich alles zu erfahren, was es überhaupt nur zu erfahren gibt, von Deans Park-Avenue-Kindheit bis zu seiner Zeit als Gouverneur von Vermont. Singer zeichnet das Bild eines Politikers, der vielleicht nicht gerade dickschädelig ist, sich aber doch ziemlich wohl in seiner eigenen Haut fühlt - und der sich von seinen Parteirivalen nicht verunsichern lässt: "Berüchtigt die Rede vom Dezember, in der Dean erklärte, die Gefangennahme von Saddam habe Amerika nicht sicherer gemacht. Liebermann antwortete als erster; in einer ätzenden Erklärung bemerkte er, dass sich Dean in seinem eigenen Spinnennetz der Verleugnung verheddert hätte. Kerry und Clark gaben ähnlich starke Verurteilungen ab, aber Dean weigerte sich, zurückzustecken. Tatsächlich verschärfte er noch seine Rhetorik. In einer Rede zwei Wochen später, bemerkte er vor einem Publikum in Iowa, dass die Regierung die nationale Sicherheitsstufe auf 'hohes Risiko' angehoben habe, Code Orange. 'Wenn wir jetzt sicherer sind, wie kommt es, dass wir noch einmal zehn Soldaten verloren haben und Sicherheitsalarm ausrufen mussten?'"Die "Schlachten um das alte Athen toben noch immer", stellt Daniel Mendelsohn in seiner Rezension neuer Publikation über die Kriege der alten Griechen fest. Besonders ausführlich widmet er sich einer Studie über den "Peleponnesischen Krieg" (Einführung) von Donald Kagan. Dessen "energische, wenn auch tendenziöse" neue These: Der Krieg habe seinen Namen nur deshalb, weil die "Männer, die den Konflikt beschrieben haben, gewöhnlich Athener" waren. "Die Spartaner betrachteten den Konflikt wahrscheinlich als Athenischen Krieg".
Weiteres: Die Erzählung "Daisy" schrieb in dieser Woche Chang-rae Lee. Joan Accocella stellt den Steptänzer Savion Glover (mehr) vor. David Owen stellt "acht einfache Regeln" auf, die der neue Liebhaber seiner Geschiedenen gefälligst zu beachten hat ("The band saw in the basement belongs to me. You are not to use it, you are not to move it, you are not to put anything on it ..."). Ben McGrath schildert in einem Bericht über so genannte Messies den Fall eines pathologischen Hamsteres, der in seinem Miniappartement in Brooklyn "die vielleicht größte und bestsortierte private Zeitschriftensammlung der Stadt" hortete. Louis Menand staunt über die hohe Kunst - wenn nicht Manie - der "Top Ten"- Listen.
Die Kurzbesprechungen widmen sich unter anderem dem neuen Buch von Paul Auster, "Oracle Nights" (Henry Holt). Und David Denby sah zwei neue Filme: die Romanverfilmung "House of Sand and Fog" von Vadim Perelman, in der Ben Kingsley einen exilierten iranischen Ex-Oberst spielt, und "The Cooler", ein "schwer sentimentales B-Movie wie aus den Fünfzigern" von Wayne Kramer.
Nur in der Printausgabe: eine Reportage über den seit zehn Jahren währenden Kampf gegen "tückischen Müll", ein Bericht über Kinderlähmung, die endlich besiegt scheint, eine Warnung vor der "falschen Sicherheit" von Geländewagen ("groß und schlecht") und Lyrik von Wislawa Szymborska und Bill Knott.
London Review of Books (UK), 08.01.2004
 Nicholas Spice nimmt die englische Neuausgabe der Freudschen "Laienanalyse" ("Wild Analysis") zum Anlass, über die seltsam entrückte Beziehung zwischen Analytiker und Patient nachzudenken. Seltsam, weil sie vollends unreal inszeniert ist, aber doch Raum schafft, sich mit realen Beziehungen auseinanderzusetzen, immer jedoch mit dem riesigen Gefälle zwischen dem sich bis aufs Hemd entblößenden Patienten und dem unangreifbaren Analytiker: "Jeden Patienten verfolgt unweigerlich der alte Witz von dem Mann, der zu einem Analytiker geht, um über seinen Minderwertigkeitskomplex zu klagen, und dem nach der Sitzung gesagt wird: 'Herr Schmidt, Sie sind tatsächlich minderwertig.'"
Nicholas Spice nimmt die englische Neuausgabe der Freudschen "Laienanalyse" ("Wild Analysis") zum Anlass, über die seltsam entrückte Beziehung zwischen Analytiker und Patient nachzudenken. Seltsam, weil sie vollends unreal inszeniert ist, aber doch Raum schafft, sich mit realen Beziehungen auseinanderzusetzen, immer jedoch mit dem riesigen Gefälle zwischen dem sich bis aufs Hemd entblößenden Patienten und dem unangreifbaren Analytiker: "Jeden Patienten verfolgt unweigerlich der alte Witz von dem Mann, der zu einem Analytiker geht, um über seinen Minderwertigkeitskomplex zu klagen, und dem nach der Sitzung gesagt wird: 'Herr Schmidt, Sie sind tatsächlich minderwertig.'" Nicht die Medikamente sind es, die uns heilen, sondern die Ärzte, verkündet Carl Elliott nach der Lektüre von Daniel Moermans Buch "Meaning, Medicine and the 'Placebo Effect'". In der Tat sprechen die von Moerman angeführten Studien über Plazebowirkung eine deutliche Sprache: Entscheidend für die Heilung des Patienten sei demnach, ob der Arzt dem von ihm verabreichten Mittel vertraut.
Weitere Artikel: Auch die jüngsten israelisch-palästinensischen Annäherungsversuche in Genf sind für Ilan Pappe bloß eine weitere Friedensblase, denn bei genauerem Hinsehen entpuppen sich die Vorschläge als unzeitgemäß und indiskutabel. Peter Campbell hat vor Gerhard Richters Bildern in der Londoner Whitechapel (mehr hier) erahnt, worum es in der Malerei überhaupt geht. Zuguterletzt wühlt Thomas Jones in Diktatorenbunkern und hält einige Unterschiede fest: "Anders als Frau Hitler haben es Saddam Husseins Ehefrauen vermieden, das Schicksal ihres Mannes zu teilen.
Leider nur im Print zu lesen: Michael Byers prophezeit, dass Saddam Husseins Prozess die ultimative Gerichtsshow werden wird, und Alan Bennett blickt auf ein peinliches Jahr 2003 zurück.
Clarin (Argentinien), 03.01.2004
 Die Literaturbeilage der argentinischen Zeitung Clarin erinnert an den Jahrestag des Zapatisten-Aufstandes in Mexiko. Genau zehn Jahren ist es nun her, seitdem am.1.1.1994 die Zapatistische Nationale Befreiungsarmee (EZLN) mit einem Aufstand im abgelegenen Chiapas die nationale und internationale Öffentlichkeit verblüffte. In einer Bilanz distanziert sich der mexikanische Essayist Carlos Monsivais zwar von der anhaltenden Rechtfertigung aufständischer Gewalt, bescheinigt dem Subcomandante Marcos und seinen indianischen Kämpfern aber, dass sie "Chiapas zu einem Synonym für Widerstand gegen den Neoliberalismus und seine ausbeuterischen Unternehmen" gemacht haben. Zudem habe die EZLN das Bewusstsein für die schwierige Lage der indianischen Bevölkerung und den auch in Mexiko grassierenden Rassismus geschärft. Die Beziehungen der eher friedlichen Guerilleros zu anderen sozialen Gruppen seien zwar mitunter schwierig, die Aufständischen hätten jedoch trotzdem, vor allem 2001, "die größte zivilgesellschaftliche Mobilisierung der Geschichte Mexikos" zustande gebracht. Dem zehnten Jahrestag der EZLN hat auch die mexikanische Tageszeitung La Jornada mehrere Sonderseiten gewidmet (hier und hier).
Die Literaturbeilage der argentinischen Zeitung Clarin erinnert an den Jahrestag des Zapatisten-Aufstandes in Mexiko. Genau zehn Jahren ist es nun her, seitdem am.1.1.1994 die Zapatistische Nationale Befreiungsarmee (EZLN) mit einem Aufstand im abgelegenen Chiapas die nationale und internationale Öffentlichkeit verblüffte. In einer Bilanz distanziert sich der mexikanische Essayist Carlos Monsivais zwar von der anhaltenden Rechtfertigung aufständischer Gewalt, bescheinigt dem Subcomandante Marcos und seinen indianischen Kämpfern aber, dass sie "Chiapas zu einem Synonym für Widerstand gegen den Neoliberalismus und seine ausbeuterischen Unternehmen" gemacht haben. Zudem habe die EZLN das Bewusstsein für die schwierige Lage der indianischen Bevölkerung und den auch in Mexiko grassierenden Rassismus geschärft. Die Beziehungen der eher friedlichen Guerilleros zu anderen sozialen Gruppen seien zwar mitunter schwierig, die Aufständischen hätten jedoch trotzdem, vor allem 2001, "die größte zivilgesellschaftliche Mobilisierung der Geschichte Mexikos" zustande gebracht. Dem zehnten Jahrestag der EZLN hat auch die mexikanische Tageszeitung La Jornada mehrere Sonderseiten gewidmet (hier und hier).Point (Frankreich), 01.01.2004
Le point bringt ein schönes langes Gespräch mit Gerard Depardieu, der seinen katholischen Glauben bekennt (er hat jüngst vor 3.000 Zuhörern im Straßburger Münster aus den Bekenntnissen des Augustinus gelesen), über seine Freundschaft zu Castro spricht ("Ich weiß, dass er ein Diktator ist, und ich würde nicht gern in seinen Kerkern hocken") und Sex doof findet: "Sex hat mich nie wirklich angezogen. Es gibt nichts Nervenderes als den Akt, und ich bin kein Eroberer... Was ich dagegen liebe, ist davon zu sprechen, denn die Sprache der Sexualität ist Poesie. Apollinaire hat bestimmt nicht ein Viertel von dem getan, worüber er in seinen Briefen an Lou schreibt. Aber er hat geliebt, und die Liebe hat mich immer interessiert." Depardieu spielt in seinem neuesten Film "Nathalie" von Anne Fontaine den ermüdeten Mann einer Frau (Fanny Ardant), die ihn mit Hilfe einer Prostituierten (Emmanuelle Beart) wieder auf Trab bringt.
Folio (Schweiz), 05.01.2004
 In dieser Ausgabe: Alles über Verbrechen und Strafe.
In dieser Ausgabe: Alles über Verbrechen und Strafe.Dass auch in der Gesetzgebung nicht immer alles mit rechten Dingen zuzugehen scheint, beweist der Potpourri kurioser Gesetze, den mehrere NZZ-Korrespondenten aus aller Welt zusammengestellt haben. Kostprobe gefällig? In Kennesaw im US-Staat Georgia ist es die gesetzliche Pflicht eines jeden Bürgers, sich zu bewaffnen. "Jeder Haushalt des 21 000-Seelen-Ortes, so beschloss der Stadtrat 1982, muss eine funktionstüchtige Schusswaffe samt Patronen griffbereit haben, ausgenommen sind Vorbestrafte, geistig oder körperlich Behinderte und Patienten unter Einfluss von Medikamenten." Außer Obskurem gibt es auch Geistvolles. Im französischen Küstenort Le Lavandou ist Sterben strafbar: "Personen, die auf dem Friedhof über keinen bereits reservierten Grabplatz verfügen und trotzdem in Le Lavandou begraben zu werden wünschen, ist das Sterben untersagt." Doch keine Bange, hier ist das Gesetz schlicht Protest gegen die übergeordnete Verwaltung, die kein weiteres Friedhofsgelände freigibt. Bleibt nur noch die Frage, wie das Sterben geahndet wird. Lebenslänglich, wahrscheinlich.
Weitere Artikel: Markus Hofmann erzählt ausführlich von der Zähmung der Rache, oder wie wir im Laufe der Geschichte das Prinzip "Auge um Auge, Zahn um Zahn" verfeinert haben. Andreas Dietrich berichtet über den skurrilen Fall eines Bankräubers, der für sich ein höheres Strafmaß forderte, als der Staatsanwalt. Viviane Manz erkundet die umstrittene Rolle der Psychiatrie in der Rechtspraxis. Und schließlich stellt Andrea Köhler den Gefängnisarchitekten James Kessler vor, für den die Gefängnisinsassen nicht noch zusätzlich von der Hässlichkeit des Gebäudes gestraft werden sollten.
Last but not least, Luca Turin nimmt es wörtlich mit der Duftnote. Er hüllt Männer in Frauendüfte und es riecht nach Musik: "Doktor Schiwago", Satie, Janacek... Aber niemals lauter als mezzoforte.
Radar (Argentinien), 04.01.2004
In Argentinien ist ein aufsehenerregender Film namens "Ay Juancito" abgedreht worden. Es geht um die Geschichte eines korrupten, aber liebenswerten Lebemannes: Juan Duarte. Der Bruder der legendären Evita war in den fünfziger Jahren zugleich Privatsekretär ihres Ehemanns, des argentinischen Präsidenten Juan Domingo Peron. Der Film beginnt und endet mit einer schauderlichen, aber leider wahren Szene. "Juan Duarte starb neun Monate nach seiner Schwester (?). Sein Leichnam wurde exhumiert und sein abgetrennter Kopf dann im Polizeihauptquartier und im Kongress zur Schau gestellt", berichtet Luis Bruschtein. "Ich habe mich gefragt, warum es möglich war, dass die Italiener so viele wunderbare Filme über die Mussolini-Ära drehten, und die Spanier über die Ära Francos, während wir Argentinier die fünfziger Jahre kaum verwertet haben", erklärt Regisseur Hector Olivera seine Beweggründe.
Der ehemalige fliegende Händler Juan Duarte wurde praktisch von der Straße weg die rechte Hand des Präsidenten und wusste dies auch zur persönlichen Bereicherung zu nutzen. Er bestach aber auch als ausgebuffter Playboy und Begründer der argentinischen Filmförderung. Dass er überhaupt zum Privatsekretär ernannt wurde, erklärt sich Drehbuchautor Jose Pablo Feinmann im Interview als "ein gelungenes Ehemanöver" von Evita, die somit immer bestens über das Treiben ihres Gatten informiert war. Wie am Rande zu erfahren ist, hat übrigens Argentiniens derzeitiger Präsident, Nestor Kirchner, schon einmal für Hector Olivera gearbeitet: 1974 heuerte er als Statist in einem Film über Anarchisten in Patagonien an.
Lesenswert auch ein Vorabdruck aus "Sechzig Wochen in den Tropen", einem Reisebericht des spanischen Soziologen Antonio Escohotado. Der ist unter anderem Autor einer dreibändigen Geschichte der Drogen (mehr) und im spanischen Raum sehr bekannt. Im Jahr 2000 vermasselte er seine Ehe und flüchtete voller Gewissensbisse nach Asien. Zuvor hatte er bei seiner Universität ein Forschungsprojekt mit dem schönen Titel "Ursachen von Armut und Reichtum im Orient und Okzident" eingereicht. Seine Feldforschung scheint sich jedoch darauf beschränkt zu haben, an Marihuana, Heroin und andere Drogen heranzukommen und sich zudem in den einschlägigen Rotlichtvierteln Thailands, Vietnams, Birmas und Singapurs herumzutreiben. Wie einfältig er das erzählt, sagt viel darüber aus, wie kolonialistisch sich manche Spanier noch heute in der Welt aufführen. "Der Saigoner neigt zum Betrügen, kompensiert das aber mit Fleiß und Geistesgegenwart; sein Eifer macht ihn daher zu einem nützlichen Begleiter", schreibt Escohotado allen Ernstes über seine Gastgeber in der Hauptstadt Vietnams.
Allemal angenehmere Zeitgenossen sind da Moreno Veloso, Domenico Lancelotti und Kassin, drei junge Männer, die derzeit Brasiliens Musikszene aufmischen und mit ihrer wahlweise Moreno +2, Domenico +2 und Kassin +2 genannten Band bereits zwei hochgelobte Alben veröffentlicht haben. Der Clou dabei: sie sind ganz unmittelbar die zweite Generation der hierzulande hauptsächlich durch den älteren Bossa nova bekannten Populärmusik Brasiliens, kurz MPB genannt. Moreno ist Sohn des herausragenden Caetano Veloso, während Domenico den Komponisten Ivor Lancelotti seinen Vater nennt. Begonnen haben alle drei mit experimentellem Rock: "Mein Vater beschwerte sich, ihm gefiel das gar nicht; mein Haus war eine Art Hauptquartier der MPB, es war furchtbar", erzählt Domenico. Wie seine Kollegen ist er ein begeisterter Björk-Fan. Solcherlei musikalische Einflüsse verarbeiten sie nun in ihrer eigenen Rezeption des schier unerschöpflichen musikalischen Reichtums Brasiliens.
Der ehemalige fliegende Händler Juan Duarte wurde praktisch von der Straße weg die rechte Hand des Präsidenten und wusste dies auch zur persönlichen Bereicherung zu nutzen. Er bestach aber auch als ausgebuffter Playboy und Begründer der argentinischen Filmförderung. Dass er überhaupt zum Privatsekretär ernannt wurde, erklärt sich Drehbuchautor Jose Pablo Feinmann im Interview als "ein gelungenes Ehemanöver" von Evita, die somit immer bestens über das Treiben ihres Gatten informiert war. Wie am Rande zu erfahren ist, hat übrigens Argentiniens derzeitiger Präsident, Nestor Kirchner, schon einmal für Hector Olivera gearbeitet: 1974 heuerte er als Statist in einem Film über Anarchisten in Patagonien an.
Lesenswert auch ein Vorabdruck aus "Sechzig Wochen in den Tropen", einem Reisebericht des spanischen Soziologen Antonio Escohotado. Der ist unter anderem Autor einer dreibändigen Geschichte der Drogen (mehr) und im spanischen Raum sehr bekannt. Im Jahr 2000 vermasselte er seine Ehe und flüchtete voller Gewissensbisse nach Asien. Zuvor hatte er bei seiner Universität ein Forschungsprojekt mit dem schönen Titel "Ursachen von Armut und Reichtum im Orient und Okzident" eingereicht. Seine Feldforschung scheint sich jedoch darauf beschränkt zu haben, an Marihuana, Heroin und andere Drogen heranzukommen und sich zudem in den einschlägigen Rotlichtvierteln Thailands, Vietnams, Birmas und Singapurs herumzutreiben. Wie einfältig er das erzählt, sagt viel darüber aus, wie kolonialistisch sich manche Spanier noch heute in der Welt aufführen. "Der Saigoner neigt zum Betrügen, kompensiert das aber mit Fleiß und Geistesgegenwart; sein Eifer macht ihn daher zu einem nützlichen Begleiter", schreibt Escohotado allen Ernstes über seine Gastgeber in der Hauptstadt Vietnams.
Allemal angenehmere Zeitgenossen sind da Moreno Veloso, Domenico Lancelotti und Kassin, drei junge Männer, die derzeit Brasiliens Musikszene aufmischen und mit ihrer wahlweise Moreno +2, Domenico +2 und Kassin +2 genannten Band bereits zwei hochgelobte Alben veröffentlicht haben. Der Clou dabei: sie sind ganz unmittelbar die zweite Generation der hierzulande hauptsächlich durch den älteren Bossa nova bekannten Populärmusik Brasiliens, kurz MPB genannt. Moreno ist Sohn des herausragenden Caetano Veloso, während Domenico den Komponisten Ivor Lancelotti seinen Vater nennt. Begonnen haben alle drei mit experimentellem Rock: "Mein Vater beschwerte sich, ihm gefiel das gar nicht; mein Haus war eine Art Hauptquartier der MPB, es war furchtbar", erzählt Domenico. Wie seine Kollegen ist er ein begeisterter Björk-Fan. Solcherlei musikalische Einflüsse verarbeiten sie nun in ihrer eigenen Rezeption des schier unerschöpflichen musikalischen Reichtums Brasiliens.
Spiegel (Deutschland), 05.01.2004
 Der Historiker Paul Kennedy ("Aufstieg und Fall großer Mächte") glaubt im Interview, dass die Bush-Administration von Sendungsbewusstsein getrieben ist - und erklärt, woran man unter den aktuellen Bedingungen ein Imperium erkennt: "Wenn Sie sich heutzutage jene Länder anschauen, in denen der amerikanische Einfluss so enorm ist - Südkorea, die Philippinen bis nach Afghanistan, die Golfstaaten -, nun, das sieht aus wie ein Imperium, handelt wie ein Imperium, läuft wie ein Imperium, und es quakt wie ein Imperium - wahrscheinlich ist es ein Imperium."
Der Historiker Paul Kennedy ("Aufstieg und Fall großer Mächte") glaubt im Interview, dass die Bush-Administration von Sendungsbewusstsein getrieben ist - und erklärt, woran man unter den aktuellen Bedingungen ein Imperium erkennt: "Wenn Sie sich heutzutage jene Länder anschauen, in denen der amerikanische Einfluss so enorm ist - Südkorea, die Philippinen bis nach Afghanistan, die Golfstaaten -, nun, das sieht aus wie ein Imperium, handelt wie ein Imperium, läuft wie ein Imperium, und es quakt wie ein Imperium - wahrscheinlich ist es ein Imperium."Weitere Artikel: Veronika Hackenbroich berichtet, dass deutsche Psychiater, die Depressionen bei türkischen Migranten behandeln, "einer faszinierenden kulturwissenschaftlichen Frage auf der Spur sind: Wie kulturgebunden ist das Erscheinungsbild einer Krankheit? Äußert sich etwa eine Schizophrenie in Anatolien anders als in Ostfriesland? Und eine Depression in Istanbul anders als in Bottrop?" Gerald Traufetter stellt zwei neue Bücher vor, die das Image des britischen Antarktis-Abenteurers Ernest Shackleton ankratzen. Und Volkhard Windfuhr und Dieter Bednarz melden: Görings Yacht sucht neuen Besitzer.
Nur im Print: Im Interview gibt sich Bundeskanzler Gerhard Schröder entschlossen, weitere Reformen durchzusetzen. Angesichts eines ganzen Ensembles von geplanten Holocaust-Denkmälern in Berlin - das eine "Hierarchie von Nazi-Opfern" produziere, "die einen werden bedacht, die anderen vergessen" - fragt ein Beitrag: "Wäre ein Mahnmal für alle Opfer nicht doch sinnvoller gewesen?". Im Kulturteil wird Sofia Coppolas neuer Film "Lost in Translation" vorgestellt.
Der Titel zum demographischen Wandel in Deutschland hebt hervor, dass sich "gerade Akademikerinnen" ("vier von zehn") oft "für den Verzicht aufs Kind" entscheiden - und gefragt: "Was müsste passieren, damit das anders wird?"
Economist (UK), 02.01.2004
 Um die deutsch-polnischen Beziehungen steht es momentan nicht gerade zum Besten, und der Economist kann auch nachvollziehen, dass man vom polnischen Auftreten genervt ist. Aber die Deutschen sind einfach nicht ehrlich, glaubt er und zitiert Bismarck: "Das Wort Europa habe ich immer aus dem Mund jener Politiker gehört, die etwas von anderen Mächten forderten, was sie nicht wagten, in ihrem eigenen Namen zu fordern."
Um die deutsch-polnischen Beziehungen steht es momentan nicht gerade zum Besten, und der Economist kann auch nachvollziehen, dass man vom polnischen Auftreten genervt ist. Aber die Deutschen sind einfach nicht ehrlich, glaubt er und zitiert Bismarck: "Das Wort Europa habe ich immer aus dem Mund jener Politiker gehört, die etwas von anderen Mächten forderten, was sie nicht wagten, in ihrem eigenen Namen zu fordern."Im Rezensionsteil geht der Economist mit den Büchern der Bush-Hasser ins Gericht, die fatalerweise unter Humormangel leiden. Die wohltuende Ausnahme bilde da der herrlich unverschämte Al Franken ("Lies and the Lying Liars Who Tell Them"), der konservative Verfechter der abstinenten Erziehung um einen Beitrag zu einer Anthologie für Jugendliche bittet: "Haben Sie keine Scheu, einen Moment zu teilen, in dem sie versucht waren, Sex zu haben, aber in der Lage waren, ihre Nöte durch Willenskraft und Charakterstärke zu überwinden".
Weitere Artikel: Wer sind die Vorfahren des europäischen Einheitsgedanken: Römer, Karl der Große, Napoleon, oder gar Hitler? Der Economist hat sich unter europäischen Historikern umgehört. Sehr hübsch auch ein Artikel über antiquierte Verbrechen: Bankraub ist längst passe, und die Räuber von heute sind auf Drogen. Da können die Großen von damals nur den Kopf schütteln: "Standards are down."
Außerdem zu lesen: Warum sich die USA zwar auf einen üblen Wahlkampf gefasst machen müssen, dies aber der Welt nur zugute kommen kann, ob Howard Dean bei den Demokraten - und natürlich auch gegen George Bush - das Rennen macht, und schließlich warum eBay-Managerin Meg Whitman auch weiterhin die Flohmarkt-Königin bleiben wird.
Nur im Print zu lesen: Die Deutsche Bank sucht einen Herkules. Chinesische Hochglanzmagazine.
Times Literary Supplement (UK), 02.01.2004
 Im Rückblick reibt sich Bronwen Maddox die Augen: Sage und schreibe "fünf Kriege in sechs Jahren" hat Tony Blair geführt. "Die Kriege begannen praktisch in dem Moment, als er das Amt übernahm": Operation Desert Fox im Irak 1998, Kosovo, Sierra Leone, Afghanistan und noch einmal Irak. Was den Premier so kriegslüstern macht, lässt sich wunderbar in "Blair's Wars" nachlesen, lobt Maddox. So habe der altgediente BBC-Korrespondent Kampfner auch eine Schrift von 1993 ausgegraben, in der Blair seine politische Grundlagen umreißt: "Das Christentum ist eine sehr harte Religion... Es urteilt. Es gibt richtig und falsch. Es gibt gut und böse." Wie man eine solche Politik nicht mitmacht, erfährt man dann in den Erinnerungen von Blairs Ex-Außenminister Robin Cook "The Point of Departure".
Im Rückblick reibt sich Bronwen Maddox die Augen: Sage und schreibe "fünf Kriege in sechs Jahren" hat Tony Blair geführt. "Die Kriege begannen praktisch in dem Moment, als er das Amt übernahm": Operation Desert Fox im Irak 1998, Kosovo, Sierra Leone, Afghanistan und noch einmal Irak. Was den Premier so kriegslüstern macht, lässt sich wunderbar in "Blair's Wars" nachlesen, lobt Maddox. So habe der altgediente BBC-Korrespondent Kampfner auch eine Schrift von 1993 ausgegraben, in der Blair seine politische Grundlagen umreißt: "Das Christentum ist eine sehr harte Religion... Es urteilt. Es gibt richtig und falsch. Es gibt gut und böse." Wie man eine solche Politik nicht mitmacht, erfährt man dann in den Erinnerungen von Blairs Ex-Außenminister Robin Cook "The Point of Departure".Wenn John Le Carre nicht so ein heilloser Antiamerikaner wäre, seufzt James M. Murphy, hätte sein neuester Roman "Absolute Friends" (erstes Kapitel) ein toller Thriller sein können. So sei leider nur "Agitprop" rausgekommen. Den Plot will der Rezensent nicht verraten, nur soviel: Es geht um ein großes Täuschungsmanöver, dass sich die US-Geheimdienste unter neokonservativer Anleitung ausgedacht haben, um Europa in einer heiklen Angelegenheit ins amerikanische Lager zu ziehen...
Mit Verblüffung hat Paula Marantz Cohen eine neue Orson-Welles-Biografie "The Stories of His Life" von Peter Conrad aufgenommen. Sie sieht beim Autor die gleichen Stärken und Schwächen wie bei seinem Sujet: "Brillanten Anspielungsreichtum und liederlichen, oft prätentiösen Exhibitionismus." Nur in Auszügen zu lesen ist Peter McDonalds Besprechung des wiederaufgelegten Kommentars W.H. Audens zu Shakespeares "Sturm" aus den vierziger Jahren.
New York Times (USA), 04.01.2004
 Im zarten Alter von 22 Jahren hat Stephen King (mehr) seinen Riesenroman "The Dark Tower" (erstes Kapitel) begonnen, und Andrew O'Hehir freut sich schon auf die letzten beiden Bände, die bald veröffentlicht werden sollen. Der dritte Teil "Wolves of the Calla" jedenfalls hat ihn beeindruckt, mal abgesehen von einigen wagnerianischen Palaverpasssagen. "'The Dark Tower' ist ein wahrhaft ehrgeiziges Werk: King versucht verschiedene Stile populärer Erzählungen zu verweben, von der Artus-Legende über die Western von Sergio Leone bis hin zu apokalyptischer Science-Fiction. Darüber hinaus strebt er an, aus den einzelnen Teilen seiner Romane ein einziges Universum zu schaffen (oder ein Gebilde aus ineinanderübergreifenden Universen), und in gewisser Weise alle Geschichten, bekannte und unbekannte, in einer Meistererzählung zu verbinden, die die ganze Schöpfung umfasst." Wenn's weiter nichts ist.
Im zarten Alter von 22 Jahren hat Stephen King (mehr) seinen Riesenroman "The Dark Tower" (erstes Kapitel) begonnen, und Andrew O'Hehir freut sich schon auf die letzten beiden Bände, die bald veröffentlicht werden sollen. Der dritte Teil "Wolves of the Calla" jedenfalls hat ihn beeindruckt, mal abgesehen von einigen wagnerianischen Palaverpasssagen. "'The Dark Tower' ist ein wahrhaft ehrgeiziges Werk: King versucht verschiedene Stile populärer Erzählungen zu verweben, von der Artus-Legende über die Western von Sergio Leone bis hin zu apokalyptischer Science-Fiction. Darüber hinaus strebt er an, aus den einzelnen Teilen seiner Romane ein einziges Universum zu schaffen (oder ein Gebilde aus ineinanderübergreifenden Universen), und in gewisser Weise alle Geschichten, bekannte und unbekannte, in einer Meistererzählung zu verbinden, die die ganze Schöpfung umfasst." Wenn's weiter nichts ist.Was sind das für Zeiten, seufzt Samantha Power, wenn der regierungskritische Noam Chomsky (mehr) und "Alleserklärer'" zum wahrscheinlich meistgelesenen Amerikaner in Sachen Außenpolitik avanciert. Auch in seiner neuen Polemik "Hegemony or Survival" übertreibt Chomsky wieder einmal ungehemmt, findet Power, sein Plädoyer für mehr internationale Zusammenarbeit aber kann sie nur unterschreiben.
Adam Hochschild hat Daniel Bergners Reportageband über die Nachwehen des Bürgerkriegs in Sierra Leone ("In the Land of Magic Soldiers") nachhaltig beeindruckt, besonders der Text über den südafrikanischen Söldner, der Dörfer beschießt, um von seinem Lohn anschließend Wundheilzentren zu finanzieren. Im Aufmacher lobt Brad Leithauser eine von Grace Schulman herausgegebene Kollektion der Gedichte von Marianne Moore (mehr hier und hier), die sehr schön zeige, wie Moores "direkte Art sich dem Ornamentalen, Exotischen und der Moral öffnet". Sven Birkert gefällt an Thomas Mallons humorigen Roman "Bandbox" (erstes Kapitel) über den Kampf zweier New Yorker Magazine in den Zwanzigern ganz besonders, dass die guten Jungs am Ende die Mädchen bekommen. Timothy A. Hacsi hat wirklich nichts auszusetzen an drei hervorragenden Analysen des maroden amerikanischen Schulsystems, nur praktikable Lösungsvorschläge sucht er vergeblich.
The Nation | Economist | Times Literary Supplement | New York Times | Espresso | New Yorker | London Review of Books | Clarin | Point | Folio | Radar | Spiegel