Magazinrundschau
Rückkopplungseffekt
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
18.03.2025. The Atlantic glaubt, dass Trumps "Maga"-Bewegung den europäischen Rechtspopulisten schadet. Die LRB ist sich nicht so sicher. Elet es Irodalom sieht uns in einer Ära der Wahnsinnigen angekommen. Der Guardian beschreibt die Lage zweier junger Syrer, die Assad gedient haben. La vie des idees folgt Hannah Arendts "Stamm" durch das Frankreich der Jahre 1933-41. Wired kann nicht fassen, auf welche privaten Daten Elon Musks Doge-Jünglinge zugreifen dürfen.
The Atlantic (USA), 16.03.2025
 Ein Gutes hat die Trump-Regierung: Zum ersten Mal seit langem sind Europas Rechtspopulisten in der Defensive, meint die britische Publizistin Helen Lewis. "Wähler außerhalb der Vereinigten Staaten haben ein Problem mit der MAGA-Bewegung: Trump und seine Verbündeten sprechen über andere Länder auf eine zutiefst befremdliche Weise. 'Amerika zuerst'? Schön und gut, aber 'Amerika denkt, dass dein Zinnsoldatenland ein Witz ist'? Nicht so gut. Die giftige Kombination aus Trumps pro-russischen Neigungen, der Arroganz und Herablassung von Vizepräsident J. D. Vance und Musks traurigem Fall von fortgeschrittener Twitterkrankheit hat Amerikas Ansehen bei seinen traditionellen Verbündeten in den Keller gedrückt." Das verstehen auch die hiesigen Rechtspopulisten: "Trumps Abkehr von der Ukraine ist in Europa so unpopulär, dass sich die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und die französische Rechtsaußen-Führerin Marine Le Pen - zwei natürliche MAGA-Sympathisanten - vorsichtig davon distanziert haben." Noch problematischer ist das für den britischen Rechtsaußen und bekennenden Trumpfan Nigel Farage, der wesentlich am Brexit beteiligt war. Trump ist weitgehend unpopulär in Großbritannien, wo Farage mit seiner Reform-Partei "hofft, seinen Stimmenanteil von 14,3 Prozent bei der letzten Wahl zu verbessern. (Wahrscheinlich muss er diesen Anteil mindestens verdoppeln, wenn er eines Tages Premierminister werden will.) Noch schlimmer für ihn ist, dass Trumps MAGA-Bewegung als offen rassistisch und pro-russisch angesehen wird, zwei Dinge, die die Mehrheit der britischen Wähler ablehnt. Selbst rechte britische Zeitungen waren empört über Trumps schäbigen Umgang mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski im Oval Office, während die bisherigen Wähler der Reform-Partei mit ihren scharf einwanderungsfeindlichen Ansichten bereits Ausreißer sind. Weiter nach rechts zu rücken, ist in Großbritannien keine erfolgreiche Strategie. Oder anderswo. 'Die populistische Rechte auf der ganzen Welt hat ein MAGA-Problem', sagte mir Sunder Katwala, der Direktor der Denkfabrik British Future. 'In Ländern, die nicht Amerika sind, gibt es einen Rückkopplungseffekt.'"
Ein Gutes hat die Trump-Regierung: Zum ersten Mal seit langem sind Europas Rechtspopulisten in der Defensive, meint die britische Publizistin Helen Lewis. "Wähler außerhalb der Vereinigten Staaten haben ein Problem mit der MAGA-Bewegung: Trump und seine Verbündeten sprechen über andere Länder auf eine zutiefst befremdliche Weise. 'Amerika zuerst'? Schön und gut, aber 'Amerika denkt, dass dein Zinnsoldatenland ein Witz ist'? Nicht so gut. Die giftige Kombination aus Trumps pro-russischen Neigungen, der Arroganz und Herablassung von Vizepräsident J. D. Vance und Musks traurigem Fall von fortgeschrittener Twitterkrankheit hat Amerikas Ansehen bei seinen traditionellen Verbündeten in den Keller gedrückt." Das verstehen auch die hiesigen Rechtspopulisten: "Trumps Abkehr von der Ukraine ist in Europa so unpopulär, dass sich die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und die französische Rechtsaußen-Führerin Marine Le Pen - zwei natürliche MAGA-Sympathisanten - vorsichtig davon distanziert haben." Noch problematischer ist das für den britischen Rechtsaußen und bekennenden Trumpfan Nigel Farage, der wesentlich am Brexit beteiligt war. Trump ist weitgehend unpopulär in Großbritannien, wo Farage mit seiner Reform-Partei "hofft, seinen Stimmenanteil von 14,3 Prozent bei der letzten Wahl zu verbessern. (Wahrscheinlich muss er diesen Anteil mindestens verdoppeln, wenn er eines Tages Premierminister werden will.) Noch schlimmer für ihn ist, dass Trumps MAGA-Bewegung als offen rassistisch und pro-russisch angesehen wird, zwei Dinge, die die Mehrheit der britischen Wähler ablehnt. Selbst rechte britische Zeitungen waren empört über Trumps schäbigen Umgang mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski im Oval Office, während die bisherigen Wähler der Reform-Partei mit ihren scharf einwanderungsfeindlichen Ansichten bereits Ausreißer sind. Weiter nach rechts zu rücken, ist in Großbritannien keine erfolgreiche Strategie. Oder anderswo. 'Die populistische Rechte auf der ganzen Welt hat ein MAGA-Problem', sagte mir Sunder Katwala, der Direktor der Denkfabrik British Future. 'In Ländern, die nicht Amerika sind, gibt es einen Rückkopplungseffekt.'"London Review of Books (UK), 20.03.2025
 Der Politologe Jan-Werner Müller ist anders als Helen Lewis (s. The Atlantic) und Salvatore Vassallo and Rinaldo Vignati in einem Buch über Giorgia Melonis Partei "Fratelli d'Italia und den Aufstieg der italienischen Nationalkonservativen" deutlich skeptischer, was den negativen Einfluss der Maga-Bewegung auf Europas Rechtspopulisten angeht. Zumal die Konservativen Europas, nicht zuletzt dank Manfred Weber, dem Vorsitzender der Europäische Volkspartei, längst nach rechts gerückt seien. Gewiss, "Trumps offensichtliche Annäherung an Putin hat Melonis transatlantischen Balanceakt sehr viel prekärer gemacht". Ihr rechter Konkurrent Matteo Salvini, "der eine Chance zur Selbstbehauptung sieht, hat sich für die MAGA-Geopolitik stark gemacht. Meloni hält an ihrer Unterstützung für die Ukraine fest, hat aber auch klargestellt, dass es dort keine italienischen Truppen geben wird (Italiens Militärausgaben liegen weit unter den 2 Prozent des BIP, zu denen sich die Nato-Mitglieder offiziell verpflichtet haben). Ihre Aufrufe, den Westen zusammenzuhalten, klingen jetzt verzweifelt; sie hat die europäische Bühne an Starmer und Macron abtreten müssen. ... Heißt das, dass Vassallo und Vignati Recht haben, wenn sie die Fratelli d'Italia als eine wirklich nationale und mehr oder weniger normale konservative Partei betrachten? Das hängt davon ab, ob man es normal findet, dass der Parteivorsitzende über Soros als 'Wucherer' twittert, dass der Jugendflügel der Partei mit Begeisterung die Werke des faschistischen Philosophen Julius Evola aus der Zwischenkriegszeit liest und dass jemand in der Partei hin und wieder das Schreckgespenst der 'ethnischen Substitution' beschwört. Aber für viele in der rechten Mitte Westeuropas sind solche Dinge heute nicht mehr abnormal."
Der Politologe Jan-Werner Müller ist anders als Helen Lewis (s. The Atlantic) und Salvatore Vassallo and Rinaldo Vignati in einem Buch über Giorgia Melonis Partei "Fratelli d'Italia und den Aufstieg der italienischen Nationalkonservativen" deutlich skeptischer, was den negativen Einfluss der Maga-Bewegung auf Europas Rechtspopulisten angeht. Zumal die Konservativen Europas, nicht zuletzt dank Manfred Weber, dem Vorsitzender der Europäische Volkspartei, längst nach rechts gerückt seien. Gewiss, "Trumps offensichtliche Annäherung an Putin hat Melonis transatlantischen Balanceakt sehr viel prekärer gemacht". Ihr rechter Konkurrent Matteo Salvini, "der eine Chance zur Selbstbehauptung sieht, hat sich für die MAGA-Geopolitik stark gemacht. Meloni hält an ihrer Unterstützung für die Ukraine fest, hat aber auch klargestellt, dass es dort keine italienischen Truppen geben wird (Italiens Militärausgaben liegen weit unter den 2 Prozent des BIP, zu denen sich die Nato-Mitglieder offiziell verpflichtet haben). Ihre Aufrufe, den Westen zusammenzuhalten, klingen jetzt verzweifelt; sie hat die europäische Bühne an Starmer und Macron abtreten müssen. ... Heißt das, dass Vassallo und Vignati Recht haben, wenn sie die Fratelli d'Italia als eine wirklich nationale und mehr oder weniger normale konservative Partei betrachten? Das hängt davon ab, ob man es normal findet, dass der Parteivorsitzende über Soros als 'Wucherer' twittert, dass der Jugendflügel der Partei mit Begeisterung die Werke des faschistischen Philosophen Julius Evola aus der Zwischenkriegszeit liest und dass jemand in der Partei hin und wieder das Schreckgespenst der 'ethnischen Substitution' beschwört. Aber für viele in der rechten Mitte Westeuropas sind solche Dinge heute nicht mehr abnormal."Weitere Artikel: Judith Butler sorgt sich um das Schicksal der Gender-Politik unter Trump. Paul Taylor setzt sich mit Deep Seek auseinander. Und Ange Mlinko liegt László Krasznahorkai zu Füßen, dessen fantastischer Roman "Herscht 07769" gerade ins Englische übersetzt wurde.
Elet es Irodalom (Ungarn), 14.03.2025
 Der Philosoph András Kardos beschreibt unsere Zeit als Ära der Wahnsinnigen, als Madman-Ära und sieht Europa in der Pflicht sich dagegen zu stellen, um die eigenen Werte verteidigen und bewahren zu können: "Im Gegensatz zur Welt der totalitären Diktaturen des 20. Jahrhunderts hat die autokratische Welt des Wahnsinnigen, des Madman, und das ist der springende Punkt, einen Blankoscheck vom Volk: Während in der totalitären Welt Menschen im Namen eines ekelhaften und/oder unerfüllbaren Telos ausgerottet, kolonisiert, hingerichtet, eingesperrt werden, geht es in der Ära des Madman darum, die Welt neu zu gründen, ohne etwas darüber sagen zu müssen, ob dieser Wahnsinn selbst irgendeine auch nur eine abstrakte Verheißung für die künftige Welt enthält. (...) Europa steht vor einer großen Herausforderung: Hier wird der Versuch geboren, die Madman-Ära zu überwinden, denn das 'rationalistische' Europa ist der große Verlierer der Madman-Ära - bis jetzt. Aber wenn Europa wirklich an der großen Tradition der Aufklärung und der ethischen Werte festhält, an der Tradition der Wahrheit, die zwar plural ist, aber dennoch existiert, wenn es die echte und nicht die manipulierte Freiheit als grundlegend betrachtet, muss es sich auf die große Debatte mit der Welt des Madman einlassen. (…) Europa muss, auch wenn die Einigung seiner Nationen noch in weiter Ferne liegt, gemeinsam für die Grundwerte, für die Freiheit, für ein menschenwürdiges Leben und für die Menschenrechte eintreten."
Der Philosoph András Kardos beschreibt unsere Zeit als Ära der Wahnsinnigen, als Madman-Ära und sieht Europa in der Pflicht sich dagegen zu stellen, um die eigenen Werte verteidigen und bewahren zu können: "Im Gegensatz zur Welt der totalitären Diktaturen des 20. Jahrhunderts hat die autokratische Welt des Wahnsinnigen, des Madman, und das ist der springende Punkt, einen Blankoscheck vom Volk: Während in der totalitären Welt Menschen im Namen eines ekelhaften und/oder unerfüllbaren Telos ausgerottet, kolonisiert, hingerichtet, eingesperrt werden, geht es in der Ära des Madman darum, die Welt neu zu gründen, ohne etwas darüber sagen zu müssen, ob dieser Wahnsinn selbst irgendeine auch nur eine abstrakte Verheißung für die künftige Welt enthält. (...) Europa steht vor einer großen Herausforderung: Hier wird der Versuch geboren, die Madman-Ära zu überwinden, denn das 'rationalistische' Europa ist der große Verlierer der Madman-Ära - bis jetzt. Aber wenn Europa wirklich an der großen Tradition der Aufklärung und der ethischen Werte festhält, an der Tradition der Wahrheit, die zwar plural ist, aber dennoch existiert, wenn es die echte und nicht die manipulierte Freiheit als grundlegend betrachtet, muss es sich auf die große Debatte mit der Welt des Madman einlassen. (…) Europa muss, auch wenn die Einigung seiner Nationen noch in weiter Ferne liegt, gemeinsam für die Grundwerte, für die Freiheit, für ein menschenwürdiges Leben und für die Menschenrechte eintreten."Guardian (UK), 18.03.2025
La vie des idees (Frankreich), 04.03.2025
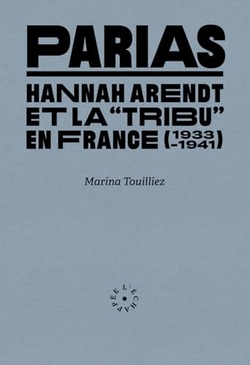
Die Europäische Union bleibt weiterhin erstaunlich schweigsam im Blick auf die Umwälzungen in Serbien, "zur Empörung der serbischen Demokraten und Zivilgesellschaft, die einen leidenschaftlichen offenen Brief an die Staats- und Regierungschefs der Union geschrieben haben", konstatiert der Journalist und Balkan-Spezialist Jean-Arnault Dérens. Und der serbische Autokrat Aleksandar Vučić hat nicht nur in Wladimir Putin einen prima Kumpel, sondern auch in dem Trump-Freund Richard Grenell und vor allem in einigen europäischen Staatschefs. Der unvermeidliche Viktor Orban ist der eine, Giorgia Meloni die andere: "Giorgia Meloni nimmt eine Sonderstellung ein. Die ideologische 'Neuausrichtung' von Aleksandar Vučić im Jahr 2008 orientierte sich an der von Gianfranco Fini und seiner Alleanza nazionale, in der die junge Meloni aktiv war. Darüber hinaus sind das ehemalige Jugoslawien und der Balkan unmittelbare Nachbarn Italiens - durch Adria und durch die so umstrittene 'Ostgrenze' vom Friaul bis nach Triest. Die italienische extreme Rechte ist traditionell pro-serbisch aus Antikroatismus, da sie Istrien und Dalmatien, die heute kroatisch sind, für italienisches Territorium hält. Am 10. Februar 2019 hatte Antonio Tajani, damals Präsident des Europäischen Parlaments (Forza Italia-EVP) und derzeitiger Außenminister von Giorgia Meloni, in Triest während einer Gedenkfeier für die Opfer dieser Ostgrenze einen Skandal ausgelöst, als er ausrief: 'Es lebe das italienische Istrien und Dalmatien!'"
New Lines Magazine (USA), 17.03.2025
 1994, nach dem Ende der Apartheid versprach die Regierung von Präsident Nelson Mandela, bis 1999 30 Prozent der 198 Millionen Hektar Ackerland Südafrikas an schwarze Bürger zu übertragen - über dreißig Jahre später ist dieses Ziel nicht einmal annähernd erreicht, berichtet Kwangu Liwewe. Im Gegenteil: "Nach der jüngsten Bewertung, dem Landbesitz-Audit 2017, befinden sich 72 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen Südafrikas immer noch im Besitz weißer Farmer, während der Anteil der Schwarzen bei 4 Prozent liegt - die restlichen 24 Prozent entfallen auf andere Ethnien in Südafrika. Das bedeutet, dass der Anteil der schwarzen Landbesitzer heute niedriger ist als unter der Apartheid in den 1980er Jahren, als er bei 13 Prozent lag." Obwohl die Regierung immer wieder versuchte, mit Reformen das Problem zu lösen, "geht es nicht voran, so Siyabonga Sithole, ein Landrechtsaktivist bei der 'Association for Rural Advancement': 'Die Geschichte von Zwangsumsiedlungen und Landenteignungen hat dazu geführt, dass viele schwarze Familien keine legalen Dokumente haben, um ihre Ansprüche zu beweisen, was den gesamten Prozess erschwert', so Sithole gegenüber New Lines. 'Auf kommerziellen Farmen wurden schwarze Arbeiter oft mit Landnutzung statt mit Lohn bezahlt, was ihnen erlaubte, zu leben, Ackerbau zu betreiben und Vieh zu züchten, aber selbst diese Rechte wurden ihnen später entzogen.' Laut Sithole fehlen der Regierung außerdem die Mittel, um die Landumverteilung in vollem Umfang zu unterstützen, so dass es für die Landanwärter schwierig ist, Zugang zu den notwendigen Werkzeugen, der Ausbildung und dem Kapital für eine erfolgreiche Landwirtschaft zu erhalten." Die Stimmung im Land beginnt zu kippen: "In der Provinz Limpopo übernehmen schwarze Gemeinden ungenutzte Grundstücke und sagen, dass sie nicht länger darauf warten können, dass die Regierung handelt. Einige weiße Farmer, die sich im Stich gelassen fühlen, haben private Sicherheitsleute engagiert. Andere greifen zu den Waffen."
1994, nach dem Ende der Apartheid versprach die Regierung von Präsident Nelson Mandela, bis 1999 30 Prozent der 198 Millionen Hektar Ackerland Südafrikas an schwarze Bürger zu übertragen - über dreißig Jahre später ist dieses Ziel nicht einmal annähernd erreicht, berichtet Kwangu Liwewe. Im Gegenteil: "Nach der jüngsten Bewertung, dem Landbesitz-Audit 2017, befinden sich 72 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen Südafrikas immer noch im Besitz weißer Farmer, während der Anteil der Schwarzen bei 4 Prozent liegt - die restlichen 24 Prozent entfallen auf andere Ethnien in Südafrika. Das bedeutet, dass der Anteil der schwarzen Landbesitzer heute niedriger ist als unter der Apartheid in den 1980er Jahren, als er bei 13 Prozent lag." Obwohl die Regierung immer wieder versuchte, mit Reformen das Problem zu lösen, "geht es nicht voran, so Siyabonga Sithole, ein Landrechtsaktivist bei der 'Association for Rural Advancement': 'Die Geschichte von Zwangsumsiedlungen und Landenteignungen hat dazu geführt, dass viele schwarze Familien keine legalen Dokumente haben, um ihre Ansprüche zu beweisen, was den gesamten Prozess erschwert', so Sithole gegenüber New Lines. 'Auf kommerziellen Farmen wurden schwarze Arbeiter oft mit Landnutzung statt mit Lohn bezahlt, was ihnen erlaubte, zu leben, Ackerbau zu betreiben und Vieh zu züchten, aber selbst diese Rechte wurden ihnen später entzogen.' Laut Sithole fehlen der Regierung außerdem die Mittel, um die Landumverteilung in vollem Umfang zu unterstützen, so dass es für die Landanwärter schwierig ist, Zugang zu den notwendigen Werkzeugen, der Ausbildung und dem Kapital für eine erfolgreiche Landwirtschaft zu erhalten." Die Stimmung im Land beginnt zu kippen: "In der Provinz Limpopo übernehmen schwarze Gemeinden ungenutzte Grundstücke und sagen, dass sie nicht länger darauf warten können, dass die Regierung handelt. Einige weiße Farmer, die sich im Stich gelassen fühlen, haben private Sicherheitsleute engagiert. Andere greifen zu den Waffen."Meduza (Lettland), 17.03.2025
 Zu Beginn der russischen Invasion konnte die Ukraine auf genügend Soldaten zurückgreifen, die sich freiwillig meldeten. Nach drei Jahren Krieg ist das Land aber ausgelaugt, viele Soldaten tot oder verwundet und neue Rekruten kommen nur schwer nach, weil sich die männliche Bevölkerung zunehmend vor den Rekrutierungsbehörden versteckt oder aus der Ukraine flieht. Der Journalist Shura Burtin ist zwei Monate durch die Ukraine gereist und erzählt, was er dort von der Zivilgesellschaft über den Krieg erfahren hat. "Ich telefoniere mit zwei Jungs, die illegal die Grenze überquert haben und jetzt in Berlin leben - Sergej und Sascha", die beide vor ihrer Einberufung geflogen sind. Zuerst wurden sie von Schleppern an die moldauische Grenze zitiert. "Dann rief mich eine moldauische Nummer an und sagte, wir müssten sofort ein Taxi nehmen. Ich bekam eine Standort-Markierung geschickt. Mit zwei Autos fuhren wir 200 Kilometer, stiegen irgendwo im Nirgendwo aus und warteten. Dann kam ein Müllwagen. Drinnen waren 20 Leute - junge Männer, eingepfercht. Es war heiß, wie in einer Sauna, alle waren nassgeschwitzt. Wir mussten uns sofort ausziehen, damit uns nicht schlecht wurde. Es stellte sich heraus, dass die anderen Jungs aus Odessa kamen und schon zwei Stunden unterwegs waren. Eine rostige Kette hing von der Decke, auf dem Boden saßen nackte Männer, und an den Wänden lief Kondenswasser herab. Ich hatte eine Flasche Whisky dabei und fragte: 'Jungs, wer will was trinken?' Sie sagten: 'Trinken? Hier geht's einem Typen richtig schlecht, der kippt gleich um.' (...) Wir erreichten ein Dorf in Transnistrien. Ein Haus leuchtete im Dunkeln, sonst war alles still. Die Schlepper holten uns in Gruppen ab, gaben uns Wasser. Ein Taxifahrer sagte: 'Jungs, ihr habt Glück. Die Gruppe vor euch wurde geschnappt.'" Die Flucht stieß in der Heimat nicht bei allen auf Verständnis: "Ein Bekannter schrieb mir: 'Sergej, du bist abgehauen?' Ich sagte: 'Ja, ich habe es nicht mehr ausgehalten.' Er antwortete: 'Fick dich, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben.'"
Zu Beginn der russischen Invasion konnte die Ukraine auf genügend Soldaten zurückgreifen, die sich freiwillig meldeten. Nach drei Jahren Krieg ist das Land aber ausgelaugt, viele Soldaten tot oder verwundet und neue Rekruten kommen nur schwer nach, weil sich die männliche Bevölkerung zunehmend vor den Rekrutierungsbehörden versteckt oder aus der Ukraine flieht. Der Journalist Shura Burtin ist zwei Monate durch die Ukraine gereist und erzählt, was er dort von der Zivilgesellschaft über den Krieg erfahren hat. "Ich telefoniere mit zwei Jungs, die illegal die Grenze überquert haben und jetzt in Berlin leben - Sergej und Sascha", die beide vor ihrer Einberufung geflogen sind. Zuerst wurden sie von Schleppern an die moldauische Grenze zitiert. "Dann rief mich eine moldauische Nummer an und sagte, wir müssten sofort ein Taxi nehmen. Ich bekam eine Standort-Markierung geschickt. Mit zwei Autos fuhren wir 200 Kilometer, stiegen irgendwo im Nirgendwo aus und warteten. Dann kam ein Müllwagen. Drinnen waren 20 Leute - junge Männer, eingepfercht. Es war heiß, wie in einer Sauna, alle waren nassgeschwitzt. Wir mussten uns sofort ausziehen, damit uns nicht schlecht wurde. Es stellte sich heraus, dass die anderen Jungs aus Odessa kamen und schon zwei Stunden unterwegs waren. Eine rostige Kette hing von der Decke, auf dem Boden saßen nackte Männer, und an den Wänden lief Kondenswasser herab. Ich hatte eine Flasche Whisky dabei und fragte: 'Jungs, wer will was trinken?' Sie sagten: 'Trinken? Hier geht's einem Typen richtig schlecht, der kippt gleich um.' (...) Wir erreichten ein Dorf in Transnistrien. Ein Haus leuchtete im Dunkeln, sonst war alles still. Die Schlepper holten uns in Gruppen ab, gaben uns Wasser. Ein Taxifahrer sagte: 'Jungs, ihr habt Glück. Die Gruppe vor euch wurde geschnappt.'" Die Flucht stieß in der Heimat nicht bei allen auf Verständnis: "Ein Bekannter schrieb mir: 'Sergej, du bist abgehauen?' Ich sagte: 'Ja, ich habe es nicht mehr ausgehalten.' Er antwortete: 'Fick dich, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben.'"New Yorker (USA), 17.03.2025
 Graydon Carter, langjähriger Chefredakteur der amerikanischen Vanity Fair, hat mit "When the Going Was Good: An Editor's Adventures During the Last Golden Age of Magazines" seine Memoiren vorgelegt, Nathan Heller schwelgt im New Yorker in Erinnerunen an die goldene Zeit des Magazin-Journalismus: "Magazine müssen, im Gegensatz zu Zeitungen, keine umfassende Berichterstattung leisten. Artikel, die überflüssig sind, oder aus dem Pflichtgefühl eines 'Wir sollten wohl' entstehen, stinken wie toter Fisch eine Meile gegen den Wind. Die prägende Erfahrung, ein gutes Magazin zu lesen, besteht in dem Gefühl 'Ich hätte nicht gedacht, dass mich das interessiert, aber': Das Medium definiert sich nicht über die Wahl der Themen, sondern über die Qualität der Ausführung. Magie passiert dort, wo es wenigstens einer Person - einem Autor, einer Fotografin oder einem Herausgeber, erlaubt ist, sich zu verlieben. Vanity Fair hatte kein Budget, das heißt, kein Limit, und kam mit Vorteilen, die selbst Redakteure der Time erblassen ließen. Der Verlag Condé Nast hat seinen Chefredakteuren zinsfreie Kredite für Häuser angeboten, jeden Ressortleiter mit Assistenten versorgt und die Angestellten in Limousinen nach Hause geschickt, wenn die Arbeit länger dauert. (Nur drei Worte: Nicht mehr so.)" Was Heller nicht erwähnt ist, dass Vanity Fair in den letzten Jahren von einem Magazin, das neben Glamour immer auch große Reportagen aus aller Welt hatte, heute fast nur noch Klatsch aus Hollywood bietet, dann und wann unterbrochen von etwas nationaler Politik. Für interessante Reportagen gäbe es zwar jede Menge Stoff, aber ohne Limousine macht das Handwerk halt keinen Spaß. "Wenn es verschwindet, wird der Grund dafür sein, dass auch die besten Neuankömmlinge einen Weg vor sich haben, der zu rau, zu lang ist und auf eine fundamentale Weise zu unspaßig."
Graydon Carter, langjähriger Chefredakteur der amerikanischen Vanity Fair, hat mit "When the Going Was Good: An Editor's Adventures During the Last Golden Age of Magazines" seine Memoiren vorgelegt, Nathan Heller schwelgt im New Yorker in Erinnerunen an die goldene Zeit des Magazin-Journalismus: "Magazine müssen, im Gegensatz zu Zeitungen, keine umfassende Berichterstattung leisten. Artikel, die überflüssig sind, oder aus dem Pflichtgefühl eines 'Wir sollten wohl' entstehen, stinken wie toter Fisch eine Meile gegen den Wind. Die prägende Erfahrung, ein gutes Magazin zu lesen, besteht in dem Gefühl 'Ich hätte nicht gedacht, dass mich das interessiert, aber': Das Medium definiert sich nicht über die Wahl der Themen, sondern über die Qualität der Ausführung. Magie passiert dort, wo es wenigstens einer Person - einem Autor, einer Fotografin oder einem Herausgeber, erlaubt ist, sich zu verlieben. Vanity Fair hatte kein Budget, das heißt, kein Limit, und kam mit Vorteilen, die selbst Redakteure der Time erblassen ließen. Der Verlag Condé Nast hat seinen Chefredakteuren zinsfreie Kredite für Häuser angeboten, jeden Ressortleiter mit Assistenten versorgt und die Angestellten in Limousinen nach Hause geschickt, wenn die Arbeit länger dauert. (Nur drei Worte: Nicht mehr so.)" Was Heller nicht erwähnt ist, dass Vanity Fair in den letzten Jahren von einem Magazin, das neben Glamour immer auch große Reportagen aus aller Welt hatte, heute fast nur noch Klatsch aus Hollywood bietet, dann und wann unterbrochen von etwas nationaler Politik. Für interessante Reportagen gäbe es zwar jede Menge Stoff, aber ohne Limousine macht das Handwerk halt keinen Spaß. "Wenn es verschwindet, wird der Grund dafür sein, dass auch die besten Neuankömmlinge einen Weg vor sich haben, der zu rau, zu lang ist und auf eine fundamentale Weise zu unspaßig."HVG (Ungarn), 15.03.2025
 Der Gründungsredakteur des Nachrichtenportals Origo und des Investigativ-Portals Direkt36, Balázs Weyer, appelliert in HVG zum 15. März, dem Nationalfeiertag anlässlich der Revolution und Freiheitskampf gegen die Habsburger 1848-49, für die Pressefreiheit, die in Ungarn erneut bedroht wird. "Uns allen wurde bei Schulveranstaltungen einprogrammiert, dass 1848 der Kampf für die Freiheit mit den Zwölf Punkten begann, und der erste der zwölf Punkte war die Forderung nach Pressefreiheit (...) Warum? Ich vermute, weil sie den Freiheitskampf als Ziel hatten, und genau darum geht es bei der Pressefreiheit. Nein, nicht um die Presse, sondern um die Freiheit. Unsere Freiheit, ob wir nun die Presse konsumieren oder nicht. Denn Freiheit ist die Abwesenheit von Verwundbarkeit. Voraussetzung dafür sind die Möglichkeit der Mitsprache, die Zugänglichkeit von Wissen und Information, die Begrenzbarkeit und Verantwortlichkeit von Macht (...) Wenn wir eine freie Presse wollen - wobei mit Pressefreiheit wirklich unsere eigene Freiheit gemeint ist - dann müssen wir das zeigen. Einerseits indirekt, indem wir an die Presse glauben und Erwartungen an sie stellen, indem wir nicht zusehen und akzeptieren, wenn sie nicht in unserem Sinne und nach den oben genannten Regeln arbeitet. Andererseits, indem wir für sie bezahlen (...) Die Pressefreiheit ist unsere Freiheit, also sollten wir sie nicht nur 'fordern', wie es der erste der Zwölf Punkte ausdrückt, sondern auch für sie eintreten, als ob sie uns gehören würde. Denn das tut sie."
Der Gründungsredakteur des Nachrichtenportals Origo und des Investigativ-Portals Direkt36, Balázs Weyer, appelliert in HVG zum 15. März, dem Nationalfeiertag anlässlich der Revolution und Freiheitskampf gegen die Habsburger 1848-49, für die Pressefreiheit, die in Ungarn erneut bedroht wird. "Uns allen wurde bei Schulveranstaltungen einprogrammiert, dass 1848 der Kampf für die Freiheit mit den Zwölf Punkten begann, und der erste der zwölf Punkte war die Forderung nach Pressefreiheit (...) Warum? Ich vermute, weil sie den Freiheitskampf als Ziel hatten, und genau darum geht es bei der Pressefreiheit. Nein, nicht um die Presse, sondern um die Freiheit. Unsere Freiheit, ob wir nun die Presse konsumieren oder nicht. Denn Freiheit ist die Abwesenheit von Verwundbarkeit. Voraussetzung dafür sind die Möglichkeit der Mitsprache, die Zugänglichkeit von Wissen und Information, die Begrenzbarkeit und Verantwortlichkeit von Macht (...) Wenn wir eine freie Presse wollen - wobei mit Pressefreiheit wirklich unsere eigene Freiheit gemeint ist - dann müssen wir das zeigen. Einerseits indirekt, indem wir an die Presse glauben und Erwartungen an sie stellen, indem wir nicht zusehen und akzeptieren, wenn sie nicht in unserem Sinne und nach den oben genannten Regeln arbeitet. Andererseits, indem wir für sie bezahlen (...) Die Pressefreiheit ist unsere Freiheit, also sollten wir sie nicht nur 'fordern', wie es der erste der Zwölf Punkte ausdrückt, sondern auch für sie eintreten, als ob sie uns gehören würde. Denn das tut sie."Wired (USA), 13.03.2025
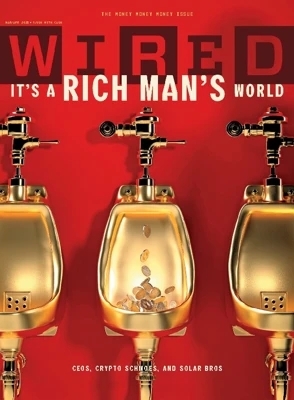 Alles schnell umkrempeln, Fragen später stellen - wenn überhaupt. Diese Leitlinie der Disruption setzt Elon Musk mit DOGE und seinem Team aus teils sehr jungen, im Netz rekrutierten IT-Mitarbeitern gerade konsequent um. Angeblich um die Effizienz des amerikanischen Staates zu steigern, de facto jedoch um dessen Institutionen und Instanzen bis an die Grenze zur Handlungsunfähigkeit zu zerlegen. Bedenken bezüglich Datenschutz oder mittel- bis langfristigen Folgeschäden scheint es keine zu geben, dem großen Recherche-Dossier nach zu schließen, das eine ganze Handvoll Wired-Reporter zusammengetragen hat - von einem "digitalen Staatstreich" spricht gar eine Quelle in USAID, der US-Behörde für Entwicklungshilfe. "DOGE gewann Zugang zu unzähligen Terabyte an Daten. Trump hat Musk und seinen Mitarbeitern freie Hand gelassen, um ganz nach Belieben jegliches System ohne Verschlusssache anzustechen. ... Einem 25 Jahre alten, früheren X-Techniker namens Marko Elez war es gestattet, nicht nur den Code im System des Finanzministeriums zu durchleuchten, sondern auch ihn zu verändern. Mit diesem Maß an Zugang, könnte er (oder jeder, dem er Bericht erstattet) potenziell vom Kongress abgesegnete Zahlungen einstellen, was Trump oder Musik effektiv in die Lage versetzte hätte, Einzelposten mit einem Veto zu belegen. Noch viel verdächtiger war in den Augen jener Leute, die sich mit dem System auskennen, die Möglichkeit, dass Elez beim Herumspielen mit dem Code die Systeme ganz oder teilweise lahmlegen könnte. 'Das ist in etwa so, als ob du zwar weißt, dass sich ein Hacker in deinem Netzwerk befindet, aber keiner lässt dich gegen ihn vorgehen', sagte ein Angestellter des Finanzministeriums gegenüber Wired." In einem weiteren Fall, dem eines DOGE-Technikers namens Akash Bobba, gab es von übergeordneter Stelle Sicherheitsbedenken, die jedoch mit hartnäckigem Druck zur Seite gefegt wurden, sodass auch hier Zugang zu Millionen privater Daten eingeräumt wurde. Tiffany Flick, die Bedenken geäußert hatte, "kündigte. In ihrer eidesstaatlichen Erklärung äußerte sie ernsthafte Sorge, dass die Aufzeichnungen des US-Rentensystems 'ungewollt übelwollenden Akteuren zugespielt' würden und dass ein 'unglaublich komplexes Systemnetz' durch 'unbeabsichtige Fehler auf Nutzerseite zerstört' werden könnte."
Alles schnell umkrempeln, Fragen später stellen - wenn überhaupt. Diese Leitlinie der Disruption setzt Elon Musk mit DOGE und seinem Team aus teils sehr jungen, im Netz rekrutierten IT-Mitarbeitern gerade konsequent um. Angeblich um die Effizienz des amerikanischen Staates zu steigern, de facto jedoch um dessen Institutionen und Instanzen bis an die Grenze zur Handlungsunfähigkeit zu zerlegen. Bedenken bezüglich Datenschutz oder mittel- bis langfristigen Folgeschäden scheint es keine zu geben, dem großen Recherche-Dossier nach zu schließen, das eine ganze Handvoll Wired-Reporter zusammengetragen hat - von einem "digitalen Staatstreich" spricht gar eine Quelle in USAID, der US-Behörde für Entwicklungshilfe. "DOGE gewann Zugang zu unzähligen Terabyte an Daten. Trump hat Musk und seinen Mitarbeitern freie Hand gelassen, um ganz nach Belieben jegliches System ohne Verschlusssache anzustechen. ... Einem 25 Jahre alten, früheren X-Techniker namens Marko Elez war es gestattet, nicht nur den Code im System des Finanzministeriums zu durchleuchten, sondern auch ihn zu verändern. Mit diesem Maß an Zugang, könnte er (oder jeder, dem er Bericht erstattet) potenziell vom Kongress abgesegnete Zahlungen einstellen, was Trump oder Musik effektiv in die Lage versetzte hätte, Einzelposten mit einem Veto zu belegen. Noch viel verdächtiger war in den Augen jener Leute, die sich mit dem System auskennen, die Möglichkeit, dass Elez beim Herumspielen mit dem Code die Systeme ganz oder teilweise lahmlegen könnte. 'Das ist in etwa so, als ob du zwar weißt, dass sich ein Hacker in deinem Netzwerk befindet, aber keiner lässt dich gegen ihn vorgehen', sagte ein Angestellter des Finanzministeriums gegenüber Wired." In einem weiteren Fall, dem eines DOGE-Technikers namens Akash Bobba, gab es von übergeordneter Stelle Sicherheitsbedenken, die jedoch mit hartnäckigem Druck zur Seite gefegt wurden, sodass auch hier Zugang zu Millionen privater Daten eingeräumt wurde. Tiffany Flick, die Bedenken geäußert hatte, "kündigte. In ihrer eidesstaatlichen Erklärung äußerte sie ernsthafte Sorge, dass die Aufzeichnungen des US-Rentensystems 'ungewollt übelwollenden Akteuren zugespielt' würden und dass ein 'unglaublich komplexes Systemnetz' durch 'unbeabsichtige Fehler auf Nutzerseite zerstört' werden könnte."
Kommentieren












