Magazinrundschau
Selbstzensur ist ein Thema
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
16.04.2013. Wer Mathematik besser verstehen will, sollte stricken, empfiehlt der American Scientist. The Quarterly Conversation erklärt, warum Czesław Miłosz Kalifornien liebte. Elet es Irodalom besucht eine Robert-Capa-Ausstellung. Der New Yorker porträtiert die Mars-Pioniere Adam Steltzner und John Grotzinger. In n+1 erklärt Sally Potter, warum sie den Hass auf Margaret Thatcher frauenfeindlich findet. In La regle du jeu erklärt Atiq Rahimi, warum sich globale Krisen immer in Afghanistan kristallisieren. Der Global Mail besucht Flüchtlinge im indonesischen Sex-Ferienort Cisaru. Vanity Fair porträtiert Felix Baumgartner.
Guardian | n+1 | Economist | La regle du jeu | HVG | Global Mail | Chronicle | Vanity Fair | American Scientist | Quarterly Conversation | Elet es Irodalom | Slate.fr | Prospect | New Yorker | Outside
American Scientist (USA), 01.04.2013
 In einem ganz wundervollen Artikel erklärt die Mathematikerin Sarah-Marie Belcastro, wie man mathematische Objekte strickt. "Sie mögen sich fragen, warum irgendjemand das wollen sollte. Ein Grund ist, dass die fertigen Objekte sehr gute Lehrhilfen sind. Ein gestricktes Objekt ist flexibel und kann physisch manipuliert werden, anders als schöne und mathematisch perfekte Computergrafiken. Und der Prozess selbst bietet einige Erkenntnis: Indem man ein Objekt neu erschafft, nicht dem Muster eines anderen folgend, kommt man zu einem tiefen Verständnis. Die Kunst, die körperliche Version einer Abstraktion zu schaffen, setzt voraus, dass man die Struktur der Abstraktion gut genug verstanden hat, um zu entscheiden, welche Eigenschaften hervorgehoben werden müssen. Solche Entscheidungen sind ein entscheidender Teil des Designprozesses, aber damit die Einzelheiten Sinn ergeben, müssen wir das Stricken geometrisch betrachten." (Links im Bild eine Kleinsche Flasche. Illustration von Barbara Aulicino, Foto von Austin Green)
In einem ganz wundervollen Artikel erklärt die Mathematikerin Sarah-Marie Belcastro, wie man mathematische Objekte strickt. "Sie mögen sich fragen, warum irgendjemand das wollen sollte. Ein Grund ist, dass die fertigen Objekte sehr gute Lehrhilfen sind. Ein gestricktes Objekt ist flexibel und kann physisch manipuliert werden, anders als schöne und mathematisch perfekte Computergrafiken. Und der Prozess selbst bietet einige Erkenntnis: Indem man ein Objekt neu erschafft, nicht dem Muster eines anderen folgend, kommt man zu einem tiefen Verständnis. Die Kunst, die körperliche Version einer Abstraktion zu schaffen, setzt voraus, dass man die Struktur der Abstraktion gut genug verstanden hat, um zu entscheiden, welche Eigenschaften hervorgehoben werden müssen. Solche Entscheidungen sind ein entscheidender Teil des Designprozesses, aber damit die Einzelheiten Sinn ergeben, müssen wir das Stricken geometrisch betrachten." (Links im Bild eine Kleinsche Flasche. Illustration von Barbara Aulicino, Foto von Austin Green)Quarterly Conversation (USA), 04.03.2013
 Die Autorin und Bloggerin Cynthia L. Haven schreibt sehr schön und erhellend über Czesław Miłosz, sein Verhältnis zu den amerikanischen Lyrikern Robinson Jeffers, Allen Ginsberg und Walt Whtiman und sein Verhältnis zu Kalifornien: "Kalifornien gab ihm Raum und einen Aussichtspunkt am Ende der Welt. Der leidenschaftliche Lyriker sehnte sich nach Distanz, einem objektiveren Ort, von dem aus er auf sich selbst blicken konnte, und fand ihn an der Pazifikküste. Distanz - ob emotional oder geografisch - ist in Polen schwer zu finden. Da war er ein Insider. Niemand ist Insider in Kalifornien."
Die Autorin und Bloggerin Cynthia L. Haven schreibt sehr schön und erhellend über Czesław Miłosz, sein Verhältnis zu den amerikanischen Lyrikern Robinson Jeffers, Allen Ginsberg und Walt Whtiman und sein Verhältnis zu Kalifornien: "Kalifornien gab ihm Raum und einen Aussichtspunkt am Ende der Welt. Der leidenschaftliche Lyriker sehnte sich nach Distanz, einem objektiveren Ort, von dem aus er auf sich selbst blicken konnte, und fand ihn an der Pazifikküste. Distanz - ob emotional oder geografisch - ist in Polen schwer zu finden. Da war er ein Insider. Niemand ist Insider in Kalifornien."Elet es Irodalom (Ungarn), 10.04.2013
 István Wagner bespricht eine neue Ausstellung der ungarischen "Magnum-Legende" Robert Capa in der Wiener Leica-Galerie. In der zweiten Etage des Kamerageschäfts werden dreißig weniger bekannte Bilder des Kriegsphotographen aus der Zeit des chinesisch-japanischen Krieges ab 1937 ausgestellt: Capa kam im Auftrag des Life Magazins im Februar 1938 nach Hongkong, um über die japanische Invasion zu berichten. Er hielt sowohl die permanente Propaganda der Kuomintang, der Chinesischen Nationalpartei, in Form von Massendemonstrationen fest, als auch einige Militärübungen der Truppen von Chiang Kai-shek. Er war bei der Rückeroberung von Tai'erzuhang dabei und dokumentierte die Sprengung der Dämme des Gelben Flusses, die über eine Million Opfer auf der eigenen, chinesischen Seite forderte, ohne ihr Ziel, die japanischen Truppen aufzuhalten, erreichen zu können. Er hielt ebenso die Bombardierung von Guangzhou durch die japanische Luftwaffe fest: "Es war auch die Berichterstattung Capas in Life, die die amerikanische Öffentlichkeit aufbrachte, denn das Ziel der Bombardements waren in erster Linie nicht strategische Punkte oder militärische Ziele, sondern Wohnviertel, Universitäten und andere Kultureinrichtungen."
István Wagner bespricht eine neue Ausstellung der ungarischen "Magnum-Legende" Robert Capa in der Wiener Leica-Galerie. In der zweiten Etage des Kamerageschäfts werden dreißig weniger bekannte Bilder des Kriegsphotographen aus der Zeit des chinesisch-japanischen Krieges ab 1937 ausgestellt: Capa kam im Auftrag des Life Magazins im Februar 1938 nach Hongkong, um über die japanische Invasion zu berichten. Er hielt sowohl die permanente Propaganda der Kuomintang, der Chinesischen Nationalpartei, in Form von Massendemonstrationen fest, als auch einige Militärübungen der Truppen von Chiang Kai-shek. Er war bei der Rückeroberung von Tai'erzuhang dabei und dokumentierte die Sprengung der Dämme des Gelben Flusses, die über eine Million Opfer auf der eigenen, chinesischen Seite forderte, ohne ihr Ziel, die japanischen Truppen aufzuhalten, erreichen zu können. Er hielt ebenso die Bombardierung von Guangzhou durch die japanische Luftwaffe fest: "Es war auch die Berichterstattung Capas in Life, die die amerikanische Öffentlichkeit aufbrachte, denn das Ziel der Bombardements waren in erster Linie nicht strategische Punkte oder militärische Ziele, sondern Wohnviertel, Universitäten und andere Kultureinrichtungen."Der Philosoph Gáspár Miklós Tamás macht auf einen aus seiner Sicht unlösbaren Interessenskonflikt in der Programmatik der oppositionellen Kräfte aufmerksam. Tamás führt aus, dass es zwar eine statistische Mehrheit gibt, die von der aktuellen Regierungspolitik benachteiligt wird, diese aber nicht mit der politischen Mehrheit deckungsgleich ist. "Die Betreiber des Staates sowie die große Anzahl der 'Kunden' - 'die gesunden Elemente' - stehen geschlossen jenen gegenüber, die nicht als Kunden sondern als 'Antragsteller' (meistens unberechtigte Antragsteller) angesehen werden: Arbeitslose, Rentner, Studenten". Diese Situation werde noch begünstigt durch einen Widerspruch in der ungarischen Linken: Ihre Verfassungs-, Gemeinde- und Grundrechtspolitik sei egalitär, ihre Wirtschaft- und Sozialpolitik dagegen antiegalitär. Dies sei unvertretbar, meint Tamás.
Slate.fr (Frankreich), 09.04.2013
 Emile Van Bever untersucht in einem interessanten Artikel offizielle nordkoreanische Fotos mit Hilfe einer Analysesoftware, die Photoshop-Manipulationen rekonstruiert. Unter anderem geht es um Fotos mit Luftkissenbooten am Strand, die ein Manöver zu zeigen scheinen. Auf den ersten Blick könnte man glauben, dass die Fotos von der selben Stelle am Strand und aus derselben Quelle stammen: "Aber es gibt überhaupt keine Informationen der nordkoreanischen Stellen, die diese These stützen. Die Luftkissenboote haben auf den verschiedenen Fotos unterschiedliche Positionen. Auf einem der Fotos lässt sich nicht festststellen, ob sie funktionieren. Auf dem anderen könnte es sogar sein, dass sie gar nicht existieren."
Emile Van Bever untersucht in einem interessanten Artikel offizielle nordkoreanische Fotos mit Hilfe einer Analysesoftware, die Photoshop-Manipulationen rekonstruiert. Unter anderem geht es um Fotos mit Luftkissenbooten am Strand, die ein Manöver zu zeigen scheinen. Auf den ersten Blick könnte man glauben, dass die Fotos von der selben Stelle am Strand und aus derselben Quelle stammen: "Aber es gibt überhaupt keine Informationen der nordkoreanischen Stellen, die diese These stützen. Die Luftkissenboote haben auf den verschiedenen Fotos unterschiedliche Positionen. Auf einem der Fotos lässt sich nicht festststellen, ob sie funktionieren. Auf dem anderen könnte es sogar sein, dass sie gar nicht existieren."Prospect (UK), 05.04.2013
 Im Blog von Prospect unterzieht der Japanologe John Swenson-Wright die Provokationen Nordkoreas einer genaueren Betrachtung. Dass das Führungspersonal des Staats schlicht durchgeknallt ist oder sich Kim Jong-Un mit Drohgebärden den Respekt seiner Generäle verschaffen will, hält er zwar für zulässige, aber nicht völlig überzeugende Interpretationen. Seinen Zuschlag erfährt die Sichtweise, in der der Norden "sich in einer sorgfältig choreografierten Schrittabfolge mit der Absicht bewegt, seine nationalen Interessen zu befördern - eine von historischen Tatsachen gestützte Ansicht. Kürzlich veröffentlichtes Archivmaterial aus Nixons Präsidentschaftszeit belegt, dass sich wechselnde US-Regierungen immer wieder mit einem Nordkorea konfrontiert sahen, das sich rationalen, kalkulierten Mustern 'strategischer Provokationen' bediente, um die USA zu direkten Verhandlungen zu drängen und im Zuge weitere Zugeständnisse, ob nun diplomatischer oder wirtschaftlicher Natur, durchzusetzen. In diesem Zusammenhang ähnelt Nordkorea einem 'Theaterstaat'."
Im Blog von Prospect unterzieht der Japanologe John Swenson-Wright die Provokationen Nordkoreas einer genaueren Betrachtung. Dass das Führungspersonal des Staats schlicht durchgeknallt ist oder sich Kim Jong-Un mit Drohgebärden den Respekt seiner Generäle verschaffen will, hält er zwar für zulässige, aber nicht völlig überzeugende Interpretationen. Seinen Zuschlag erfährt die Sichtweise, in der der Norden "sich in einer sorgfältig choreografierten Schrittabfolge mit der Absicht bewegt, seine nationalen Interessen zu befördern - eine von historischen Tatsachen gestützte Ansicht. Kürzlich veröffentlichtes Archivmaterial aus Nixons Präsidentschaftszeit belegt, dass sich wechselnde US-Regierungen immer wieder mit einem Nordkorea konfrontiert sahen, das sich rationalen, kalkulierten Mustern 'strategischer Provokationen' bediente, um die USA zu direkten Verhandlungen zu drängen und im Zuge weitere Zugeständnisse, ob nun diplomatischer oder wirtschaftlicher Natur, durchzusetzen. In diesem Zusammenhang ähnelt Nordkorea einem 'Theaterstaat'."Außerdem im Blog des Magazins: Andrew Roberts beobachtet ein gesteigertes Interesse am Thatcherismus.
New Yorker (USA), 22.04.2013
 Unter der Überschrift "Die Mars-Chronisten" porträtiert Burkhard Bilger die beiden entscheidenden Figuren hinter der gegenwärtigen Mars-Erkundung mit dem Rover "Curiosity": den Ingenieur Adam Steltzner und sein "Gegengewicht", den Geologen John Grotzinger: Ersterer habe sich gefragt, wie man dort hinkommt, Letzterer, was man dort wohl findet. Minutiös beschreibt Bilger die Probleme bei den Vorentwicklungen bis hin zum Countdown der Landung und den ersten, sensationell zu nennenden Entdeckungen unter anderem eines Seebetts. Vor dem Start des Rovers unterhielt sich Bilger mit Steltzner. "'Alles zusammengenommen liegen Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende menschlicher Beteiligung in diesem Ding', sagte er. 'Deshalb ist es für uns alle auf einer persönlichen Ebene eine große Sache.' Gefragt, wie er sich fühle, runzelte er die Stirn. 'Auf der Vernunftebene bin ich zuversichtlich, gefühlsmäßig graut mir', meinte er. 'Ich glaube aber, wir haben den Scheißkerl jetzt geknackt. Allerdings ist der Mars immer für eine Überraschung gut."
Unter der Überschrift "Die Mars-Chronisten" porträtiert Burkhard Bilger die beiden entscheidenden Figuren hinter der gegenwärtigen Mars-Erkundung mit dem Rover "Curiosity": den Ingenieur Adam Steltzner und sein "Gegengewicht", den Geologen John Grotzinger: Ersterer habe sich gefragt, wie man dort hinkommt, Letzterer, was man dort wohl findet. Minutiös beschreibt Bilger die Probleme bei den Vorentwicklungen bis hin zum Countdown der Landung und den ersten, sensationell zu nennenden Entdeckungen unter anderem eines Seebetts. Vor dem Start des Rovers unterhielt sich Bilger mit Steltzner. "'Alles zusammengenommen liegen Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende menschlicher Beteiligung in diesem Ding', sagte er. 'Deshalb ist es für uns alle auf einer persönlichen Ebene eine große Sache.' Gefragt, wie er sich fühle, runzelte er die Stirn. 'Auf der Vernunftebene bin ich zuversichtlich, gefühlsmäßig graut mir', meinte er. 'Ich glaube aber, wir haben den Scheißkerl jetzt geknackt. Allerdings ist der Mars immer für eine Überraschung gut."Weitere Artikel: Peter Schjeldahl besichtigt das wiedereröffnete Rijksmuseum in Amsterdam. David Denby sah im Kino Brian Helgelands Bio-Pic "42" über den Baseballspieler Jackie Robinson, der 1947 als erster Schwarzer in ein Team der Major Leagues aufgenommen wurde. Zu lesen ist außerdem die Erzählung "Mexican Manifesto" von Roberto Bolano.
Outside (USA), 09.04.2013
 Patrick Symmes reist durch den Südsudan und trifft den Tourismusminister Cirino Hiteng, der versucht, ihm das touristische Potenzial des von Krieg verwüsteten und bitterarmen Landes zu vermitteln: "Theoretisch gesehen gibt es zwölf Naturschutzgebiete und sechs Nationalparks. Die jährliche Antilopenwanderung durch den Boma Natinal Park, den bekanntesten von allen, gilt als die zweitgrößte auf dem Planeten. Es gibt dramatische Stromschnellen auf dem weißen Nil und lange Flussabschnitte, die sich für Wildwasserkanuten eignen, einen Sport der in Uganda bereits populär ist. Er hofft, dass sich die Imatong-Berge zu einem Touristengebiet entwickeln und flog mit einem UN-Team per Helikopter auf den Gipfel des Kinyeti-Bergs: 'Ich habe dort die Flagge des Südsudans gesetzt', sagt er. 'Ich sage den Leuten dort: Rodet nicht den Wald, er bringt den Mzunga, den Fremden. Haben Sie die Imatong-Wasserfälle gesehen? Stellen Sie sich dort Feriencottages vor. Da spürt man den Atem Gottes."
Patrick Symmes reist durch den Südsudan und trifft den Tourismusminister Cirino Hiteng, der versucht, ihm das touristische Potenzial des von Krieg verwüsteten und bitterarmen Landes zu vermitteln: "Theoretisch gesehen gibt es zwölf Naturschutzgebiete und sechs Nationalparks. Die jährliche Antilopenwanderung durch den Boma Natinal Park, den bekanntesten von allen, gilt als die zweitgrößte auf dem Planeten. Es gibt dramatische Stromschnellen auf dem weißen Nil und lange Flussabschnitte, die sich für Wildwasserkanuten eignen, einen Sport der in Uganda bereits populär ist. Er hofft, dass sich die Imatong-Berge zu einem Touristengebiet entwickeln und flog mit einem UN-Team per Helikopter auf den Gipfel des Kinyeti-Bergs: 'Ich habe dort die Flagge des Südsudans gesetzt', sagt er. 'Ich sage den Leuten dort: Rodet nicht den Wald, er bringt den Mzunga, den Fremden. Haben Sie die Imatong-Wasserfälle gesehen? Stellen Sie sich dort Feriencottages vor. Da spürt man den Atem Gottes."Guardian (UK), 13.04.2013
 Zwei Schritt vor, einer zurück - die Türkei bewegt sich im alten Mehter-Takt, wenn es um Menschenrechte geht, erklärt die Schriftstellerin Elif Shafak. Große Fortschritt gebe es bei der Gleichstellung der Kurden und Schwulen, auch seien die Macht der Armee und die Gewalt gegen Frauen erfolgreich bekämpft worden. Andererseits wurde gerade gestern der Pianist Fazil Say wegen Blasphemie verurteilt worden: "Mit zunehmender Sorge sehen wir, dass die Presse nicht mehr so vielfältig ist wie sie es früher einmal war und dass andersdenkende Stimmen immer seltener zu hören sind. Selbstzensur ist ein Thema, über das wir selten sprechen, obwohl es notwendig wäre: Letzten Monat hat Hasan Cemal, ein altgedienter Journalist und kritischer Kopf seine Zeitung Milliyet verlassen."
Zwei Schritt vor, einer zurück - die Türkei bewegt sich im alten Mehter-Takt, wenn es um Menschenrechte geht, erklärt die Schriftstellerin Elif Shafak. Große Fortschritt gebe es bei der Gleichstellung der Kurden und Schwulen, auch seien die Macht der Armee und die Gewalt gegen Frauen erfolgreich bekämpft worden. Andererseits wurde gerade gestern der Pianist Fazil Say wegen Blasphemie verurteilt worden: "Mit zunehmender Sorge sehen wir, dass die Presse nicht mehr so vielfältig ist wie sie es früher einmal war und dass andersdenkende Stimmen immer seltener zu hören sind. Selbstzensur ist ein Thema, über das wir selten sprechen, obwohl es notwendig wäre: Letzten Monat hat Hasan Cemal, ein altgedienter Journalist und kritischer Kopf seine Zeitung Milliyet verlassen."Außerdem stellt John le Carre noch einmal klar, dass sein "Spion, der aus der Kälte kam", reine Erfindung war. Jonathan Coe hofft auf eine anhaltende Diskussion um Margaret Thatchers Erbe.
n+1 (USA), 12.04.2013
 Die englische Filmregisseurin Sally Potter hat Margaret Thatchers Politik immer vehement abgelehnt. Aber etwas änderte sich, als sie eines Tages ein Poster in einem Schaufenster sah, schreibt sie. "Das Poster war von einer linken Gruppe gestaltet worden und zeigte Margaret Thatcher, die in einer Schlinge hing, über der stand: 'Tötet das Miststück'. Daran war nichts ungewöhnlich und es wiederholte sich viele Male in den Tagen nach ihrem Tod, als Leute schadenfroh sangen 'Ding dong, the witch is dead', ein Song aus dem Wizard of Oz. Es sieht aus wie unschuldige Ironie. Aber man kann und konnte unmöglich den Eifer bewundern, mit dem hier Sprache und Bilder, die an Lynchjustiz und Hexenverbrennungen erinnern, benutzt werden, um sie als Frau zu dämonisieren und einen uralten Hass auf Frauen zu erwecken, die in irgendeiner Form Macht haben - sei es geistig, medizinisch oder politisch. Warum diese Gleichsetzung ihrer Person mit ihrer Politik? Warum gilt ihr Konservatismus als destruktiv und dämonisch statt einfach als politisch katastrophal?"
Die englische Filmregisseurin Sally Potter hat Margaret Thatchers Politik immer vehement abgelehnt. Aber etwas änderte sich, als sie eines Tages ein Poster in einem Schaufenster sah, schreibt sie. "Das Poster war von einer linken Gruppe gestaltet worden und zeigte Margaret Thatcher, die in einer Schlinge hing, über der stand: 'Tötet das Miststück'. Daran war nichts ungewöhnlich und es wiederholte sich viele Male in den Tagen nach ihrem Tod, als Leute schadenfroh sangen 'Ding dong, the witch is dead', ein Song aus dem Wizard of Oz. Es sieht aus wie unschuldige Ironie. Aber man kann und konnte unmöglich den Eifer bewundern, mit dem hier Sprache und Bilder, die an Lynchjustiz und Hexenverbrennungen erinnern, benutzt werden, um sie als Frau zu dämonisieren und einen uralten Hass auf Frauen zu erwecken, die in irgendeiner Form Macht haben - sei es geistig, medizinisch oder politisch. Warum diese Gleichsetzung ihrer Person mit ihrer Politik? Warum gilt ihr Konservatismus als destruktiv und dämonisch statt einfach als politisch katastrophal?"Economist (UK), 13.04.2013
 Der Economist feiert Margaret Thatcher wie zu erwarten schon auf dem Titelblatt als "Freiheitskämpferin". "Nur eine Handvoll Politiker in Friedenszeiten können für sich beanspruchen, die Welt verändert zu haben. Margaret Thatcher war eine von ihnen", heißt es in dieser Würdigung. "Sie veränderte nicht nur ihre eigene konservative Partei, sondern die gesamte britische Politik. Der Enthusiasmus, mit dem sie für Privatisierungen einstand, trat eine globale Revolution los und ihr unbedingter Wille, gegen die Tyrannei einzustehen, begünstigte das Ende der Sowjetunion. Winston Churchill hat einen Krieg gewonnen, doch einen '-ismus' hat er nie geschaffen."
Der Economist feiert Margaret Thatcher wie zu erwarten schon auf dem Titelblatt als "Freiheitskämpferin". "Nur eine Handvoll Politiker in Friedenszeiten können für sich beanspruchen, die Welt verändert zu haben. Margaret Thatcher war eine von ihnen", heißt es in dieser Würdigung. "Sie veränderte nicht nur ihre eigene konservative Partei, sondern die gesamte britische Politik. Der Enthusiasmus, mit dem sie für Privatisierungen einstand, trat eine globale Revolution los und ihr unbedingter Wille, gegen die Tyrannei einzustehen, begünstigte das Ende der Sowjetunion. Winston Churchill hat einen Krieg gewonnen, doch einen '-ismus' hat er nie geschaffen." Der Thatcherismus, heißt es in dieser ausführlicheren Bilanz, hat bis heute spürbare Wellen von "Warschau über Santiago bis Washington" geschlagen. Aber auch: "In ihrer Heimat steht es um ihr Erbe komplizierter. Widersprüche, wohin man schaut. Sie war ein waschechter Tory, der die Tory-Partei auf eine Generation marginalisierte. Die Tories hörten auf, eine Volkspartei zu sein, sie zogen sich in den Süden und die Vorstädte zurück, während sie in Schottland, Wales und den Städten im Norden nahezu völlig ausstarben. Tony Blair zog aus der Thatcher-Revolution mehr Nutzen als John Major, ihr Nachfolger".
Außerdem: Eine Sammlung internationaler Stimmen zu Thatchers Tod. Weiter denkt der Economist über die virtuelle, womöglich demnächst crashende Währung Bitcoin nach (hier eine Erklärung, wie sie funktioniert) und erklärt uns, dass weibliche Ansprüche ans Aussehen der Männer auch nicht realistischer sind als die von Männern an Frauen.
La regle du jeu (Frankreich), 12.04.2013
 Alexandra Profizi unterhält sich sich mit dem französisch-afghanischen Schriftsteller und Dokumentarfilmer Atiq Rahimi, der gerade seinen Roman "Stein der Geduld" verfilmt hat. Über das Projekt und sein Geburtsland sagt er: "Ich mache das nicht aus Nostalgie, sondern weil ich das Land kenne und es ein Land ist, das der Geschichte viel gegeben hat und nun Opfer geopolitischer Spiele und Fragen geworden ist. Es ist also eine Form, Aufmerksamkeit auf dieses Land im Herzen Asiens zu lenken. Abrahams Volk kam bis dorthin, die jüdisch-christlich-islamische Zivilisation. Danach haben Sie eine andere Kultur. Wenn alle westlichen Eroberer seit Alexander dem Großen in Afghanistan Halt machten, dann, weil es dort eine andere Art gibt, die Welt zu sehen. Das Land umfasst die Vorzüge und Kehrseiten beider Kulturen. Sobald es zu einer globalen Krise kommt, kristallisiert sie sich deshalb in Afghanistan. Es ist ein sehr rätselhaftes Land."
Alexandra Profizi unterhält sich sich mit dem französisch-afghanischen Schriftsteller und Dokumentarfilmer Atiq Rahimi, der gerade seinen Roman "Stein der Geduld" verfilmt hat. Über das Projekt und sein Geburtsland sagt er: "Ich mache das nicht aus Nostalgie, sondern weil ich das Land kenne und es ein Land ist, das der Geschichte viel gegeben hat und nun Opfer geopolitischer Spiele und Fragen geworden ist. Es ist also eine Form, Aufmerksamkeit auf dieses Land im Herzen Asiens zu lenken. Abrahams Volk kam bis dorthin, die jüdisch-christlich-islamische Zivilisation. Danach haben Sie eine andere Kultur. Wenn alle westlichen Eroberer seit Alexander dem Großen in Afghanistan Halt machten, dann, weil es dort eine andere Art gibt, die Welt zu sehen. Das Land umfasst die Vorzüge und Kehrseiten beider Kulturen. Sobald es zu einer globalen Krise kommt, kristallisiert sie sich deshalb in Afghanistan. Es ist ein sehr rätselhaftes Land." HVG (Ungarn), 03.04.2013
 Vor kurzem wurden die Ergebnisse des Zensus von 2011 in Ungarn veröffentlicht. Endre Babus fasst die Ergebnisse im Hinblick auf den expliziten Informationswunsch nach der religiösen Überzeugung sowie der ethnischen Zugehörigkeit zusammen. "Nach ungefähr je einem Jahrzehnt sozialliberaler bzw. christdemokratischer Regierungen kennzeichnet die ungarische Gesellschaft nach diesen Ergebnissen eine schnelle Verweltlichung", so Babus. Es werde auch deutlich, "dass ein immer größerer Anteil der Bevölkerung es nicht wirklich begrüßt, wenn der Staat sie nach ihrem Weltbild und ihrer religiösen Überzeugung fragt. In dieser Hinsicht sind insbesondere die Budapester Bürger ablehnend. Mehr als ein Drittel von ihnen (585.000) lehnte eine Antwort die Frage nach der Religionszugehörigkeit ab. Im Jahre 2001 waren unter den nichtreligiösen Befragten landesweit diejenigen in der Mehrheit, die ihr Atheismus oder (...) ihre Freigeistigkeit offen angaben." Die andere große Überraschung der Volksbefragung ist, dass zunehmend mehr Menschen ihre nationale und ethnische Zugehörigkeit preisgeben als dies zu Beginn des Jahrtausends der Fall war. Die Anzahl der "ungarischen Volkszugehörigen" ist von 9,4 Millionen im Jahre 2001 auf 8,3 Millionen gefallen. Die größte ethnische Minderheit sind die Roma, die von 190.000 auf 309.000 gestiegen sind, eine Steigerung von 63 Prozent, informiert Babus.
Vor kurzem wurden die Ergebnisse des Zensus von 2011 in Ungarn veröffentlicht. Endre Babus fasst die Ergebnisse im Hinblick auf den expliziten Informationswunsch nach der religiösen Überzeugung sowie der ethnischen Zugehörigkeit zusammen. "Nach ungefähr je einem Jahrzehnt sozialliberaler bzw. christdemokratischer Regierungen kennzeichnet die ungarische Gesellschaft nach diesen Ergebnissen eine schnelle Verweltlichung", so Babus. Es werde auch deutlich, "dass ein immer größerer Anteil der Bevölkerung es nicht wirklich begrüßt, wenn der Staat sie nach ihrem Weltbild und ihrer religiösen Überzeugung fragt. In dieser Hinsicht sind insbesondere die Budapester Bürger ablehnend. Mehr als ein Drittel von ihnen (585.000) lehnte eine Antwort die Frage nach der Religionszugehörigkeit ab. Im Jahre 2001 waren unter den nichtreligiösen Befragten landesweit diejenigen in der Mehrheit, die ihr Atheismus oder (...) ihre Freigeistigkeit offen angaben." Die andere große Überraschung der Volksbefragung ist, dass zunehmend mehr Menschen ihre nationale und ethnische Zugehörigkeit preisgeben als dies zu Beginn des Jahrtausends der Fall war. Die Anzahl der "ungarischen Volkszugehörigen" ist von 9,4 Millionen im Jahre 2001 auf 8,3 Millionen gefallen. Die größte ethnische Minderheit sind die Roma, die von 190.000 auf 309.000 gestiegen sind, eine Steigerung von 63 Prozent, informiert Babus.Allen Statistiken der Buchhändler zufolge verliert die Belletristik an Bedeutung, doch Autoren-Lesungen - immer öfter verbunden mit einem musikalischen Rahmenprogramm - erleben eine neue Blühtezeit und lassen Kultstätten entstehen, berichtet Gábor Murányi. Es scheint interessant zu sein wie der Autor seinen Text interpretiert, wie er zwischen seinen Sätzen, Reimen und Pointen balanciert wie er Fehler macht oder lacht. "'Das bedeutet allerdings nicht die eine zunehmende Verbreitung von Literatur, diese Zusammenkünfte, die familiäre Nähe ersetzt in nicht wenigen Fällen lediglich das Lesen. Von den mit Preisnachlässen angebotenen Bänden werden nicht wirklich viel verkauft', stellt wehmütig der Literat Ákos Szilágyi fest."
Vor 75 Jahren wurde der Entwurf des ersten Judengesetzes in das ungarische Parlament eingebracht. Andor Lázár, der damalige Justizminister, war der einzige Politiker, der daraufhin zurücktrat, erinnert László Lőrinc. "Sein Schritt ist auch aus dem Grunde überraschend, weil er seine Karriere als junger Anwalt am rechten politischen Rand begann."
Global Mail (Australien), 05.04.2013
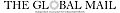 Aubrey Belford hat für die Global Mail in Cisaru umgesehen, einer Stadt bei Jakarta, in der sich amüsierwillige wohlhabende Muslime mit Tausenden von Flüchtlingen aus Afghanistan, Pakistan, Iran, Iraq, Sri Lanka und Burma mischen, die hoffen, es eines Tages auf einem Schmugglerboot nach Australien zu schaffen. Die Flüchtlinge werden von Schmugglern und Polizei nach Strich und Faden ausgenommen. Die Überfahrt nach Australien endet oft tödlich, auch weil die Boote viel zu viele Menschen mitnehmen. Viele bleiben daher in der Vorhölle von Cisaru sitzen: "Indonesien nimmt keine Flüchtlinge auf Dauer auf. Die, die hier auf den Bescheid über ihren Asylantrag warten, dürfen nicht arbeiten oder ihre Kinder auf indonesische Schulen schicken. Wer beim UNHCR registriert ist, darf zwar offiziell hier leben, aber wenn er ohne Papiere erwischt wird oder beim Fluchtversuch nach Australien, wird in der Regel abgeschoben. Cisaru, das über dem Smog von Jakarta liegt, hat noch mehr Vorteile: Es ist billig, die Gegend ist an offene Geheimnisse gewohnt und die Schmuggler kennen sich hier gut aus. ... In den 90ern erlangte die Stadt einige Bekanntschaft als Sex-Ferienort für Männer aus dem Nahen Osten, vor allem Saudis. Puncak ist das Wort für eine Praxis, die in Indonesien als 'Vertragsheirat' bekannt ist, eine Art Schlupfloch, das einige Besucher nutzen, um der Prostitution eine islamische Fassade zu geben."
Aubrey Belford hat für die Global Mail in Cisaru umgesehen, einer Stadt bei Jakarta, in der sich amüsierwillige wohlhabende Muslime mit Tausenden von Flüchtlingen aus Afghanistan, Pakistan, Iran, Iraq, Sri Lanka und Burma mischen, die hoffen, es eines Tages auf einem Schmugglerboot nach Australien zu schaffen. Die Flüchtlinge werden von Schmugglern und Polizei nach Strich und Faden ausgenommen. Die Überfahrt nach Australien endet oft tödlich, auch weil die Boote viel zu viele Menschen mitnehmen. Viele bleiben daher in der Vorhölle von Cisaru sitzen: "Indonesien nimmt keine Flüchtlinge auf Dauer auf. Die, die hier auf den Bescheid über ihren Asylantrag warten, dürfen nicht arbeiten oder ihre Kinder auf indonesische Schulen schicken. Wer beim UNHCR registriert ist, darf zwar offiziell hier leben, aber wenn er ohne Papiere erwischt wird oder beim Fluchtversuch nach Australien, wird in der Regel abgeschoben. Cisaru, das über dem Smog von Jakarta liegt, hat noch mehr Vorteile: Es ist billig, die Gegend ist an offene Geheimnisse gewohnt und die Schmuggler kennen sich hier gut aus. ... In den 90ern erlangte die Stadt einige Bekanntschaft als Sex-Ferienort für Männer aus dem Nahen Osten, vor allem Saudis. Puncak ist das Wort für eine Praxis, die in Indonesien als 'Vertragsheirat' bekannt ist, eine Art Schlupfloch, das einige Besucher nutzen, um der Prostitution eine islamische Fassade zu geben."Chronicle (USA), 15.04.2013
Seit Wochen wird im Perlentaucher über Jan Assmanns Begriff der "mosaischen Unterscheidung" debattiert - lanciert wurde die Debatte von Jan Assmann selbst. Nun folgt, ohne jeden Bezug auf unsere Debatte, eine Generalattacke auf Assmann durch den New Yorker Politologen Richard Wolin im Chronicle of Higher Education: "In Assmanns Sicht waren es die alten Hebräer, die durch die 'mosaische Unterscheidung" und die dadurch entfesselte kulturelle Semantik der Intoleranz den Begriff des heiligen Krieges schufen: eine göttlich angeordnete Doktrin der totalen Vernichtung. Tragischer Weise wandte sich dieselbe kulturelle Semantik der Intoleranz sehr viel später gegen die Juden selbst, im größten jemals verzeichneten Massenmord, dem Holocaust. In anderen Worten: Wer Wind sät, wird Sturm ernten. In Assmanns Sicht waren es letztlich nicht die Deutschen, die für den Holocaust verantwortlich sind. Es waren die Juden selbst".
Lesenswert sind auch die Kommentare unter dem Artikel. Ellen Hunt verteidigt Assmann sehr entschieden: "Den Holocaust argumentatativ so zu verwenden, ist eine ad hominen-Attacke, eine Propaganda-Technik."
Lesenswert sind auch die Kommentare unter dem Artikel. Ellen Hunt verteidigt Assmann sehr entschieden: "Den Holocaust argumentatativ so zu verwenden, ist eine ad hominen-Attacke, eine Propaganda-Technik."
Vanity Fair (USA), 01.05.2013
 William Langewiesche beschreibt detailliert die Vorbereitung und Durchführung von Felix Baumgartners Sprung aus der Stratosphäre im vergangenen Oktober und zeichnet ein ungewohntes Bild des Extremsportlers: "In der Kontrollstation, 43 Meilen weiter westlich, im Flughafen von Roswell, New Mexico, machen sich einige der Chefingenieure Sorgen um Baumgartners Geistesverfassung. So sehr sie ihn auch persönlich mochten und seine Gesellschaft bei einem Bier genossen, erwies er sich in der Zusammenarbeit doch als schwierig - stur, selbstdramatisierend, schlau, aber auf intellektueller Ebene unsicher, seltsam gleichgültig gegenüber der wissenschaftlichen Seite des Projekts und emotional unberechenbar. Er war absolut nicht der Typ des coolen, gutausgebildeten Testpiloten, mit dem sie üblicherweise zu tun hatten. Einmal kehrte er dem Projekt mitten in einer wichtigen Phase den Rücken, fuhr in Tränen aufgelöst zum Flughafen und flog zurück nach Österreich."
William Langewiesche beschreibt detailliert die Vorbereitung und Durchführung von Felix Baumgartners Sprung aus der Stratosphäre im vergangenen Oktober und zeichnet ein ungewohntes Bild des Extremsportlers: "In der Kontrollstation, 43 Meilen weiter westlich, im Flughafen von Roswell, New Mexico, machen sich einige der Chefingenieure Sorgen um Baumgartners Geistesverfassung. So sehr sie ihn auch persönlich mochten und seine Gesellschaft bei einem Bier genossen, erwies er sich in der Zusammenarbeit doch als schwierig - stur, selbstdramatisierend, schlau, aber auf intellektueller Ebene unsicher, seltsam gleichgültig gegenüber der wissenschaftlichen Seite des Projekts und emotional unberechenbar. Er war absolut nicht der Typ des coolen, gutausgebildeten Testpiloten, mit dem sie üblicherweise zu tun hatten. Einmal kehrte er dem Projekt mitten in einer wichtigen Phase den Rücken, fuhr in Tränen aufgelöst zum Flughafen und flog zurück nach Österreich."Als Mark Zuckerberg im Januar mit Graph Search die nächste Facebook-Neuerung vorstellte, waren Investoren enttäuscht, die Kurse fielen. Zu unrecht, findet Kurt Eichenwald, der eine Revolution der Online-Werbung heraufziehen sieht - und an Medien erinnert, die ebenfalls einmal damit zu kämpfen hatten, Einkünfte zu generieren: "Monat für Monat stieg die Beliebtheit der Technologie in immer astronomischere Höhen. In nur einem Jahr explodierte die Zahl der Nutzer des kostenlosen Dienstes um 2500 Prozent, aber niemand wusste, wie sich dieses gigantische Publikum zu Geld zu machen ließe. Wir sprechen hier nicht über Facebook, sondern über das Radio, welches zunächst, wie jedes soziale Netzwerk, ein finanzieller Reinfall zu werden drohte. In dieser Geschichte - und in der Geschichte der Werbung, von Zeitungen bis Google - finden sich Lektionen, die bei der Einschätzung der Möglichkeiten von Facebook berücksichtigt werden sollten."
Weitere Artikel: James Wolcott widmet sich dem paradoxen Phänomen der Punk-Nostalgie. Michael Callahan stellt eins der schönsten Reisemagazine der amerikanischen Nachkriegszeit vor: Holiday.
Guardian | n+1 | Economist | La regle du jeu | HVG | Global Mail | Chronicle | Vanity Fair | American Scientist | Quarterly Conversation | Elet es Irodalom | Slate.fr | Prospect | New Yorker | Outside
Kommentieren












