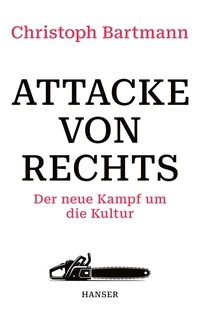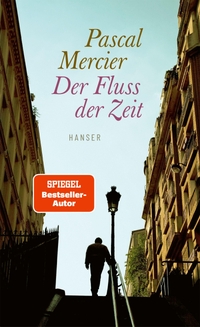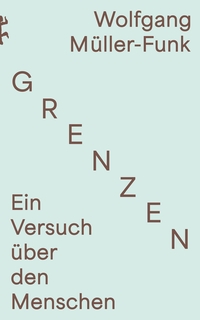Magazinrundschau
Herz aus Bronze
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
21.02.2012. Einen Krieg gegen Frauenrechte diagnostiziert The New Republic in den USA. Wer nackte Frauen aufs Titelbild einer Zeitschrift bringt, soll sich nicht beschweren, wenn er im Knast landet, findet Rue89. In Elet es Irodalom erklärt die Historikerin Mirta Núñez Díaz-Balart, warum die Wunden aus der Franco-Diktatur nie verheilen konnten. In Eurozine sehen Stephen Holmes und Ivan Krastev wenig Gemeinsamkeit zwischen den Protesten in Russland und in der arabischen Welt. In der London Review of Books schäumt Edward Luttwak über eine Übersetzung: die Ilias ohne den 10. Gesang? Ohne den Helm mit den Hauern vom weißzahnigen Schwein? Unmöglich!
New Republic (USA), 01.03.2012
 Die Redakteure des New Republic sind verstört über den immer heftiger geführten Krieg gegen Frauenrechte. Längst geht es nicht mehr nur um Abtreibung. Auch Krebsvorsorgeuntersuchungen und Verhütungsmittel sollen nicht mehr von den Krankenkassen bezahlt werden: "Die Rhetorik von Rick Santorum - den in Umfragen stärksten Republikaner - ist schon fast salopp fies. Nicht zufrieden mit der Forderung, alle Abtreibungen zu kriminalisieren, selbst in Fällen von Vergewaltigung und Inzest, hüllt er seine Verbotsideologie in blasierte Herablassung. Eine Frau, die durch eine Vergewaltigung schwanger wird, soll nach Santorum 'das beste aus einer schlimmen Situation machen'. Einzeln genommen, scheinen diese Ereignisse Ausnahmen zu sei sein. Zusammengenommen zeigt sich jedoch ein beunruhigender Trend. Wenn es um Frauenrechte geht, sehen wir bei der Rechten einen immer stärkeren nicht Konservatismus, sondern Radikalismus: ein Gebot, die erreichten Ziele und Freiheiten abzuschaffen, die der Feminismus für Frauen erkämpft hat."
Die Redakteure des New Republic sind verstört über den immer heftiger geführten Krieg gegen Frauenrechte. Längst geht es nicht mehr nur um Abtreibung. Auch Krebsvorsorgeuntersuchungen und Verhütungsmittel sollen nicht mehr von den Krankenkassen bezahlt werden: "Die Rhetorik von Rick Santorum - den in Umfragen stärksten Republikaner - ist schon fast salopp fies. Nicht zufrieden mit der Forderung, alle Abtreibungen zu kriminalisieren, selbst in Fällen von Vergewaltigung und Inzest, hüllt er seine Verbotsideologie in blasierte Herablassung. Eine Frau, die durch eine Vergewaltigung schwanger wird, soll nach Santorum 'das beste aus einer schlimmen Situation machen'. Einzeln genommen, scheinen diese Ereignisse Ausnahmen zu sei sein. Zusammengenommen zeigt sich jedoch ein beunruhigender Trend. Wenn es um Frauenrechte geht, sehen wir bei der Rechten einen immer stärkeren nicht Konservatismus, sondern Radikalismus: ein Gebot, die erreichten Ziele und Freiheiten abzuschaffen, die der Feminismus für Frauen erkämpft hat."Außerdem: Die vielgerühmte Durchlässigkeit der amerikanischen Gesellschaft ist inzwischen nur noch ein Mythos, stellt Timothy Noah fest, nachdem er sich durch einige Studien gearbeitet hat.
Rue89 (Frankreich), 19.02.2012
Ein gewisses Verständnis hat Thierry Brésillon in seinem Blog Tunisie libre in rue89 für die Inhaftierung zweier Journalisten in Tunesien. Sie hatten ein Foto des Fußballers Sami Khedira gezeigt, der seine nackte Freundin umarmt. Der Chefredakteur der Zeitung Ettounsiya wurde daraufhin wegen Verstoßes gegen die guten Sitten in Untersuchungshaft gesteckt. "Was soll das Foto einer nackten Frau auf Seite 1 einer Zeitung? Und genauer: Warum ist die Ver- oder Entschleierung des weiblichen Körpers die entscheidende Frage für die tunesische Gesellschaft? Um den Ursprung dieser Passion zu verstehen, muss man Frantz Fanon wiederlesen, der im 'Jahr V der algerischen Revolution' über den Eifer der Kolonisatoren zur Enthüllung der Algerierinnen schreibt: 'Wenn wir die algerische Gesellschaft in ihrem Kontext, in ihrem Widerstandswillen treffen wollen, dann müssen wir die Frauen erobern.' Die Entschleierungszeremonien (in denen Musliminnen öffentlich ihren Schleier ablegten, d. Red.) wie etwa im Mai 1958 waren das Symbol eines von Frankreich in einer rückständigen Gesellschaft eroberten Terrains. Dieses Terrain musste man 'zivilisieren' und dem Zugriff des algerischen Nationalismus entziehen."
Il Sole 24 Ore (Italien), 19.02.2012
 Ist Ai Weiwei ein Held oder ein Trittbrettfahrer? Das fragt sich Angela Vettese und versucht es mit dem Besuch einer Ausstellung im Stoccolma Magasin3 zu ergründen. "Das Werk des Künstlers ist auch in der digitalen Sektion der Ausstellung einzusehen, in der man an Ereignissen teilnehmen kann, die an anderen Ecken in Stockholm stattfinden, durch Twitter und verschiedene Mikroblogs. Die Kuratorin versucht zu demonstrieren, dass es keine Kluft gibt zwischen Weiweis objekthaften Werken und seinen Arbeiten für die Infosphäre, die sich vor allem um den Kampf für einen neuen Status des Individuums drehen." Außerdem ist in Italien nun auch die Abschrift von Ai Weiweis Blog erschienen, herausgegeben vom noch jungen Verlag Johan & Levi. "Er ist bestimmt auch ein Schlitzohr, doch scheint Ai Weiwei aus dem gleichen Holz geschnitzt zu sein wie Andy Warhol: ein unermüdlicher Arbeiter, ausgezeichneter Kenner der Medien, ein Zyniker in einer schlimmen Welt. Er findet das Ohr und vielleicht sogar das Vertrauen des Publikums. Was auch immer man von ihm hält, er zeigt jene Missstände auf, die China noch beheben muss, bevor es zu sich kommen kann."
Ist Ai Weiwei ein Held oder ein Trittbrettfahrer? Das fragt sich Angela Vettese und versucht es mit dem Besuch einer Ausstellung im Stoccolma Magasin3 zu ergründen. "Das Werk des Künstlers ist auch in der digitalen Sektion der Ausstellung einzusehen, in der man an Ereignissen teilnehmen kann, die an anderen Ecken in Stockholm stattfinden, durch Twitter und verschiedene Mikroblogs. Die Kuratorin versucht zu demonstrieren, dass es keine Kluft gibt zwischen Weiweis objekthaften Werken und seinen Arbeiten für die Infosphäre, die sich vor allem um den Kampf für einen neuen Status des Individuums drehen." Außerdem ist in Italien nun auch die Abschrift von Ai Weiweis Blog erschienen, herausgegeben vom noch jungen Verlag Johan & Levi. "Er ist bestimmt auch ein Schlitzohr, doch scheint Ai Weiwei aus dem gleichen Holz geschnitzt zu sein wie Andy Warhol: ein unermüdlicher Arbeiter, ausgezeichneter Kenner der Medien, ein Zyniker in einer schlimmen Welt. Er findet das Ohr und vielleicht sogar das Vertrauen des Publikums. Was auch immer man von ihm hält, er zeigt jene Missstände auf, die China noch beheben muss, bevor es zu sich kommen kann."Le Monde (Frankreich), 18.02.2012
Der Schriftsteller Tahar Ben Jelloun unternimmt einen - literarischen - Versuch, sich in den Kopf des syrischen Präsidenten Bachar Al-Assad zu versetzen. Nach Überwindung von „mindestens sieben Absperrungen“ ist er drin: „Sein Kopf ist nicht besonders groß. Er ist voller Stroh, Stecknadeln und Rasierklingen. Warum, weiß ich nicht. Sein Gehirn ist ruhig. Kein Stress, keine Nervosität. Ich weiß nicht,woher er diese Ruhe nimmt.“ Eine Erklärung liefert Jelloun, indem der Assad Folgendes denken lässt: „Mein Vater hat mich gelehrt, dass man in der Politik ein Herz aus Bronze haben muss. Ich habe meinem angewöhnt, niemals zu brechen. Keine Gefühle, keine Schwäche. Denn ich riskiere meinen Kopf und das Leben meiner gesamten Familie. Die Gauner, die Syrien verwüsten bekommen nur, was sie verdienen. Man redet vom ,arabischen Frühling’! Was soll das? Wo ist ein Frühling in Sicht? Es ist doch nicht so, dass nur weil ahnungslose Hetzer öffentliche Plätze besetzen, die Jahreszeiten Rhythmus und Richtung gewechselt haben. Bei mir wird das, was sie ,den Frühling’ nennen, nicht stattfinden.“
Zu lesen ist außerdem die Sammelbesprechung einer Biografie, eines Essays und eines Romans über Sir Arthur Conan Doyle, dessen Held Sherlock Holmes Rezensentin Elisabeth Roudinesco als „freudianischen Ermittler“ feiert.
Zu lesen ist außerdem die Sammelbesprechung einer Biografie, eines Essays und eines Romans über Sir Arthur Conan Doyle, dessen Held Sherlock Holmes Rezensentin Elisabeth Roudinesco als „freudianischen Ermittler“ feiert.
Elet es Irodalom (Ungarn), 17.02.2012
 Wurde in Spanien die faschistische Diktatur erfolgreich beseitigt? Vordergründig ja, aber ungelöste Konflikte überschatten immer noch die Gegenwart, wie zuletzt etwa der Fall des Richters Baltasar Garzón zeigte, der wegen seiner Ermittlungen gegen das Franco-Regime selbst zum Angeklagten wurde. Zu den Verfechtern einer konsequenten Vergangenheitsbewältigung gehört auch die Historikerin Mirta Núñez Díaz-Balart, Professorin der Complutense-Universität in Madrid. Im Interview erklärt sie, warum das ewige Beschweigen gefährlich ist: "Die francistische Propaganda hat seit den 50er Jahren tiefe Wurzeln in der Gesellschaft geschlagen und ab den 60er Jahren fand tatsächlich eine enorme wirtschaftliche Entwicklung statt. Die Mittelschicht ist entstanden und wurde immer stärker. Ein Teil der Gesellschaft ist sich jedoch nicht im Klaren darüber, für welchen Preis und unter welchen Umständen all dies geschah; sie identifiziert sich daher mit den 'Werten' des Franco-Regimes. [...] Zudem lehnt ein großer Teil der Bevölkerung eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ab, weil sie glaubt, dass dadurch alte Wunden wieder aufgerissen und Konflikte generiert würden. Damit wird die Sache aber nur beschönigt, da diese Wunden - aufgrund des totalen Schweigens der Franco-Diktatur, die auch in der Zeit des Übergangs anhielt - nie verheilt sind."
Wurde in Spanien die faschistische Diktatur erfolgreich beseitigt? Vordergründig ja, aber ungelöste Konflikte überschatten immer noch die Gegenwart, wie zuletzt etwa der Fall des Richters Baltasar Garzón zeigte, der wegen seiner Ermittlungen gegen das Franco-Regime selbst zum Angeklagten wurde. Zu den Verfechtern einer konsequenten Vergangenheitsbewältigung gehört auch die Historikerin Mirta Núñez Díaz-Balart, Professorin der Complutense-Universität in Madrid. Im Interview erklärt sie, warum das ewige Beschweigen gefährlich ist: "Die francistische Propaganda hat seit den 50er Jahren tiefe Wurzeln in der Gesellschaft geschlagen und ab den 60er Jahren fand tatsächlich eine enorme wirtschaftliche Entwicklung statt. Die Mittelschicht ist entstanden und wurde immer stärker. Ein Teil der Gesellschaft ist sich jedoch nicht im Klaren darüber, für welchen Preis und unter welchen Umständen all dies geschah; sie identifiziert sich daher mit den 'Werten' des Franco-Regimes. [...] Zudem lehnt ein großer Teil der Bevölkerung eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ab, weil sie glaubt, dass dadurch alte Wunden wieder aufgerissen und Konflikte generiert würden. Damit wird die Sache aber nur beschönigt, da diese Wunden - aufgrund des totalen Schweigens der Franco-Diktatur, die auch in der Zeit des Übergangs anhielt - nie verheilt sind."Eurozine (Österreich), 17.02.2012
 Es wäre ein Fehler die russischen Proteste gegen Putin mit der Arabellion zu vergleichen, meinen Stephen Holmes und Ivan Krastev in einer messerscharfen Analyse der Machtsituation in Russland (ursprünglich in iwmPost), in der sie Putin übrigens als ziemlich schwach wahrnehmen. Der Vergleich verbietet sich dennoch: "Putin ist viel jünger als Mubarak - er ist erst seit elf Jahren an der Macht, verglichen mit dreißig Jahren Mubarak, und die russische Bevölkerung ist im Durchschnitt viel älter als die ägyptische und weit weniger angetan vom Versprechen der Demokratie. Die Chancen, dass sich die Armee mit der Bevölkerung verbrüdert, sind zu vernachlässigen, und die russische Opposition ist weit entfernt von der Stärke der Islamisten."
Es wäre ein Fehler die russischen Proteste gegen Putin mit der Arabellion zu vergleichen, meinen Stephen Holmes und Ivan Krastev in einer messerscharfen Analyse der Machtsituation in Russland (ursprünglich in iwmPost), in der sie Putin übrigens als ziemlich schwach wahrnehmen. Der Vergleich verbietet sich dennoch: "Putin ist viel jünger als Mubarak - er ist erst seit elf Jahren an der Macht, verglichen mit dreißig Jahren Mubarak, und die russische Bevölkerung ist im Durchschnitt viel älter als die ägyptische und weit weniger angetan vom Versprechen der Demokratie. Die Chancen, dass sich die Armee mit der Bevölkerung verbrüdert, sind zu vernachlässigen, und die russische Opposition ist weit entfernt von der Stärke der Islamisten."Magyar Narancs (Ungarn), 16.02.2012
 Nun, da Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán die Werte der Europäischen Union mit Füßen tritt, muss die EU eine juristische Grundlage für ihre Kritik an Ungarn finden. Doch angesichts der Tatsache, dass die EU die Akte Ungarn schnellstmöglich schließen will und Viktor Orbán auf den Kredit der EU und des IWF angewiesen ist, wird es sicherlich Kompromisse in einigen Bereichen geben, findet der frühere liberale Politiker Mátyás Eörsi: "Derweil hat die eine Hälfte der Ungarn das Gefühl, dass die EU sich grundlos und unberechtigterweise in innere Angelegenheiten des Landes einmischt, während die andere Hälfte sich durch die Kompromissbereitschaft der EU-Kommission im Stich gelassen fühlt. Letzteren möchte ich sagen: Brüssel wird Orbán in einigen Fragen zum Nachgeben zwingen, und dafür wird es auch Beispiele geben. Aber nicht die Kommission muss Orbán bezwingen, sondern die ungarischen Demokraten."
Nun, da Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán die Werte der Europäischen Union mit Füßen tritt, muss die EU eine juristische Grundlage für ihre Kritik an Ungarn finden. Doch angesichts der Tatsache, dass die EU die Akte Ungarn schnellstmöglich schließen will und Viktor Orbán auf den Kredit der EU und des IWF angewiesen ist, wird es sicherlich Kompromisse in einigen Bereichen geben, findet der frühere liberale Politiker Mátyás Eörsi: "Derweil hat die eine Hälfte der Ungarn das Gefühl, dass die EU sich grundlos und unberechtigterweise in innere Angelegenheiten des Landes einmischt, während die andere Hälfte sich durch die Kompromissbereitschaft der EU-Kommission im Stich gelassen fühlt. Letzteren möchte ich sagen: Brüssel wird Orbán in einigen Fragen zum Nachgeben zwingen, und dafür wird es auch Beispiele geben. Aber nicht die Kommission muss Orbán bezwingen, sondern die ungarischen Demokraten."La vie des idees (Frankreich), 16.02.2012
 Vor dreißig Jahren bereits hat das syrische Regime in einer Aktion, die an der Weltöffentlichkeit vorbeiging, in der Stadt Hama Tausende Oppositionelle umbegracht. Nora Benkorich erzählt in einem Text, der auch Licht auf die aktuelle Situation wirft, die Geschichte dieses Massakers. Die Grundkonstellation war damals eine gänzlich andere als heute, schreibt sie, weil die aktuelle Opposition mehrheitlich friedlich agiert. "Im Gegensatz dazu waren die Akteure der Schlacht von Februar 1982 Dschihadisten, die einen Gottesstaat errichten wollten... Die Tragödie von Hama kam nicht aus dem Nichts. Sie ist der Gipfelpunkt eines 1976 lancierten bewaffneten Kampfes, der von einer dschihadistischen Untergrundbewegung ausging, die unter dem Namen 'Bewaffnete Avantgarde der Muslimbrüder' bekannt war, obwohl sie mit den Muslimbrüdern eigentlich gar nichts zu tun hatte." Hama galt zugleich als die syrische Hochburg der Muslimbrüder, die auf diese Weise dezimiert wurden.
Vor dreißig Jahren bereits hat das syrische Regime in einer Aktion, die an der Weltöffentlichkeit vorbeiging, in der Stadt Hama Tausende Oppositionelle umbegracht. Nora Benkorich erzählt in einem Text, der auch Licht auf die aktuelle Situation wirft, die Geschichte dieses Massakers. Die Grundkonstellation war damals eine gänzlich andere als heute, schreibt sie, weil die aktuelle Opposition mehrheitlich friedlich agiert. "Im Gegensatz dazu waren die Akteure der Schlacht von Februar 1982 Dschihadisten, die einen Gottesstaat errichten wollten... Die Tragödie von Hama kam nicht aus dem Nichts. Sie ist der Gipfelpunkt eines 1976 lancierten bewaffneten Kampfes, der von einer dschihadistischen Untergrundbewegung ausging, die unter dem Namen 'Bewaffnete Avantgarde der Muslimbrüder' bekannt war, obwohl sie mit den Muslimbrüdern eigentlich gar nichts zu tun hatte." Hama galt zugleich als die syrische Hochburg der Muslimbrüder, die auf diese Weise dezimiert wurden.London Review of Books (UK), 23.02.2012
 Singe den Zorn, o Göttin, des Historikers Edward Luttwak, der sich bestens in der Geschichte von Homer-Übersetzungen auskennt und Stephen Mitchells neue Übertragung der "Ilias" ins Englische in Bausch und Bogen verdammt: Nicht nur, dass dem Übersetzer der Sinn für Homers Ironie in den hier unberücksichtigten Füll-Adjektiven völlig abgehe, mit seiner (unter anderem philologisch begründeten) Streichung des 10. Gesangs "verstümmelt" er den Text geradezu, wie Luttwak detailliert darlegt: "Es gibt daher eine Vielzahl triftiger Gründe, von der 'Ilias', wie wir sie seit 23 Jahrhunderten kennen, nicht abzuweichen. Doch selbst wenn keiner davon valide wäre, bleibt der 10. Gesang noch immer von ungemeinem Wert, da er die Beschreibung des Helms mit den Wildschweinhauern beinhaltet - ein einzelnes Objekt, das die gesamte homerische Frage beleuchtet. ... Der Dichter und sein Publikum hätten gewusst, dass es sich hierbei um einen haarsträubend antiken Helm handelt und dass es einer Erklärung bedarf, wie dieser auf Odysseus' Haupt gelangt ist."
Singe den Zorn, o Göttin, des Historikers Edward Luttwak, der sich bestens in der Geschichte von Homer-Übersetzungen auskennt und Stephen Mitchells neue Übertragung der "Ilias" ins Englische in Bausch und Bogen verdammt: Nicht nur, dass dem Übersetzer der Sinn für Homers Ironie in den hier unberücksichtigten Füll-Adjektiven völlig abgehe, mit seiner (unter anderem philologisch begründeten) Streichung des 10. Gesangs "verstümmelt" er den Text geradezu, wie Luttwak detailliert darlegt: "Es gibt daher eine Vielzahl triftiger Gründe, von der 'Ilias', wie wir sie seit 23 Jahrhunderten kennen, nicht abzuweichen. Doch selbst wenn keiner davon valide wäre, bleibt der 10. Gesang noch immer von ungemeinem Wert, da er die Beschreibung des Helms mit den Wildschweinhauern beinhaltet - ein einzelnes Objekt, das die gesamte homerische Frage beleuchtet. ... Der Dichter und sein Publikum hätten gewusst, dass es sich hierbei um einen haarsträubend antiken Helm handelt und dass es einer Erklärung bedarf, wie dieser auf Odysseus' Haupt gelangt ist."Weiteres: Stephen Sedley legt im Widerspruch zu Jonathan Sumptions Vortrag vom vergangenen November (hier dazu mehr), der darin eine zunehmende Einmischung der Judikative in die britische Legislative ausmacht, dar, warum davon keine Rede sein könne. Christian Lorentzen überlegt als überzeugter Nichtwähler in der kommenden US-Präsidentschaftswahl schon auch aus nostalgischen Gründen gegen Mitt Romney zu stimmen. Charles Nicholl begibt sich zur Klärung der Frage, ob der frühe Renaissancemaler Andrea del Castagno tatsächlich ein Mörder gewesen ist, in staubige Archive. Rosemary Hill schreibt kurz und bündig über David Shrigleys Ausstellung "Brain Activity" in der Hayward Gallery in London.
New York Times (USA), 19.02.2012
Seit zwei Jahren ist in Frankreich das umstrittene Hadopi-Gesetz in Kraft, das illegale Downloads überwacht und nach der Three-Strikes-Regel sanktioniert. Glaubt man Eric Pfanner, dann wirkt es: "Studien zeigen, dass der Reiz der Piraterie verblasst, seit das Gesetz in Kraft ist, das von Musik- und Filmindustrie gepriesen wird und bei Anwälten des offenen Netzes verhasst ist. Digitale Verkäufe, die in Frankreich nur langsam starteten, haben jetzt erheblich zugenommen. Die Einnahmen der Musikindustrie stabilisieren sich." Es profitiert vor allem Itunes, dessen Verkäufe in Frankreich stark zugenommen haben. Pfanner zitiert Jérémie Zimmermann von La Quadrature du Net, der sagt, dass zum Download nun allerdings auch andere Software genutzt wird, die von Hadopi nicht überwacht werden kann.
Kommentieren