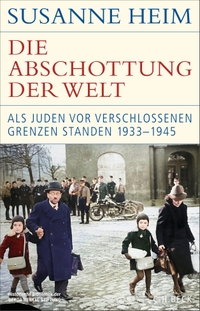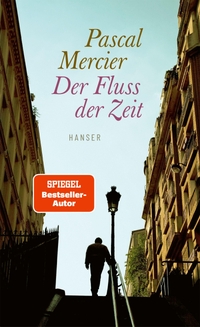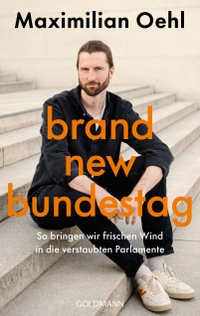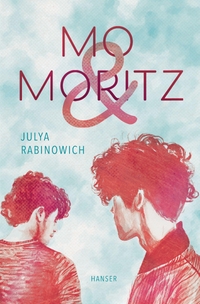Magazinrundschau
Das Konversations-Web
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
19.02.2019. 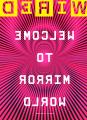 Das New York Times erklärt, wie jeder Nordkoreaner durch das Songbun-System von Geburt an in eine Skala der ideologischen Zuverlässigkeit eingeordnet wird - ohne dass man ihn über seinen Platz in der Hierarchie informiert. In Magyar Narancs kritisiert der Cellist István Várdai die Musikausbildung in Deutschland. La Vie des Idees feiert die erste Gesamtausgabe des großen Filmkritikers André Bazin. Wired steigt ein in die kommende "Mirrorworld", während auf Eurozine Richard Sennett den Facebook-Einwohnern empfiehlt, mal in die Stadt zu gehen.
Das New York Times erklärt, wie jeder Nordkoreaner durch das Songbun-System von Geburt an in eine Skala der ideologischen Zuverlässigkeit eingeordnet wird - ohne dass man ihn über seinen Platz in der Hierarchie informiert. In Magyar Narancs kritisiert der Cellist István Várdai die Musikausbildung in Deutschland. La Vie des Idees feiert die erste Gesamtausgabe des großen Filmkritikers André Bazin. Wired steigt ein in die kommende "Mirrorworld", während auf Eurozine Richard Sennett den Facebook-Einwohnern empfiehlt, mal in die Stadt zu gehen.
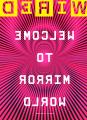 Das New York Times erklärt, wie jeder Nordkoreaner durch das Songbun-System von Geburt an in eine Skala der ideologischen Zuverlässigkeit eingeordnet wird - ohne dass man ihn über seinen Platz in der Hierarchie informiert. In Magyar Narancs kritisiert der Cellist István Várdai die Musikausbildung in Deutschland. La Vie des Idees feiert die erste Gesamtausgabe des großen Filmkritikers André Bazin. Wired steigt ein in die kommende "Mirrorworld", während auf Eurozine Richard Sennett den Facebook-Einwohnern empfiehlt, mal in die Stadt zu gehen.
Das New York Times erklärt, wie jeder Nordkoreaner durch das Songbun-System von Geburt an in eine Skala der ideologischen Zuverlässigkeit eingeordnet wird - ohne dass man ihn über seinen Platz in der Hierarchie informiert. In Magyar Narancs kritisiert der Cellist István Várdai die Musikausbildung in Deutschland. La Vie des Idees feiert die erste Gesamtausgabe des großen Filmkritikers André Bazin. Wired steigt ein in die kommende "Mirrorworld", während auf Eurozine Richard Sennett den Facebook-Einwohnern empfiehlt, mal in die Stadt zu gehen.Magyar Narancs (Ungarn), 19.02.2019
 Der Cellist István Várdai ist seit Oktober Professor am Fritz-Kreisler-Institut in Wien. Mit der Wochenzeitschrift Magyar Narancs Várdai spricht er unter anderem über die Bedeutung musikalischer Grundausbildung "Ich verließ Ungarn, um die Welt zu sehen, Impulse zu sammeln und international Kontakte zu knüpfen. Andererseits wäre ich nie soweit gekommen, wenn ich nicht so gute musikalische Grundlagen und Traditionen gehabt hätte wie dies in Ungarn der Fall ist. Wenn ich in Deutschland begonnen hätte, ist es überhaupt nicht sicher, dass ich je diese Ebene erreicht hätte. In Deutschland ist die musikalische Ausbildung von den Anfängen bis zur Universität eine Katastrophe. Ab vierzehn Jahren kann nur derjenige bei guten Lehrern lernen, dessen Eltern die Privatstunden bezahlen können. In ganz Deutschland gibt es lediglich in Weimar und in Berlin nennenswerte musikalische Weiterbildung." Auch das ungarische Musikleben sieht Várdai durchaus kritisch: "Ungarn wäre dann das Land von Bartók und Kodály, wenn es an jeder Ecke einen Chor geben würde, wenn die Menschen in ihrer Freizeit singen und musizieren würden. Das Konzept von Kodály war, dass die Musik unabhängig vom Alter für jeden wichtig und erreichbar gemacht wird."
Der Cellist István Várdai ist seit Oktober Professor am Fritz-Kreisler-Institut in Wien. Mit der Wochenzeitschrift Magyar Narancs Várdai spricht er unter anderem über die Bedeutung musikalischer Grundausbildung "Ich verließ Ungarn, um die Welt zu sehen, Impulse zu sammeln und international Kontakte zu knüpfen. Andererseits wäre ich nie soweit gekommen, wenn ich nicht so gute musikalische Grundlagen und Traditionen gehabt hätte wie dies in Ungarn der Fall ist. Wenn ich in Deutschland begonnen hätte, ist es überhaupt nicht sicher, dass ich je diese Ebene erreicht hätte. In Deutschland ist die musikalische Ausbildung von den Anfängen bis zur Universität eine Katastrophe. Ab vierzehn Jahren kann nur derjenige bei guten Lehrern lernen, dessen Eltern die Privatstunden bezahlen können. In ganz Deutschland gibt es lediglich in Weimar und in Berlin nennenswerte musikalische Weiterbildung." Auch das ungarische Musikleben sieht Várdai durchaus kritisch: "Ungarn wäre dann das Land von Bartók und Kodály, wenn es an jeder Ecke einen Chor geben würde, wenn die Menschen in ihrer Freizeit singen und musizieren würden. Das Konzept von Kodály war, dass die Musik unabhängig vom Alter für jeden wichtig und erreichbar gemacht wird."Hier eine Kodaly-Aufnahme Vardais:
The Bitter Southerner (USA), 18.02.2019
The Atlantic (USA), 18.02.2019
 Anstatt aus dem Westen Liberalismus und Demokratie zu importieren, infiltriert Russlands Kleptokratie die USA, klagt Franklin Foer. 52 Prozent des russischen Vermögens haben die Oligarchen außer Landes geschafft, sie stecken ihre Milliarden vor allem in Immobilien, denn für diese gelten in den USA - seltsamerweise - nicht die strengen Gesetze gegen die Geldwäsche. Die vornehmen Herren großer Anwaltskanzleien und die Vorsteher von Großstädten, Geschäftsimperien oder Steueroasen können von dem Geld gar nicht genug bekommen: "2013 fragt New Yorks damaliger Bürgermeister Michael Bloomberg: 'Wäre es nicht großartig, wenn all die russischen Milliardäre hierherkämen?' Solch ein Willkommensbekunden hat zu seltsamen Dissonanzen in der amerikanischen Politik geführt. Nehmen wir den Aluminiummagnaten Oleg Deripaska, der immer wieder in der Untersuchungen zu den russischen Einmischung im Präsidentschaftswahlkampf von 2016 auftaucht. Das Außenministerium verweigerte ihm, mit Blick auf die - von ihm bestrittenen - Verbindungen zum Organisierten Verbrechen in Russland, jahrelang die Einreise in die USA. Solche Befürchtungen standen ihm nicht im Weg beim Kauf eines herrschaftlichen Hauses auf Manhattans Upper East Side für 42 Millionen Dollar und eines weiteren Anwesens in der Nähe von Washingtons Botschaftsviertel. Mit der Zeit wurde die Kluft zwischen den noblen Intentionen des Patriot Act und der schmutzigen Realität des Wohungsmarktes so groß, dass sie nicht mehr ignoriert werden konnte. 2016 testete die Regierung Obama ein Programm, um die Immobilienbranche mit dem Bankensektor in Einklang zu bringen und Makler zu zwingen, ebenfalls ausländische Käufer zu melden - das Pilotprojekt in Miami und Manhattan hätte zum Gerüst für eine tragfähige Reglementierung werden können. Aber dann kam ein Präsidentenwechsel und ein Hausbesitzer kam an die Macht. Obamas Nachfolger verkaufte gern Wohnungen an anonyme Käufer aus dem Ausland - und ist vielleicht von ihrem Geld abhängig geworden."
Anstatt aus dem Westen Liberalismus und Demokratie zu importieren, infiltriert Russlands Kleptokratie die USA, klagt Franklin Foer. 52 Prozent des russischen Vermögens haben die Oligarchen außer Landes geschafft, sie stecken ihre Milliarden vor allem in Immobilien, denn für diese gelten in den USA - seltsamerweise - nicht die strengen Gesetze gegen die Geldwäsche. Die vornehmen Herren großer Anwaltskanzleien und die Vorsteher von Großstädten, Geschäftsimperien oder Steueroasen können von dem Geld gar nicht genug bekommen: "2013 fragt New Yorks damaliger Bürgermeister Michael Bloomberg: 'Wäre es nicht großartig, wenn all die russischen Milliardäre hierherkämen?' Solch ein Willkommensbekunden hat zu seltsamen Dissonanzen in der amerikanischen Politik geführt. Nehmen wir den Aluminiummagnaten Oleg Deripaska, der immer wieder in der Untersuchungen zu den russischen Einmischung im Präsidentschaftswahlkampf von 2016 auftaucht. Das Außenministerium verweigerte ihm, mit Blick auf die - von ihm bestrittenen - Verbindungen zum Organisierten Verbrechen in Russland, jahrelang die Einreise in die USA. Solche Befürchtungen standen ihm nicht im Weg beim Kauf eines herrschaftlichen Hauses auf Manhattans Upper East Side für 42 Millionen Dollar und eines weiteren Anwesens in der Nähe von Washingtons Botschaftsviertel. Mit der Zeit wurde die Kluft zwischen den noblen Intentionen des Patriot Act und der schmutzigen Realität des Wohungsmarktes so groß, dass sie nicht mehr ignoriert werden konnte. 2016 testete die Regierung Obama ein Programm, um die Immobilienbranche mit dem Bankensektor in Einklang zu bringen und Makler zu zwingen, ebenfalls ausländische Käufer zu melden - das Pilotprojekt in Miami und Manhattan hätte zum Gerüst für eine tragfähige Reglementierung werden können. Aber dann kam ein Präsidentenwechsel und ein Hausbesitzer kam an die Macht. Obamas Nachfolger verkaufte gern Wohnungen an anonyme Käufer aus dem Ausland - und ist vielleicht von ihrem Geld abhängig geworden."Weiteres: Ross Andersen besucht eine von Jain betriebene Vogelklinik in Delhi, die schon immer ahnten, dass nicht nur die großen Säuger, sondern alle Tiere Bewusstsein haben. In der nicht online stehenden Titelgeschichte pocht Yoni Appelbaum auf ein Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump.
La vie des idees (Frankreich), 15.02.2019

Zu dem Artikel gehört ein Video-Gespräch mit dem Herausgeber Hervé Joubert-Laurencin. Hinzuweisen ist auch auf ein Bazin-Heft der Zeitschrift Critique.
HVG (Ungarn), 14.02.2019
 Der Regisseur Béla Tarr hat sich seinem letzten Film ("Das Turiner Pferd", Silberner Bär 2011, unsere Kritik) vom Filmemachen zurückgezogen, baute jedoch eine Filmakademie in Sarajewo auf, stellte eine Ausstellung in Amsterdam zusammen und arbeitet gegenwärtig an einer neuen Ausstellung für die Wiener Festwochen. In der Online-Ausgabe der Wochenzeitschrift HVG sprach er anlässlich der Berlinale unter anderem über den Unterschied zwischen Theater und Film sowie über seine Ratschläge für junge Filmemacher. "Viele Menschen lieben das Theater, weil es die Kunst des Augenblicks ist. Was an dem einen Abend passiert, ist am nächsten Abend anders. Mich aber stört genau dies. Ich habe mich beim Film daran gewöhnt, dass, wenn eine Szene fertig war, wir sie in die Kiste legten, und sie für ewig so bleibt. (…) Den jüngeren Generationen muss man vermitteln, dass nur das wichtig ist, was sie sehen und wie sie es sehen. Und sie sollen es bitteschön so zeigen, wie sie es empfinden. Das ist Filmemachen, der Rest ist Blabla und raffinierter Blödsinn. Ein freier Mensch hat mehr Fantasie, ein freier Mensch hat eine Welt, ein freier Mensch kann alles greifen. Die Freiheit ist das Wichtigste, man muss in allen Bereichen des Lebens frei sein."
Der Regisseur Béla Tarr hat sich seinem letzten Film ("Das Turiner Pferd", Silberner Bär 2011, unsere Kritik) vom Filmemachen zurückgezogen, baute jedoch eine Filmakademie in Sarajewo auf, stellte eine Ausstellung in Amsterdam zusammen und arbeitet gegenwärtig an einer neuen Ausstellung für die Wiener Festwochen. In der Online-Ausgabe der Wochenzeitschrift HVG sprach er anlässlich der Berlinale unter anderem über den Unterschied zwischen Theater und Film sowie über seine Ratschläge für junge Filmemacher. "Viele Menschen lieben das Theater, weil es die Kunst des Augenblicks ist. Was an dem einen Abend passiert, ist am nächsten Abend anders. Mich aber stört genau dies. Ich habe mich beim Film daran gewöhnt, dass, wenn eine Szene fertig war, wir sie in die Kiste legten, und sie für ewig so bleibt. (…) Den jüngeren Generationen muss man vermitteln, dass nur das wichtig ist, was sie sehen und wie sie es sehen. Und sie sollen es bitteschön so zeigen, wie sie es empfinden. Das ist Filmemachen, der Rest ist Blabla und raffinierter Blödsinn. Ein freier Mensch hat mehr Fantasie, ein freier Mensch hat eine Welt, ein freier Mensch kann alles greifen. Die Freiheit ist das Wichtigste, man muss in allen Bereichen des Lebens frei sein."Medium (USA), 12.02.2019
Novinky.cz (Tschechien), 06.02.2019
Ebenfalls in "Novinky" bedauert Judith Hermann im Gespräch mit Zuzana Lizcová eine Veränderung bei deutschen Schriftstellerlesungen: "Ich mag sehr den Dialog mit dem Publikum, mir machen die Fragen der Zuhörer Spaß. Leider wird das aber weniger. In letzter Zeit werden Autorenlesungen in Deutschland immer moderiert. Ein Moderator verhindert Fragen aus dem Publikum, das sich dann nicht mehr traut, wenn er schon gesprochen hat. Die Leute fürchten, eine dumme Frage zu stellen. Was schade ist, weil ihre Fragen in der Regel viel interessanter und überraschender sind als die der bezahlten Profis."
Wired (USA), 18.02.2019
 In zwei langen Beiträgen befasst sich Wired mit der nächsten Generation der Online-Nutzung, die dramatische Auswirkungen auf unseren Alltag haben könnten und das Internet völlig neu strukturieren werden - und nicht eben unbedingt zum Besseren. Schon jetzt gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass Internetnutzung in Zukunft immer weniger auf Schrift und Text, sondern immer mehr auf gesprochener Sprache basieren wird, schreibt James Vlahos mit dem Blick auf den Siegeszug von Geräten wie Alexa Echo und Konsorten, die mehr und mehr darauf trainiert werden, auf jede Frage im Nu die eine richtige Antwort parat zu haben. Nicht mehr eine Auswahl an Suchergebnissen wie jetzt noch bei Google steht dann noch im Vordergrund, sondern ein algorithmischer Auswahl- und Verknüpfungsprozess, der passabel liefert. "Diese Bewegung hin zu eindeutigen Antworten hat sich langsam genug vollzogen, um eine seiner wichtigsten Konsequenzen zu vertuschen: Das Internet, wie wir es kennen, zu zerstören. Das konventionelle Web, mit all seinen mühsamen Seiten und Links, macht Platz für das Konversations-Web, in dem plaudernde KIs die Herrschaft übernehmen. Dies führe zu mehr Komfort und Effizienz, erzählt man uns. Aber für jeden, der wirtschaftliche Interessen hat, die an traditionelle Webrecherche geknüpft sind - Werber, Autoren, Verlage, Tech-Giganten - ist diese Situation lebensgefährlich."
In zwei langen Beiträgen befasst sich Wired mit der nächsten Generation der Online-Nutzung, die dramatische Auswirkungen auf unseren Alltag haben könnten und das Internet völlig neu strukturieren werden - und nicht eben unbedingt zum Besseren. Schon jetzt gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass Internetnutzung in Zukunft immer weniger auf Schrift und Text, sondern immer mehr auf gesprochener Sprache basieren wird, schreibt James Vlahos mit dem Blick auf den Siegeszug von Geräten wie Alexa Echo und Konsorten, die mehr und mehr darauf trainiert werden, auf jede Frage im Nu die eine richtige Antwort parat zu haben. Nicht mehr eine Auswahl an Suchergebnissen wie jetzt noch bei Google steht dann noch im Vordergrund, sondern ein algorithmischer Auswahl- und Verknüpfungsprozess, der passabel liefert. "Diese Bewegung hin zu eindeutigen Antworten hat sich langsam genug vollzogen, um eine seiner wichtigsten Konsequenzen zu vertuschen: Das Internet, wie wir es kennen, zu zerstören. Das konventionelle Web, mit all seinen mühsamen Seiten und Links, macht Platz für das Konversations-Web, in dem plaudernde KIs die Herrschaft übernehmen. Dies führe zu mehr Komfort und Effizienz, erzählt man uns. Aber für jeden, der wirtschaftliche Interessen hat, die an traditionelle Webrecherche geknüpft sind - Werber, Autoren, Verlage, Tech-Giganten - ist diese Situation lebensgefährlich."Das andere Zukunftsszenario des Internets ist "Mirrorworld" - eine Augmented-Reality-Lösung, die extrem rechenintensiv, extrem datenintensiv, extrem alltagsinvasiv ist, für die das Internet räumlich wird und sich als Datenlayer über die kartografierte tatsächliche Wirklichkeit legt. Bewerkstelligt werden könnte dies über immer mehr Kameras in allen möglichen Geräten, die klein aber effektiv sind und vor allem so smart, dass sie räumliche Umgebungen hervorragend analysieren können. Was Kevin Kelly nicht daran hindert, im Science-Fiction-Rausch davon zu galoppieren und sich diese "Mirrorworld" auszumalen: "Die Street-View-Ansichten in Google Maps sind lediglich Fassaden, flache, aneinandergeklebte Bilder. Aber in der Mirrorworld wird ein virtuelles Gebäude Volumen haben, ein virtueller Stuhl wird Stuhl-artigkeit ausstrahlen und eine virtuelle Straße verfügt über Schichten von Texturen, Lücken und anderen Unwägbarkeiten, die alle einen Sinn von 'Straße' vermitteln. Die Mirrorword - ein erstmals von Yale-Informatiker David Gelernter popularisierter Begriff - wird nicht nur reflektieren, wie etwas aussieht, sondern auch dessen Kontext, Bedeutung und Funktion. Wir werden damit interagieren, es manipulieren und damit genau wie in der echten Welt umgehen. Zunächst mag die Mirrorworld lediglich den Eindruck einer hochaufgelösten Schicht von Informationen erwecken, die sich über die echte Welt legt. Vielleicht sehen wir ein Namensschild über einer Person, mit der wir schon mal zu tun hatten. Vielleicht auch einen blauen Pfeil, der uns darauf hinweist, an welcher Ecke wir abbiegen sollten. Oder wir stoßen an interessanten Orten auf hilfreiche Hinweise. ... Schlussendlich werden wir in der Lage sein, den physischen Raum genauso zu durchsuchen wie Text: 'Zeig mir alle Orte mit einer Parkbank, von der aus sich der Sonnenaufgang über einem Fluss beobachten lässt'."
Eurozine (Österreich), 14.02.2019
 Eurozine bringt eine geraffte Version der Democracy Lecture, die Richard Sennett für die Blätter für deutsche und internationale Politik gehalten hat. Sennetts Vortrag war ein großes Plädoyer für die offene Stadt und gegen geschlossene Systeme, für Komplexität und gegen Klarheit, für Inklusion und gegen Schönheit. Vor allem huldigt er einer Stadt, in der Menschen anders sein können, nicht im "netten liberalen Sinne" anders, sondern richtig, verstörend anders: "Das Geschlossene zeigt sich heute vor allem darin, dass Menschen nicht mehr glauben, mit Komplexität klarzukommen, mit Unterschieden, mit Menschen, die man nicht mag, und Situationen, die man nicht kennt. Diese Unfähigkeit, mit Abweichungen klarzukommen kommt einer kapitalistischen Ökonomie zugute, die davon profitiert, dass die Leute nur noch wollen, was bequem und gewohnt ist. Ich will gar nicht über Facebook sprechen, aber es ist offensichtlich, dass Facebook ein System der Geschlossenheit ist, mit seiner davon profitierenden Vampir-Technologie. Städte können für Menschen eine Schule sein, sich kompetenter zu fühlen. Gerade wegen ihrer Komplexität ermöglichen Städte den Menschen, die in ihnen leben, sich kompetenter zu fühlen, klarzukommen, nicht gleich die Fassung zu verlieren, wenn man einen Schwarzen, einen Flüchtling auf der Straße sieht. Ein Großteil unserer politischen Probleme resultiert aus diesem Zusammenwirken von einem ersehnten Rückzug und einer Ökonomie, die aus der Personalisierung Kapital schlägt, aus der Bequemlichkeit, aus der leichten Bedienbarkeit. Nutzerfreundlichkeit ist eine schreckliche, wirklich schreckliche Idee. Nutzerfreundlichkeit bedeutet, dass man keine Stimulation bekommt. Eine Stadt sollte nicht benutzerfreundlich sein. Sie sollte in Ort sein, an dem man lernt, mit schwierigen Situationen und mit anderen Menschen umzugehen - das macht sie offen."
Eurozine bringt eine geraffte Version der Democracy Lecture, die Richard Sennett für die Blätter für deutsche und internationale Politik gehalten hat. Sennetts Vortrag war ein großes Plädoyer für die offene Stadt und gegen geschlossene Systeme, für Komplexität und gegen Klarheit, für Inklusion und gegen Schönheit. Vor allem huldigt er einer Stadt, in der Menschen anders sein können, nicht im "netten liberalen Sinne" anders, sondern richtig, verstörend anders: "Das Geschlossene zeigt sich heute vor allem darin, dass Menschen nicht mehr glauben, mit Komplexität klarzukommen, mit Unterschieden, mit Menschen, die man nicht mag, und Situationen, die man nicht kennt. Diese Unfähigkeit, mit Abweichungen klarzukommen kommt einer kapitalistischen Ökonomie zugute, die davon profitiert, dass die Leute nur noch wollen, was bequem und gewohnt ist. Ich will gar nicht über Facebook sprechen, aber es ist offensichtlich, dass Facebook ein System der Geschlossenheit ist, mit seiner davon profitierenden Vampir-Technologie. Städte können für Menschen eine Schule sein, sich kompetenter zu fühlen. Gerade wegen ihrer Komplexität ermöglichen Städte den Menschen, die in ihnen leben, sich kompetenter zu fühlen, klarzukommen, nicht gleich die Fassung zu verlieren, wenn man einen Schwarzen, einen Flüchtling auf der Straße sieht. Ein Großteil unserer politischen Probleme resultiert aus diesem Zusammenwirken von einem ersehnten Rückzug und einer Ökonomie, die aus der Personalisierung Kapital schlägt, aus der Bequemlichkeit, aus der leichten Bedienbarkeit. Nutzerfreundlichkeit ist eine schreckliche, wirklich schreckliche Idee. Nutzerfreundlichkeit bedeutet, dass man keine Stimulation bekommt. Eine Stadt sollte nicht benutzerfreundlich sein. Sie sollte in Ort sein, an dem man lernt, mit schwierigen Situationen und mit anderen Menschen umzugehen - das macht sie offen."New York Times (USA), 17.02.2019
 Für einen Beitrag der aktuellen Ausgabe besucht Travis Jeppesen Pjöngjang und stellt fest, dass der Schwarzmarkt blüht und das traditionelle Klassensystem Nordkoreas sich aufzulösen beginnt: "Bei der Geburt erhält jeder nordkoreanische Bürger eine Klassifizierung, die vor ihm geheim gehalten wird. Dieses System nennt sich 'Songbun', es besteht aus drei Hauptkategorien - loyal, wankelmütig und feindlich - und 51 Unterkategorien, die als Qualifikanten dienen. Songbun ist wesentlich, was die Chancen eines Bürgers im Leben betrifft, und familienabhängig. Die Chancen hängen davon ab, was Eltern, Großeltern, Urgroßeltern in den Jahren der Gründung des Landes oder früher getan haben. Diejenigen, deren Ahnen vor der Befreiung 1945 mit Kim Il-sung in der Guerilla gegen die japanischen Besatzer gekämpft haben, stehen auf der höchsten Stufe des Songbun. Sie nehmen heute die höchsten Ränge in der Regierung ein. Diejenigen, die als 'feindlich' eingestuft sind, können Nachkommen ehemaliger Grundbesitzer oder Kollaborateure sein, oder sie haben Verwandte in Südkorea oder sind Christen. Sie sind größtenteils in die gebirgigen, unwirtlichen Regionen des Landes verbannt, dürfen nicht nach Pjöngjang oder andere Großstädte einreisen und sind gezwungen, ein entbehrungsreiches Leben als Bauern oder Handwerker zu führen, fast ohne Chance auf Entwicklung. Auch wenn die meisten Nordkoreaner nicht genau wissen, auf welcher Stufe sie stehen, kann jeder von ihnen sie doch intuitiv erfassen, je nachdem, wo sie leben, wer ihre Vorfahren waren, wie ihre Möglichkeiten sich gestalten und wie hoch der Grad ihrer Diskriminierung ist. Songbun, obwohl ein Bestandteil des Polizeistaats, ist historisch an die traditionelle zentrale Planwirtschaft des Nordens gebunden. Es gibt Hinweise darauf, dass sich dieses politische Klassensystem mit der Entwicklung eines freien Marktes auflösen wird."
Für einen Beitrag der aktuellen Ausgabe besucht Travis Jeppesen Pjöngjang und stellt fest, dass der Schwarzmarkt blüht und das traditionelle Klassensystem Nordkoreas sich aufzulösen beginnt: "Bei der Geburt erhält jeder nordkoreanische Bürger eine Klassifizierung, die vor ihm geheim gehalten wird. Dieses System nennt sich 'Songbun', es besteht aus drei Hauptkategorien - loyal, wankelmütig und feindlich - und 51 Unterkategorien, die als Qualifikanten dienen. Songbun ist wesentlich, was die Chancen eines Bürgers im Leben betrifft, und familienabhängig. Die Chancen hängen davon ab, was Eltern, Großeltern, Urgroßeltern in den Jahren der Gründung des Landes oder früher getan haben. Diejenigen, deren Ahnen vor der Befreiung 1945 mit Kim Il-sung in der Guerilla gegen die japanischen Besatzer gekämpft haben, stehen auf der höchsten Stufe des Songbun. Sie nehmen heute die höchsten Ränge in der Regierung ein. Diejenigen, die als 'feindlich' eingestuft sind, können Nachkommen ehemaliger Grundbesitzer oder Kollaborateure sein, oder sie haben Verwandte in Südkorea oder sind Christen. Sie sind größtenteils in die gebirgigen, unwirtlichen Regionen des Landes verbannt, dürfen nicht nach Pjöngjang oder andere Großstädte einreisen und sind gezwungen, ein entbehrungsreiches Leben als Bauern oder Handwerker zu führen, fast ohne Chance auf Entwicklung. Auch wenn die meisten Nordkoreaner nicht genau wissen, auf welcher Stufe sie stehen, kann jeder von ihnen sie doch intuitiv erfassen, je nachdem, wo sie leben, wer ihre Vorfahren waren, wie ihre Möglichkeiten sich gestalten und wie hoch der Grad ihrer Diskriminierung ist. Songbun, obwohl ein Bestandteil des Polizeistaats, ist historisch an die traditionelle zentrale Planwirtschaft des Nordens gebunden. Es gibt Hinweise darauf, dass sich dieses politische Klassensystem mit der Entwicklung eines freien Marktes auflösen wird."Außerdem schaut Clive Thompson zurück auf die gute alte Zeit der ersten Computer, als Frauen noch bis zu 35 Prozent der Programmierarbeit verrichteten: "Als Unternehmen in den fünfziger und sechziger Jahren begannen, für ihre Buchhaltung Software zu verwenden und die Zahl der Programmier-Jobs explodierte, waren Männer nicht besonders im Vorteil. Arbeitgeber bevorzugten logisch denkende Menschen, die gut in Mathematik waren und sorgfältig arbeiteten, also vor allem Frauen. Einige behaupteten, die üblicherweise Frauen vorbehaltenen Arbeiten wie Stricken und Weben offenbarten genau diese Voraussetzungen. Das Buch 'Your Career in Computers' von 1968 legte sogar nahe, dass Leute, die gern mit Kochbüchern kochten, gute Programmierer abgaben."
Kommentieren