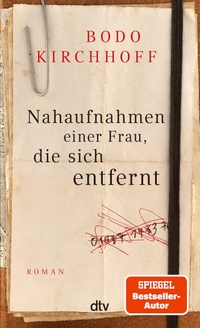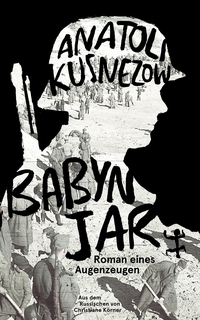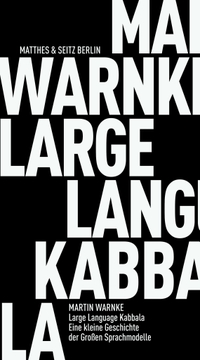Magazinrundschau
Hm, das ist komisch
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
10.01.2012. Werden Bücher bald eine Art Wiki von Autor und Übersetzer, fragt Il Sole 24 Ore. Rue 89 berichtet aus dem Tangokrieg in Buenos Aires. Wie wurde Luther populär? Mit Hilfe sozialer Netzwerke, weiß der Economist. In Guernica spricht die koreanische Dichterin Kim Hyesoon mit der Stimme des Außenseiters. Die Boston Review denkt mit Michael Nielsen über wissenschaftliche Evidenz nach. In Vanity Fair lässt Christopher Hitchens ein, zwei Dostojewskis fallen. Der New Yorker schildert den Einstieg Youtubes ins TV-Geschäft.
Il Sole 24 Ore (Italien), 08.01.2012
 Der italienische Verlag Bompiani hat für Ende Januar eine Version 2.0 von "Der Name der Rose" angekündigt. Mario Andreose weist auf die große Bedeutung des Übersetzens und der Übersetzer für Umberto Eco hin und kann sich Bücher in Zukunft als eine Art Wiki von Autor und Übersetzern vorstellen. "Eco hat ja damit begonnen, seinen Übersetzern eine Art Dossier mit Instruktionen an die Hand zu geben, mit Vorschlägen zu weiterer Literatur für den geschichtlichen, kulturellen und sprachlichen Hintergrund, mit bibliografischen Hinweisen, Zitaten und Formulierungsvorschlägen, möglichen Varianten und Alternativbegriffen, natürlich immer mit Blick darauf, dass jede literarische Tradition ganz bestimmte Lösungen verlangt. Daran schließt sich ein bis zum Erscheinen der Übersetzung fortwährend geführtes Gespräch an, in der die Übersetzer ihre Kritik am Text mit Eco teilen, nachdem sie sich schon untereinander ausgetauscht haben. Die Übersetzer haben seit dem ersten Erscheinen der 'Rose' eine Gemeinschaft gebildet und trafen sich auch zu gemeinsamen Sitzungen. Ich kann mir gut vorstellen dass die Überlegungen der Übersetzer eines Tages als Korrekturschleife in den Originaltext einfließen. Und ich kann mir einen derartigen Mechanismus nicht nur beim 'Namen der Rose' vorstellen."
Der italienische Verlag Bompiani hat für Ende Januar eine Version 2.0 von "Der Name der Rose" angekündigt. Mario Andreose weist auf die große Bedeutung des Übersetzens und der Übersetzer für Umberto Eco hin und kann sich Bücher in Zukunft als eine Art Wiki von Autor und Übersetzern vorstellen. "Eco hat ja damit begonnen, seinen Übersetzern eine Art Dossier mit Instruktionen an die Hand zu geben, mit Vorschlägen zu weiterer Literatur für den geschichtlichen, kulturellen und sprachlichen Hintergrund, mit bibliografischen Hinweisen, Zitaten und Formulierungsvorschlägen, möglichen Varianten und Alternativbegriffen, natürlich immer mit Blick darauf, dass jede literarische Tradition ganz bestimmte Lösungen verlangt. Daran schließt sich ein bis zum Erscheinen der Übersetzung fortwährend geführtes Gespräch an, in der die Übersetzer ihre Kritik am Text mit Eco teilen, nachdem sie sich schon untereinander ausgetauscht haben. Die Übersetzer haben seit dem ersten Erscheinen der 'Rose' eine Gemeinschaft gebildet und trafen sich auch zu gemeinsamen Sitzungen. Ich kann mir gut vorstellen dass die Überlegungen der Übersetzer eines Tages als Korrekturschleife in den Originaltext einfließen. Und ich kann mir einen derartigen Mechanismus nicht nur beim 'Namen der Rose' vorstellen."Wall Street Journal (USA), 31.12.2011
Nicholas Carr denkt darüber nach, was es für das Buch bedeutet, wenn der digitale Inhalt nicht mehr starr, sondern veränderbar ist. Eigentlich eine gute Sache, meint er, "Reiseführer werden ihre Leser nicht mehr in Restaurants schicken, die längst geschlossen sind oder in einst charmante Kneipen, die sich in Flohsäcke verwandelt haben". Aber was, wenn Verlage feststellen, dass die Leser eines Romans immer an einer bestimmten Stelle die Lektüre abbrechen. Werden sie den Autor zwingen, an diese Stelle das Wort "Sex" einzufügen?
Rue89 (Frankreich), 08.01.2012
 Einen sehr interessanten und ausführlichen Hintergrundartikel über den "Krieg des Tangos" in Buenos Aires schreibt Claude Mary für Rue89: Es gibt inzwischen eine große alternative Tango-Bewegung, die den Tango in Kneipen und auf die Straßen bringt, aber von der Stadt nach Kräften behindert wird, weil man ein offizielles Bild des Tangos hochhalten und die Touristen in künstliche und überteuerte Tango-Paläste schleusen will. Ähnlich läuft es mit dem großen Tango-Festival der Stadt: "Im August 2010 scheute sich der Bürgermeister von Buenos Aires in der Eröffnungsrede des Festivals nicht, den Tango als 'unser urbanes Soja' zu präsentieren, also als ein x-beliebiges und vor allem höchst rentables kommerzielles Produkt. Das offizielle Festival zieht 400.000 Besucher an, viele aus dem Ausland und die Gewinne belaufen sich auf Millionen Pesos. Die Stadt bezeichnet den Tango als 'wesentliche Achse der Kulturstrategie'. Aber im Lauf der Jahre wurde das Festival immer mehr in einem gesichtslosen Messezentrum zentralisiert, während die Stadt selbst unzählige Festsäle anbietet, die den Besuchern und der Bevölkerung viel zugänglicher sind."
Einen sehr interessanten und ausführlichen Hintergrundartikel über den "Krieg des Tangos" in Buenos Aires schreibt Claude Mary für Rue89: Es gibt inzwischen eine große alternative Tango-Bewegung, die den Tango in Kneipen und auf die Straßen bringt, aber von der Stadt nach Kräften behindert wird, weil man ein offizielles Bild des Tangos hochhalten und die Touristen in künstliche und überteuerte Tango-Paläste schleusen will. Ähnlich läuft es mit dem großen Tango-Festival der Stadt: "Im August 2010 scheute sich der Bürgermeister von Buenos Aires in der Eröffnungsrede des Festivals nicht, den Tango als 'unser urbanes Soja' zu präsentieren, also als ein x-beliebiges und vor allem höchst rentables kommerzielles Produkt. Das offizielle Festival zieht 400.000 Besucher an, viele aus dem Ausland und die Gewinne belaufen sich auf Millionen Pesos. Die Stadt bezeichnet den Tango als 'wesentliche Achse der Kulturstrategie'. Aber im Lauf der Jahre wurde das Festival immer mehr in einem gesichtslosen Messezentrum zentralisiert, während die Stadt selbst unzählige Festsäle anbietet, die den Besuchern und der Bevölkerung viel zugänglicher sind."Economist (UK), 07.01.2012
 Ein Artikel zeichnet ein zerrissenes Bild von Ägypten am Vorabend des ersten Jahrestags der Revolution: "Regierungssender bejubeln die Armee als Verteidiger der Ordnung. Rivalisierende Privatsender machen eine davon absolut abweichende Perspektive stark, indem sie über Polizeibrutalität, Wahlbetrug und die geistige Beschränktheit der Regierung berichten. Einige Videoaufnahmen scheinen Protestierer zu zeigen, die bei gewaltsamen Auseinandersetzungen Mitte Dezember, an deren Ende 17 Tote zu beklagen waren, eine Bibliothek mit seltenen Büchern im Stadtzentrum Kairos in Brand setzen. Davon abweichendes Bildmaterial zeigt Protestierer im noblen Kampf gegen die Flammen, während die Soldaten zuschauen."
Ein Artikel zeichnet ein zerrissenes Bild von Ägypten am Vorabend des ersten Jahrestags der Revolution: "Regierungssender bejubeln die Armee als Verteidiger der Ordnung. Rivalisierende Privatsender machen eine davon absolut abweichende Perspektive stark, indem sie über Polizeibrutalität, Wahlbetrug und die geistige Beschränktheit der Regierung berichten. Einige Videoaufnahmen scheinen Protestierer zu zeigen, die bei gewaltsamen Auseinandersetzungen Mitte Dezember, an deren Ende 17 Tote zu beklagen waren, eine Bibliothek mit seltenen Büchern im Stadtzentrum Kairos in Brand setzen. Davon abweichendes Bildmaterial zeigt Protestierer im noblen Kampf gegen die Flammen, während die Soldaten zuschauen."Vielleicht sollten die Rebellen es mit Musik als Verbreitungsmittel probieren. Wie wurde schließlich Luther populär? Nicht nur durch Pamphlete! Schon im 16. Jahrhundert waren soziale Netzwerke und Songs zur Verbreitung von Neuigkeiten populär, so der Economist: "Die Nachrichtenballade war, wie das Pamphlet, eine relativ neue Medienform. Sie verknüpfte eine poetische und oft übertriebene Beschreibung zeitgenössischer Ereignisse mit einer vertrauten Melodie, die leicht gelernt, gesungen und an andere weitergegeben werden konnte. Nachrichtenballaden waren oft Parodien, die absichtlich fromme Melodien mit säkularen oder sogar profanen Texten mischten. Sie wurden als gedruckte lyrics verbreitet, mit einem Hinweis, zu welcher Melodie sie gesungen werden sollten. Einmal gelernt, konnten sie durch gemeinsames Singen auch unter den Analphabeten verbreitet werden."
Außerdem: Eine neue Doppelbiografie über Ayaan Hirsi Ali und Aafia Siddiqui kontrastiert beider Lebensläufe in einer "unheimlichen Symmetrie" ähnlicher Lebensumstände, die zu völlig unterschiedlichen Konsequenzen führten, wie man dieser Besprechung entnehmen kann. Alte Violinen klingen besser als neue? Offenbar doch nicht zwangsläufig, folgt man diesen Darlegungen zu einer neuen Studie. Außerdem werden zwei neue Buchveröffentlichungen besprochen, die sich mit Muslimen in Europa befassen. Der Aufmacher singt ein derartiges Liebeslied auf den Londoner Finanzdistrikt, dass der Wirtschaftsjournalist Ian Fraser ihn im Blog Naked Capitalism als "intellektuell armselig" beschimpft.
Elet es Irodalom (Ungarn), 06.01.2012
 In literarischen Zeitschriften Ungarns findet seit einigen Monaten eine Debatte über Vergangenheit, Gegenwart und mögliche Zukunft des politischen Gedichts statt. Die meisten ungarischen Autoren hatten sich zwar in den vergangenen Jahrzehnten von politischen Themen abgewendet. Dennoch sieht der Kritiker Sandor Bazsanyi einen Ausgangspunkt für die politische Dichtung: "Nach meiner für den persönlichen Gebrauch formulierten Auffassung von politischen Gedichten sprechen diese gegenüber der jeweiligen Gemeinschaft die im 'hier und jetzt' gegebene Situation an, und dabei sollten sie, wovon sie sprechen, mit möglichst direkten Mitteln, also so genau wie möglich, gar leidenschaftlich beim Namen nennen. [...] Und so sollte nach meiner Ansicht die ungarische politische Dichtung von heute sein: Bildhaft, aber nicht kosmologisch; direkt, aber nicht propagandistisch; gewichtig, aber nicht ideologisch; und vor allem: leidenschaftlich, aber nicht borniert."
In literarischen Zeitschriften Ungarns findet seit einigen Monaten eine Debatte über Vergangenheit, Gegenwart und mögliche Zukunft des politischen Gedichts statt. Die meisten ungarischen Autoren hatten sich zwar in den vergangenen Jahrzehnten von politischen Themen abgewendet. Dennoch sieht der Kritiker Sandor Bazsanyi einen Ausgangspunkt für die politische Dichtung: "Nach meiner für den persönlichen Gebrauch formulierten Auffassung von politischen Gedichten sprechen diese gegenüber der jeweiligen Gemeinschaft die im 'hier und jetzt' gegebene Situation an, und dabei sollten sie, wovon sie sprechen, mit möglichst direkten Mitteln, also so genau wie möglich, gar leidenschaftlich beim Namen nennen. [...] Und so sollte nach meiner Ansicht die ungarische politische Dichtung von heute sein: Bildhaft, aber nicht kosmologisch; direkt, aber nicht propagandistisch; gewichtig, aber nicht ideologisch; und vor allem: leidenschaftlich, aber nicht borniert."Guernica (USA), 01.01.2012
 Ruth Williams stellt die koreanische Dichterin Kim Hyesoon vor, die sich beharrlich weigert, von Liebe, Schönheit und anderen zarten Dingen zu singen. Im Interview sagt sie: "Die koreanischen Dichter ließen mich nicht in ihre Zirkel. Ich konnte auch kein Vorbild unter koreanischen Dichterinnen finden. Ich hatte keine Lehrer, keine erfahrenen Kollegen oder Mitstreiter. Die Kritiker trampelten auf meinen grotesken Bildern herum, sie schäumten. Ich bedaure sehr, dass Leser nur das zu mögen scheinen, woran sie gewöhnt sind. Nach und nach wurde mir klar, dass die Stimme des Außenseiters für einen Dichter die authentischste ist."
Ruth Williams stellt die koreanische Dichterin Kim Hyesoon vor, die sich beharrlich weigert, von Liebe, Schönheit und anderen zarten Dingen zu singen. Im Interview sagt sie: "Die koreanischen Dichter ließen mich nicht in ihre Zirkel. Ich konnte auch kein Vorbild unter koreanischen Dichterinnen finden. Ich hatte keine Lehrer, keine erfahrenen Kollegen oder Mitstreiter. Die Kritiker trampelten auf meinen grotesken Bildern herum, sie schäumten. Ich bedaure sehr, dass Leser nur das zu mögen scheinen, woran sie gewöhnt sind. Nach und nach wurde mir klar, dass die Stimme des Außenseiters für einen Dichter die authentischste ist."Liu Xiaobos Essays, auf Deutsch unter dem Titel "Ich habe keine Feinde, ich kenne keinen Hass" erschienen, kommen nun auch auf Englisch heraus. Im Guernica Magazine ist vorab ein Text zu lesen, in dem der Friedensnobelpreisträger sehr kritisch Chinas Großmachtsfantasien betrachtet: "Wenn dem Aufstieg dieser großen Diktatur mit ihrer rapide wachsenden Wirtschaftskraft nicht von außen Einhalt geboten, sondern ihm vom internationalen Mainstream nur beschwichtigend gegenüber getreten wird, und wenn es den Kommunisten erneut gelingt, China auf einen desaströs falschen Weg abwärts zu führen, dann werden die Folgen nicht nur eine Katastrophe für das chinesischen Volk sein, sondern auch ein Desaster für die Verbreitung der liberalen Demokratie in der Welt."
Merkur (Deutschland), 05.01.2012
 Der in der Schweiz lebende russische Schriftsteller Michail Schischkin erzählt von den beglückenden oder erschütternden Erfahrung, die man beim Überschreiten von Grenzen machen kann. Er zum Beispiel sei Russland immer näher gekommen, je weiter er weggegangen sei: "Ich dolmetschte die Befragungen der Flüchtlinge aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Geschichten, die nicht schrecklich sind, gab es da nicht. Ich war in die Schweiz ausgereist und im Epizentrum des russischen Schmerzes gelandet."
Der in der Schweiz lebende russische Schriftsteller Michail Schischkin erzählt von den beglückenden oder erschütternden Erfahrung, die man beim Überschreiten von Grenzen machen kann. Er zum Beispiel sei Russland immer näher gekommen, je weiter er weggegangen sei: "Ich dolmetschte die Befragungen der Flüchtlinge aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Geschichten, die nicht schrecklich sind, gab es da nicht. Ich war in die Schweiz ausgereist und im Epizentrum des russischen Schmerzes gelandet." Wenn Europa nicht auseinanderbrechen soll, muss Deutschland die Hegemonie übernehmen, meint der Konstanzer Jurist Christoph Schönberger, aber diesmal bitte etwas umsichtiger: "Die Hegemonie in der Europäischen Union fordert von den deutschen Eliten und der deutschen Öffentlichkeit im Grunde etwas, das Deutschlands Lage in der Mitte Europas von ihnen schon immer verlangt hat: den Verzicht auf nationale Introvertiertheit; die aufmerksame Kenntnis, Beobachtung und Beeinflussung der europäischen Nachbarn; die Definition des eigenen Interesses unter Einbeziehung der Interessenlage der Partner; das Voraus- und Mitdenken für Europa insgesamt."
Außerdem: Rainer Hank plädiert für eine selbstbewusste Kleinstaaterei und gegen den Euro. Ekkehard Knörer liest Walter Boehlich. Auf Christian Demands programmatischen "Blick zurück nach vorn" haben wir bereits in der Feuilletonrundschau hingewiesen.
Boston Review (USA), 09.01.2012
 Lindsey Gilbert spricht mit Michael Nielsen, Autor von "Reinventing Discovery" (Leseprobe) und großer Befürworter einer Open Science, über kollektive Intelligenz und über wissenschaftliche Projekte, die auch Laien einbeziehen, wie Polymath (mehr hier) oder Galaxy Zoo (mehr hier). Auch wissenschaftliche Evidenz entsteht für Nielsen weniger aus genialer Eingebung als aus diskursiven Prozessen: "Isaac Asimov war es, glaube ich, der erzählt hat, wie wissenschaftliche Entdeckungen wirklich aussehen. Da schreit niemand 'Eureka, ich hab's gefunden', sondern es diskutiert eher ein Wissenschaftler mit einem anderen, den er vielleicht gerade getroffen hat, und sagt 'hm, das ist komisch', weil irgendetwas nicht recht zu stimmen scheint. Aus solchen kleinen Momenten können große Entdeckungen erwachsen."
Lindsey Gilbert spricht mit Michael Nielsen, Autor von "Reinventing Discovery" (Leseprobe) und großer Befürworter einer Open Science, über kollektive Intelligenz und über wissenschaftliche Projekte, die auch Laien einbeziehen, wie Polymath (mehr hier) oder Galaxy Zoo (mehr hier). Auch wissenschaftliche Evidenz entsteht für Nielsen weniger aus genialer Eingebung als aus diskursiven Prozessen: "Isaac Asimov war es, glaube ich, der erzählt hat, wie wissenschaftliche Entdeckungen wirklich aussehen. Da schreit niemand 'Eureka, ich hab's gefunden', sondern es diskutiert eher ein Wissenschaftler mit einem anderen, den er vielleicht gerade getroffen hat, und sagt 'hm, das ist komisch', weil irgendetwas nicht recht zu stimmen scheint. Aus solchen kleinen Momenten können große Entdeckungen erwachsen."Ebenfalls in der Boston Review: Claude S. Fischer, Soziologe aus Berkeley, bespricht das vielleicht am meisten rezensierte Buch der Saison: Steven Pinkers "The Better Angels of our Nature" (deutsch: "Gewalt - Eine neue Geschichte der Menschheit"). An die gute Nachricht, dass die Menschen weniger Gewalt ausüben denn je, will er glauben, aber nicht an Pinkers Erklärungen dafür.
Poetry Foundation (USA), 10.01.2012
 "Wir warten alle auf Flüchtlinge", schreibt Eliza Griswold (Website) aus Lampedusa in Reportage, die weder vor Lyrik noch vor Fakten zurückscheut: "Die Afrikaner, die aus Libyen kommen, sind keine Libyer. Sie sind Bürger aus dem Tschad, Sudan, Somalia, Guinea, der Elfenbeinküste, Nigeria und anderen Ländern. Viele sind Flüchtlinge, die aus ihrer Heimat nach Libyen geflohen sind. Jahrelang haben sie versucht Muammar Gaddafi zu überrennen, der im Gegenzug ihre Passage nach Europa versperrte. Neben libyschem Öl waren es Gaddafis entsetzliche Gefängnisse für Einwanderer, die ihm Freunde in Europa sicherten."
"Wir warten alle auf Flüchtlinge", schreibt Eliza Griswold (Website) aus Lampedusa in Reportage, die weder vor Lyrik noch vor Fakten zurückscheut: "Die Afrikaner, die aus Libyen kommen, sind keine Libyer. Sie sind Bürger aus dem Tschad, Sudan, Somalia, Guinea, der Elfenbeinküste, Nigeria und anderen Ländern. Viele sind Flüchtlinge, die aus ihrer Heimat nach Libyen geflohen sind. Jahrelang haben sie versucht Muammar Gaddafi zu überrennen, der im Gegenzug ihre Passage nach Europa versperrte. Neben libyschem Öl waren es Gaddafis entsetzliche Gefängnisse für Einwanderer, die ihm Freunde in Europa sicherten."Vanity Fair (USA), 10.01.2012
 In seinem letzten Artikel schrieb Christopher Hitchens eine Hommage auf Charles Dickens, der angeblich 1862 bei einem Treffen in London mit Dostojewski einige Selbstbekenntnisse abgelegt haben soll. Auf Russisch findet sich davon keine Spur, meint Hitchens, und auch Dickens hat es nie erwähnt. Macht nichts. "Es war schön, so lange es andauerte, dieses Gerücht über ein Treffen zweier literarischer Titanen: eine Begegnung, die einer von beiden nicht mal interessant genug fand um sie in einem Brief zu erwähnen. Es hätte passiert sein können, aber ich bezweifle es. Das ist das Wundervolle daran, Charles Dickens zu feiern: Er gehört wirklich zu unseren Unsterblichen, und es spielt wirklich keine Rolle, wenn die Legende wachsen und dann hier und da einen oder zwei Dostojewskis fallen lassen würde."
In seinem letzten Artikel schrieb Christopher Hitchens eine Hommage auf Charles Dickens, der angeblich 1862 bei einem Treffen in London mit Dostojewski einige Selbstbekenntnisse abgelegt haben soll. Auf Russisch findet sich davon keine Spur, meint Hitchens, und auch Dickens hat es nie erwähnt. Macht nichts. "Es war schön, so lange es andauerte, dieses Gerücht über ein Treffen zweier literarischer Titanen: eine Begegnung, die einer von beiden nicht mal interessant genug fand um sie in einem Brief zu erwähnen. Es hätte passiert sein können, aber ich bezweifle es. Das ist das Wundervolle daran, Charles Dickens zu feiern: Er gehört wirklich zu unseren Unsterblichen, und es spielt wirklich keine Rolle, wenn die Legende wachsen und dann hier und da einen oder zwei Dostojewskis fallen lassen würde."Außerdem: Salman Rushdies Nachruf auf Hitchens.
New Yorker (USA), 16.01.2012
 Google steigt mit Youtube immer aktiver ins TV-Geschäft ein, schreibt John Seabrook in einer langen Reportage für den New Yorker. Seabrook hat Robert Kyncl getroffen, der das Programm für Youtube aufbaut. Es sollen neue Youtube-Kanäle mit möglichst großer Gefolgschaft geschaffen werden: Kyncl "stellt mehrere Millionen Dollar als Startkapital zur Verfügung, die als Vorschüsse auf spätere Werbeeinnahmen bezahlt werden und als Entwicklungsgeld dienen. Sobald die Vorschüsse zurückverdient sind, wird Youtube die Werbeeinahmen mit den Kreativen teilen. Youtube behält das exklusive Recht am Inhalt für ein Jahr, dann können die Kreativen darüber verfügen. Youtube wird zwar Anzeigen verkaufen, aber kein Geld in die Promotion der Inhalte stecken." Die Liste der ersten Channel-Betreiber liest sich recht prominent und reicht - vermittelt über Produktionsfirmen - von Madonna über Jay-Z, bis hin zu Kanälen für lateinamerikanische Jugendliche oder Ablegern von Slate und dem Wall Street Journal."
Google steigt mit Youtube immer aktiver ins TV-Geschäft ein, schreibt John Seabrook in einer langen Reportage für den New Yorker. Seabrook hat Robert Kyncl getroffen, der das Programm für Youtube aufbaut. Es sollen neue Youtube-Kanäle mit möglichst großer Gefolgschaft geschaffen werden: Kyncl "stellt mehrere Millionen Dollar als Startkapital zur Verfügung, die als Vorschüsse auf spätere Werbeeinnahmen bezahlt werden und als Entwicklungsgeld dienen. Sobald die Vorschüsse zurückverdient sind, wird Youtube die Werbeeinahmen mit den Kreativen teilen. Youtube behält das exklusive Recht am Inhalt für ein Jahr, dann können die Kreativen darüber verfügen. Youtube wird zwar Anzeigen verkaufen, aber kein Geld in die Promotion der Inhalte stecken." Die Liste der ersten Channel-Betreiber liest sich recht prominent und reicht - vermittelt über Produktionsfirmen - von Madonna über Jay-Z, bis hin zu Kanälen für lateinamerikanische Jugendliche oder Ablegern von Slate und dem Wall Street Journal."Außerdem: David Remnick widmet Jodi Kantors neuem Buch (Leseprobe) über die Obamas eine ziemlich lange Besprechung dafür, dass das Buch im wesentlichen eine ausführlichere Darstellung ihres Obama-Porträts in der NYT ist und kaum etwas neues erzählt. Und David Denby sah im Kino Stephen Daldrys Verfilmung von Jonathan Safran Foers Roman "Extrem laut und unglaublich nah" sowie Cameron Crowes Film "We Bought a Zoo".
Kommentieren