Magazinrundschau
So viel mehr Sterne
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
29.09.2009. Mother Jones erzählt, warum kein Grüner sich mit Fiji-Mineralwasser erwischen lassen sollte. Zeitungen mögen im Netz ihren Markenwert verlieren, Journalisten könnten ihn dort erst gewinnen, überlegt Le Monde. Nicht die Zukunft, die Gegenwart ist heute die eigentliche Inspiration, meint der französische Soziologen Michel Maffesoli in Clarin. Im Espresso erzählt der Mafioso Francesco Fonti, warum die Entführung Aldo Moros die Mafia nervös machte. In Poets and Writers erklärt der Literaturagent Georges Borchardt, was die größte Veränderung im Verlagsgeschäft war: befristete Verträge.
Mother Jones (USA), 01.09.2009
 Al Gore trinkt es, Barack Obama und Paris Hilton trinken es. Die High Society liebt es und die Grünen lieben es: Fiji Mineralwasser. "Obwohl es vom entgegengesetzten Ende der Welt importiert wird, obwohl es drei mal so teuer ist wie gewöhnliches Mineralwasser im Supermarkt, ist Fiji heute das meistgekaufte Mineralwasser in Amerika, Evian hat es hinter sich gelassen", erzählt Anna Lenzer in einer Reportage, die einen buchstäblich sprachlos lässt. "Nirgendwo in dem glamourösen Marketingmaterial von Fiji Wasser findet man einen Hinweis auf die Typhusfälle, die die Fidschianer plagen. Schuld daran ist die mangelhafte Wasserversorgung; die Betriebe der Firma sind - trotz des Geredes der [amerikanisch-kanadischen] Eigentümer über finanzielle Transparenz - in Steueroasen wie den Cayman Inseln und Luxemburg angemeldet; oder die Tatsache, dass die charakteristische Flasche aus chinesischem Plastik in einem dieselgetriebenem Werk hergestellt und tausende von Meilen zu ihren ökobewussten Konsumenten verschifft wird. Und man findet natürlich auch keine Erwähnung der Militärjunta, für die Fiji Wasser globale Bekanntheit und Anerkennung bedeutet."
Al Gore trinkt es, Barack Obama und Paris Hilton trinken es. Die High Society liebt es und die Grünen lieben es: Fiji Mineralwasser. "Obwohl es vom entgegengesetzten Ende der Welt importiert wird, obwohl es drei mal so teuer ist wie gewöhnliches Mineralwasser im Supermarkt, ist Fiji heute das meistgekaufte Mineralwasser in Amerika, Evian hat es hinter sich gelassen", erzählt Anna Lenzer in einer Reportage, die einen buchstäblich sprachlos lässt. "Nirgendwo in dem glamourösen Marketingmaterial von Fiji Wasser findet man einen Hinweis auf die Typhusfälle, die die Fidschianer plagen. Schuld daran ist die mangelhafte Wasserversorgung; die Betriebe der Firma sind - trotz des Geredes der [amerikanisch-kanadischen] Eigentümer über finanzielle Transparenz - in Steueroasen wie den Cayman Inseln und Luxemburg angemeldet; oder die Tatsache, dass die charakteristische Flasche aus chinesischem Plastik in einem dieselgetriebenem Werk hergestellt und tausende von Meilen zu ihren ökobewussten Konsumenten verschifft wird. Und man findet natürlich auch keine Erwähnung der Militärjunta, für die Fiji Wasser globale Bekanntheit und Anerkennung bedeutet."Noch ein Hinweis auf das Juliheft: Der Schriftsteller William T. Vollmann erklärt im Interview über sein neues Buch "Imperial", warum es so viel schwieriger sein kann, Literatur zu schreiben als ein Sachbuch: man muss genauer sein. "Ich glaube wir alle sind, als menschliche Wesen, so begrenzt. Wenn wir über uns selbst schreiben wollen, ist das ziemlich einfach. Und wenn wir über unsere Freunde schreiben oder unsere Familien, können wir das tun. Aber wenn wir uns in etwas hineinversetzen wollen, das jenseits unserer persönlichen Erfahrung liegt, dann scheitern wir, bis wir mehr Erfahrung oder sie uns von anderen geborgt haben. Wenn ich als blinder Passagier auf einem Zug fahre ['train hopping' ist ein Hobby von Vollmann, Anm. Red.] und in den Himmel sehe, dann gibt es immer so viel mehr Sterne als ich in Erinnerung habe."
Le Monde (Frankreich), 28.09.2009
Was wäre, wenn die fünfzig besten Journalisten der New York Times die Tageszeitung verließen und eine eigene Internetzeitung gründeten? Ausgehend von dieser Fragestellung des amerikanischen Bloggers Michael Arrington untersucht Xavier Ternison das amerikanische Phänomen des personal branding im Journalismus. Dahinter verbirgt sich der Umstand, dass Journalisten dort zu "Marken" werden, die eine treue Gefolg- beziehungsweise Leserschaft an sich binden können. "Der Aufschwung des Multimediajournalismus hat die Herausgeber dazu verführt, auf das Konzept der Presse als Marke zu setzen: Im Informationsdschungel des Internets wird der Titel einer Zeitschrift oder Tageszeitung, die ihr Erscheinen auf mehrere Fassungen stützt, für den Nutzer zu einem Garanten für Seriosität und Glaubwürdigkeit. Doch das Internet als großartiges Werkzeug der Informationsverbreitung – und auch der Eigenwerbung – könnte sehr wohl dazu beitragen, die Namen einiger Journalisten in Marken zu verwandeln, die sich auch völlig alleine und ohne Hilfe einer bekannten Stütze verkaufen." Ternison zitiert Arrington, der auf die Webseite Politico verweist, die von zwei ehemaligen Politikjournalisten der Washington Post gegründet wurde: "Die haben ihre eigene Marke und ihre Glaubwürdigkeit mitgenommen, und die Leser sind ihnen gefolgt. (...) Journalisten haben heutzutage eine hohe Relevanz, vor allem gute."
Clarin (Argentinien), 26.09.2009
"Die Zukunft setzt keine Energien mehr frei." Hector Pavon interviewt den französischen Soziologen Michel Maffesoli, der gerade in Buenos Aires ein Seminar abhält: "Arbeit, Vernunft, Zukunft, das waren die drei großen Werte der Moderne. In unserer Zeit - wir nennen sie provisorisch Postmoderne, einfach weil es noch keinen passenden Ausdruck dafür gibt, 2050 sind wir vielleicht soweit, dass wir einen haben - dreht sich dagegen fast alles um Kreation, Imagination, Gegenwart. Und während Europa das Laboratorium der Moderne war, sind Lateinamerika und Ostasien die Laboratorien dieser 'Postmoderne'. Hier arbeitet man intensiv an diesen Dingen, hier spielt die Imagination eine große Rolle, hier geht es nicht nur um Arbeit, sondern immer auch um Kreation, hier gibt es Zukunft, aber immer auch Gegenwart. Auch in Europa gab es Zeiten, die ganz auf die Gegenwart ausgerichtet waren, die Renaissance etwa oder das 3. und 4. Jahrhundert, die Zeit des Untergangs Roms - und eine solche Zeit steuern wir meiner Einschätzung nach gerade wieder an."
Economist (UK), 25.09.2009
 "Das mit Abstand wichtigste Instrument für den Fortschritt in den Entwicklungsländern" ist - so ein Experte der Columbia-Universität - das Handy. Ein ganzer Schwerpunkt ist dem Thema im aktuellen Economist gewidmet. Darin wird unter anderem erklärt, wie die Telekom-Unternehmen mit dem technischen Rückstand, also etwa mangelnder Stromversorgung, innovativ umzugehen gelernt haben. Und man erfährt, wie in Afrika per mobiler Überweisung Geldgeschäfte auch abseits der Städte schnell und einfach erledigt werden können. (Die Banken sperren sich freilich gegen die unerwartete Konkurrenz.) Nicht zuletzt aber profitieren, wie ein weiterer Artikel erläutert, jene Mikro-Geschäftsleute, die weltweit 50 bis 60 und in Afrika etwa 90 Prozent aller Unternehmer ausmachen: "Träger, Zimmermänner und andere selbständige Arbeiter können an Laternenpfählen und Schwarzen Brettern Werbung für ihre Dienste machen und potenzielle Auftraggeber um Kontaktaufnahme per Handy bitten. Iqbal Qadir, ein in den USA lebender Investment-Banker aus Bangladesch, erzählt gerne die Geschichte eines Friseurs in Bangladesch, der sich die Miete für einen Laden nicht leisten konnte und stattdessen ein Handy und ein Motorrad erwarb. So konnte er telefonisch Termine vereinbaren und seine Kunden in ihrer Wohnung aufsuchen. Für die Kunden war das bequemer und er konnte auf diese Weise ein größeres Gebiet abdecken und außerdem mehr Geld verlangen."
"Das mit Abstand wichtigste Instrument für den Fortschritt in den Entwicklungsländern" ist - so ein Experte der Columbia-Universität - das Handy. Ein ganzer Schwerpunkt ist dem Thema im aktuellen Economist gewidmet. Darin wird unter anderem erklärt, wie die Telekom-Unternehmen mit dem technischen Rückstand, also etwa mangelnder Stromversorgung, innovativ umzugehen gelernt haben. Und man erfährt, wie in Afrika per mobiler Überweisung Geldgeschäfte auch abseits der Städte schnell und einfach erledigt werden können. (Die Banken sperren sich freilich gegen die unerwartete Konkurrenz.) Nicht zuletzt aber profitieren, wie ein weiterer Artikel erläutert, jene Mikro-Geschäftsleute, die weltweit 50 bis 60 und in Afrika etwa 90 Prozent aller Unternehmer ausmachen: "Träger, Zimmermänner und andere selbständige Arbeiter können an Laternenpfählen und Schwarzen Brettern Werbung für ihre Dienste machen und potenzielle Auftraggeber um Kontaktaufnahme per Handy bitten. Iqbal Qadir, ein in den USA lebender Investment-Banker aus Bangladesch, erzählt gerne die Geschichte eines Friseurs in Bangladesch, der sich die Miete für einen Laden nicht leisten konnte und stattdessen ein Handy und ein Motorrad erwarb. So konnte er telefonisch Termine vereinbaren und seine Kunden in ihrer Wohnung aufsuchen. Für die Kunden war das bequemer und er konnte auf diese Weise ein größeres Gebiet abdecken und außerdem mehr Geld verlangen." Espresso (Italien), 25.09.2009
 Francesco Fonti ist einer der bekanntesten Mafiosi Italiens. Im Jahr 2005 hatten seine Aussagen umfangreiche Ermittlungen zum Handel mit Giftmüll und radioaktiven Abfällen in Kalabrien eingeleitet. Jetzt spricht er in einem Video, das der Espresso auf seiner Seite ausstrahlt, über seine Rolle im Fall Aldo Moro. Der führende Politiker der italienischen christdemokratischen Partei DC wurde am 16. März 1978 von den roten Brigaden entführt und später ermordet. Fonti sollte Moro retten, sagt er - im Auftrag der DC. Riccardo Bocca protokollierte die Aussage. "Am Morgen des 20. März 1978 kam Giuseppe Romeo in meine Wohnung an der Ionischen Küste in Kalabrien. Er war der Bruder des Bosses Sebastiano, der damals an der Spitze der Familie von San Luca stand. 'Sebastiano will Dich unverzüglich sehen', sagte Giuseppe. Das sind Worte, bei denen man nicht nachfragen muss. Sebastiano war nicht nur mein Chef, sondern auch einer der mächtigsten Männer der 'Ndrangheta. Deshalb diskutierte ich nicht, sondern gehorchte und fand mich wenig später an dem ovalen Tisch in seinem Salon wieder. Ich war angespannt, wusste nicht, was mich erwartet. Er aber verlor keine Zeit. 'Ciccio, hast Du diese unschöne Geschichte mit Aldo Moro mitbekommen?', sagte er. 'Wir müssen da was machen. Mach Dich auf den Weg nach Rom. Dort musst Du mit Hilfe unserer Landsmänner und deinen Kontakten bei diesen Schwanzlutschern vom Geheimdienst herausfinden, wo sich die Brigadisten verstecken, die den Präsidenten entführt haben.' Sebastiano gab mir keine Zeit, etwas zu sagen. Ihn beunruhigte der nationale Alarm, der wegen des Falls Moro ausgerufen worden war. Das störte die Geschäfte unserer Organisation. 'Ich habe Druck von zwei Seiten bekommen', sagte er. Riccardo Misasi und Vito Napoli haben mich angerufen (damals Spitzenkandidaten der kalabresischen Christdemokraten), aber auch gewisse Leute aus Rom...'"
Francesco Fonti ist einer der bekanntesten Mafiosi Italiens. Im Jahr 2005 hatten seine Aussagen umfangreiche Ermittlungen zum Handel mit Giftmüll und radioaktiven Abfällen in Kalabrien eingeleitet. Jetzt spricht er in einem Video, das der Espresso auf seiner Seite ausstrahlt, über seine Rolle im Fall Aldo Moro. Der führende Politiker der italienischen christdemokratischen Partei DC wurde am 16. März 1978 von den roten Brigaden entführt und später ermordet. Fonti sollte Moro retten, sagt er - im Auftrag der DC. Riccardo Bocca protokollierte die Aussage. "Am Morgen des 20. März 1978 kam Giuseppe Romeo in meine Wohnung an der Ionischen Küste in Kalabrien. Er war der Bruder des Bosses Sebastiano, der damals an der Spitze der Familie von San Luca stand. 'Sebastiano will Dich unverzüglich sehen', sagte Giuseppe. Das sind Worte, bei denen man nicht nachfragen muss. Sebastiano war nicht nur mein Chef, sondern auch einer der mächtigsten Männer der 'Ndrangheta. Deshalb diskutierte ich nicht, sondern gehorchte und fand mich wenig später an dem ovalen Tisch in seinem Salon wieder. Ich war angespannt, wusste nicht, was mich erwartet. Er aber verlor keine Zeit. 'Ciccio, hast Du diese unschöne Geschichte mit Aldo Moro mitbekommen?', sagte er. 'Wir müssen da was machen. Mach Dich auf den Weg nach Rom. Dort musst Du mit Hilfe unserer Landsmänner und deinen Kontakten bei diesen Schwanzlutschern vom Geheimdienst herausfinden, wo sich die Brigadisten verstecken, die den Präsidenten entführt haben.' Sebastiano gab mir keine Zeit, etwas zu sagen. Ihn beunruhigte der nationale Alarm, der wegen des Falls Moro ausgerufen worden war. Das störte die Geschäfte unserer Organisation. 'Ich habe Druck von zwei Seiten bekommen', sagte er. Riccardo Misasi und Vito Napoli haben mich angerufen (damals Spitzenkandidaten der kalabresischen Christdemokraten), aber auch gewisse Leute aus Rom...'"Boston Review (USA), 01.09.2009
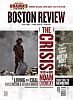 Wundervoller Stoff zum Stehlen! Jordan Davis taucht beglückt in Anthologien zeitgenössischer Gedichte aus Deutschland, Russland, Vietnam und der Türkei, die jetzt in englischer Übersetzung erscheinen. Und das Stehlen findet er unter Berufung auf T.S. Eliot nicht nur richtig, sondern auch notwendig: "Damit sie nicht immer nur über sich selbst sprechen müssen, um sich inspirieren zu lassen und etwas Wiedererkennbares auf ungewöhnliche Art sagen zu können, geben Dichter vor, generalisieren, schreiben ein besonders eigentümliches Detail fort und eignen sich an, was nicht ihres ist. Übersetzung und Anzeige fremder Einflüsse gehören zu den Königsmitteln dieser Flucht vorm Selbst und seinen unbrechbaren Regeln, auch wenn sie nur zu anderen, ebenso unbrechbaren Regeln führen. Eliot, ein Regelfanatiker, betonte beides: die Notwendigkeit des Diebstahls aus 'zeitlich entfernten, sprachlich fremden oder inhaltlich abweichenden' Quellen und die Notwendigkeit, etwas Besseres daraus zu machen."
Wundervoller Stoff zum Stehlen! Jordan Davis taucht beglückt in Anthologien zeitgenössischer Gedichte aus Deutschland, Russland, Vietnam und der Türkei, die jetzt in englischer Übersetzung erscheinen. Und das Stehlen findet er unter Berufung auf T.S. Eliot nicht nur richtig, sondern auch notwendig: "Damit sie nicht immer nur über sich selbst sprechen müssen, um sich inspirieren zu lassen und etwas Wiedererkennbares auf ungewöhnliche Art sagen zu können, geben Dichter vor, generalisieren, schreiben ein besonders eigentümliches Detail fort und eignen sich an, was nicht ihres ist. Übersetzung und Anzeige fremder Einflüsse gehören zu den Königsmitteln dieser Flucht vorm Selbst und seinen unbrechbaren Regeln, auch wenn sie nur zu anderen, ebenso unbrechbaren Regeln führen. Eliot, ein Regelfanatiker, betonte beides: die Notwendigkeit des Diebstahls aus 'zeitlich entfernten, sprachlich fremden oder inhaltlich abweichenden' Quellen und die Notwendigkeit, etwas Besseres daraus zu machen."The Nation (USA), 12.10.2009
 Die Kapitalismuskritikerin Naomi Klein hat den neuen, kapitalismuskritischen Film von Michael Moore gesehen und findet ihn wundervoll. Im Gespräch (auch als Podcast) zwischen den beiden geht es natürlich auch um Barack Obama und seine kapitalismusfreundlichen Berater und Minister wie Lawrence Summers und Timothy Geithner. Und zwar so: "NK: Wir wollen immer Obama psychoanalysieren und ich höre oft, dass ihn diese Leute übers Ohr hauen. Aber er hat sie ausgesucht und wir sollten ihn nach diesen Taten beurteilen. MM: Genau. Ich glaube nicht, dass sie ihn übers Ohr hauen. Ich glaube, dass er schlauer ist als alle zusammen. Als er sie ernannte, hatte ich gerade ein Interview mit einem Bankräuber gemacht - und zwar einem, den die großen Banken engagiert haben, damit er ihnen sagt, wie sie Überfälle vermeiden können. Aha, habe ich mir gedacht, schon um nicht in bittere Verzweiflung zu sinken, das also hat Obama im Sinn. Wen anderes sollte er engagieren als die Leute, die das ganze Schlamassel angerichtet haben? Er holt sie in seine Nähe, damit sie das, was sie verschuldet haben, selbst wieder in Ordnung bringen. Ja, ja. So muss es sein, habe ich mir wieder und wieder gesagt."
Die Kapitalismuskritikerin Naomi Klein hat den neuen, kapitalismuskritischen Film von Michael Moore gesehen und findet ihn wundervoll. Im Gespräch (auch als Podcast) zwischen den beiden geht es natürlich auch um Barack Obama und seine kapitalismusfreundlichen Berater und Minister wie Lawrence Summers und Timothy Geithner. Und zwar so: "NK: Wir wollen immer Obama psychoanalysieren und ich höre oft, dass ihn diese Leute übers Ohr hauen. Aber er hat sie ausgesucht und wir sollten ihn nach diesen Taten beurteilen. MM: Genau. Ich glaube nicht, dass sie ihn übers Ohr hauen. Ich glaube, dass er schlauer ist als alle zusammen. Als er sie ernannte, hatte ich gerade ein Interview mit einem Bankräuber gemacht - und zwar einem, den die großen Banken engagiert haben, damit er ihnen sagt, wie sie Überfälle vermeiden können. Aha, habe ich mir gedacht, schon um nicht in bittere Verzweiflung zu sinken, das also hat Obama im Sinn. Wen anderes sollte er engagieren als die Leute, die das ganze Schlamassel angerichtet haben? Er holt sie in seine Nähe, damit sie das, was sie verschuldet haben, selbst wieder in Ordnung bringen. Ja, ja. So muss es sein, habe ich mir wieder und wieder gesagt." Weitere Artikel: William F. Baker, Journalismus-Professor und langjährigre Präsident der größten öffentlichen Rundfunkstation der USA WNet plädiert für die Rettung des US-Journalismus durch Stiftungen, aber auch durch staatliche Unterstützung. Als strahlendes Vorbild empfiehlt er die britische BBC und auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland. Als Zukunft des Ballets feiert Marina Harss den 1968 in Sankt Petersburg geborenen Tänzer und Choreografen Alexei Ratmansky, den ersten "artist in residence" des American Ballet Theater überhaupt. (Hier ein kurzer Video-Eindruck einer Ratmansky-Choreografie.)
Nouvel Observateur (Frankreich), 24.09.2009
 Der Essayist, Lyriker und Hochschullehrer Abdelwahab Meddeb plädiert auch in seinem jüngsten Buch "Pari de civilisation" (Seuil) erneut für einen modernen, aufgeklärten Islam als Verbindungsglied zwischen dem Osten und dem Westen. Im Gespräch erklärt er unter anderem, weshalb darüber eher im Westen als in der arabisch-muslimischen Welt selbst nachgedacht wird. "Die intellektuelle Kraft der islamischen Länder hat sich nach Europa und Amerika verlagert. Beide Länder partizipieren am postkolonialen Phänomen der Migration, auch der intellektuellen. Seither betreiben zahlreiche ursprünglich islamische Forscher und Akademiker Islamwissenschaft als eine internationale Wissenschaft. Ihr Beitrag befreit die Orientalistik vom Ethnozentrismusverdacht. (...) Unsere Arbeit hier hat dort Auswirkungen: Denn uns, die wir den Islam modernisieren wollen, stehen jene gegenüber, die die Moderne islamisieren wollen. Diese Modernisierungsarbeit betrifft auch Europa, weil wir im Westen einen modernen, der Säkularisation gerecht werdenden Islam brauchen."
Der Essayist, Lyriker und Hochschullehrer Abdelwahab Meddeb plädiert auch in seinem jüngsten Buch "Pari de civilisation" (Seuil) erneut für einen modernen, aufgeklärten Islam als Verbindungsglied zwischen dem Osten und dem Westen. Im Gespräch erklärt er unter anderem, weshalb darüber eher im Westen als in der arabisch-muslimischen Welt selbst nachgedacht wird. "Die intellektuelle Kraft der islamischen Länder hat sich nach Europa und Amerika verlagert. Beide Länder partizipieren am postkolonialen Phänomen der Migration, auch der intellektuellen. Seither betreiben zahlreiche ursprünglich islamische Forscher und Akademiker Islamwissenschaft als eine internationale Wissenschaft. Ihr Beitrag befreit die Orientalistik vom Ethnozentrismusverdacht. (...) Unsere Arbeit hier hat dort Auswirkungen: Denn uns, die wir den Islam modernisieren wollen, stehen jene gegenüber, die die Moderne islamisieren wollen. Diese Modernisierungsarbeit betrifft auch Europa, weil wir im Westen einen modernen, der Säkularisation gerecht werdenden Islam brauchen."Times Literary Supplement (UK), 25.09.2009
Es mag Autoren geben, die schon ab der ersten Zeile wissen, wie das Ende ihres Romans sein wird. Oder deren Figuren die Geschichte gewissermaßen selbst schreiben, wie es manchmal heißt. Bei William Golding war das ganz anders, und am deutlichsten zeigte sich das bei seinem Buch "Darkness Visible - Feuer der Finsternis", an dem er über zehn Jahre gearbeitet hat, lernt Allan Massie aus John Careys Golding-Biografie. "John Carey erzählt den Plot im Detail nach und hält fest, wie oft sich die Geschichte während des Schreibens änderte. 'Windover', notierte Golding im Januar 1974, 'ist möglicherweise ein farbiger Gentleman', der in ein anderes Land ausgeliefert wird, das ihn 'einbuchtet', vielleicht Portugal. Zwei Jahre später, bemerkt Carey, kommt ihm der Gedanke 'dass die richtige Person, die von der britischen Regierung gegen Öl ausgetauscht wird, ein Jude sein würde', deshalb könnte Windover ein 'farbiger Jude' sein, der vom MI5 und vielleicht ebenso von der CIA 'hereingelegt' wird. ... Zu seinem Verleger Monteith sagte er einmal: 'Die größte Schwierigkeit ist, dass ich auch nicht weiß, worum es in dem verdammten Ding geht.' Er hatte so viele Versionen geschrieben, 'dass ich mich nicht mehr erinnern kann, welche welche ist'."
Elet es Irodalom (Ungarn), 18.09.2009
Die institutionelle Kontinuität zwischen der späten Kadar-Ära und der Gegenwart erstreckt sich auf viel größere Bereiche als in der Öffentlichkeit zugegeben wird, meint der Soziologe Attila Melegh. Ihm zufolge leben die "freie Marktwirtschaft" und der Staat in Ungarn in einer parasitärer Symbiose, die auch für den Großteil der Strukturprobleme des Landes sorgt – worüber man aber nicht rational und neutral sprechen könne, weil in irgendeiner Form fast jeder davon betroffen sei und weil jede Äußerung von den politischen Gruppierungen missbraucht werde. Tibor Berczes fragte den Soziologen, worin sich diese Kontinuität am meisten bemerkbar macht: "Anstatt die wirtschaftliche Anpassungsfähigkeit des Landes und deren Bedeutung für die Gesellschaft zu analysieren, begnügte man sich [nach der Wende] damit, den Sozialismus als das Problem selbst zu identifizieren, das durch ein 'westliches' System abgelöst werden müsse – als würde eine bloße Kopie des westlichen Musters ausreichen. Alle bekundeten laut, dass das Staatseigentum abgeschafft werden müsse. Ob und wie sich aber die ungarische Wirtschaft und deren Akteure den neuen Herausforderungen anpassen werden, wurde außer Acht gelassen. Darüber hat man zu keinem Zeitpunkt gemeinsam nachgedacht, weder damals, noch heute."
Artforum (USA), 01.09.2009
 Bis zum 20. September in Oslos Nationalmuseum und demnächst in der Ikon Gallery in Birmingham ist eine Ausstellung des Schriftstellers und Künstlers Matias Faldbakken zu sehen: "Shocked into Abstraction". Nach der Einführung von Ina Blom beschreibt Feldbakken, wie er die Ausstellung angepackt hat: Erst mal hat er alles da stehen lassen, wo die Transporteure die Werke hingestellt hatten. "Danach war alles, was ich im Museum getan habe, ziemlich willkürlich. Ich versuche generell, Halbherzigkeit zum Kernstück meiner Produktion zu machen, als ob nur sehr wenig auf dem Spiel stünde. Es ist mir klar, dass das Museum - auch wenn es kein Ort ist, an dem ich meine ganze Zeit verbringen wollte - die einzige Institution ist, die es erlaubt, in dieser Art zu arbeiten. Ich kann mir keinen anderen Ort vorstellen, wo das möglich wäre und sogar gewürdigt wird. Und so kehrt meine Arbeit all die Konflikte und Ironien um, die mit der Institutionalisierung dieser Art von Strategien einhergeht."
Bis zum 20. September in Oslos Nationalmuseum und demnächst in der Ikon Gallery in Birmingham ist eine Ausstellung des Schriftstellers und Künstlers Matias Faldbakken zu sehen: "Shocked into Abstraction". Nach der Einführung von Ina Blom beschreibt Feldbakken, wie er die Ausstellung angepackt hat: Erst mal hat er alles da stehen lassen, wo die Transporteure die Werke hingestellt hatten. "Danach war alles, was ich im Museum getan habe, ziemlich willkürlich. Ich versuche generell, Halbherzigkeit zum Kernstück meiner Produktion zu machen, als ob nur sehr wenig auf dem Spiel stünde. Es ist mir klar, dass das Museum - auch wenn es kein Ort ist, an dem ich meine ganze Zeit verbringen wollte - die einzige Institution ist, die es erlaubt, in dieser Art zu arbeiten. Ich kann mir keinen anderen Ort vorstellen, wo das möglich wäre und sogar gewürdigt wird. Und so kehrt meine Arbeit all die Konflikte und Ironien um, die mit der Institutionalisierung dieser Art von Strategien einhergeht."Außerdem: Online lesen kann man die Artikel von Thomas Crow, Claire Bishop und Linda Norden über die Biennale in Venedig.
Tygodnik Powszechny (Polen), 27.09.2009
Schon Wochen vor dem "Kongress der polnischen Kultur" gab es kritische Diskussionen über ihren institutionellen Zustand. Nun widmet das Magazin dem Ereignis ein Dossier. "Nicht die Kultur ist in der Krise", meint der Theaterregisseur Krystian Lupa im Interview, "sondern das Milieu, das durch keine Verwaltungsreform geheilt werden kann". Das Verhältnis von Politik und Kultur müsse überdacht werden, so Lupa, nur fehle es in Polen an entsprechenden Eliten. "Vielleicht ist eine Stimme von außerhalb notwendig... Was für ein Echo hätten wir hierzulande, wenn eine Diskussion über die polnische Kultur in der französischen oder deutschen Presse begänne! Glauben Sie nicht?"
Poets & Writers (USA), 01.09.2009
 In einem epischen Interview erzählt der 1928 in Berlin geborene (und fabelhaft gutaussehende) Georges Borchardt von seinen Erfahrungen als Literaturagent. Im Grunde hat sich in dem Geschäft nicht viel verändert, meint er. Die größte Veränderung gab es, als die Verleger durch Manager abgelöst wurden. "Man macht nicht notwendigerweise Geld mit dem letzten Schrei. Das wirkliche Geld, wenn man auf Dauer setzt, kommt von Büchern wie diesen - von Büchern, die niemand wollte - ob sie nun von William Faulkner oder Elie Wiesel oder Beckett sind. Unglücklicherweise überzeugt dieses Argument heute keinen heutigen Verleger. Wenn Sie bei Random House oder einem der großen Verlage arbeiten, dann können Sie nicht sagen: 'Wir werden mit diesem Buch in den nächsten drei Jahren nicht viel Geld machen, aber in zehn Jahren wird uns jeder darum beneiden.' Der Typ, dem Sie das sagen, hat einen Vertrag, der noch zwei Jahre gilt und im nächsten Jahr neu verhandelt wird. Was bringt es ihm, ein Buch herauszubringen, das erst in zehn Jahren Geld einspielt? Nichts könnte ihn weniger kümmern. Er will ein Buch, das jetzt Geld macht, so dass er seinen Bossen sagen kann: 'Ihr solltet mir einen Fünf-Jahres-Vertrag für das Doppelte meines Gehalts geben.' Das hat sich also verändert und ich glaube, dass es auf das Verlegen Einfluss hat, mehr als all die anderen Krisen, die kommen und gehen."
In einem epischen Interview erzählt der 1928 in Berlin geborene (und fabelhaft gutaussehende) Georges Borchardt von seinen Erfahrungen als Literaturagent. Im Grunde hat sich in dem Geschäft nicht viel verändert, meint er. Die größte Veränderung gab es, als die Verleger durch Manager abgelöst wurden. "Man macht nicht notwendigerweise Geld mit dem letzten Schrei. Das wirkliche Geld, wenn man auf Dauer setzt, kommt von Büchern wie diesen - von Büchern, die niemand wollte - ob sie nun von William Faulkner oder Elie Wiesel oder Beckett sind. Unglücklicherweise überzeugt dieses Argument heute keinen heutigen Verleger. Wenn Sie bei Random House oder einem der großen Verlage arbeiten, dann können Sie nicht sagen: 'Wir werden mit diesem Buch in den nächsten drei Jahren nicht viel Geld machen, aber in zehn Jahren wird uns jeder darum beneiden.' Der Typ, dem Sie das sagen, hat einen Vertrag, der noch zwei Jahre gilt und im nächsten Jahr neu verhandelt wird. Was bringt es ihm, ein Buch herauszubringen, das erst in zehn Jahren Geld einspielt? Nichts könnte ihn weniger kümmern. Er will ein Buch, das jetzt Geld macht, so dass er seinen Bossen sagen kann: 'Ihr solltet mir einen Fünf-Jahres-Vertrag für das Doppelte meines Gehalts geben.' Das hat sich also verändert und ich glaube, dass es auf das Verlegen Einfluss hat, mehr als all die anderen Krisen, die kommen und gehen."In China erfreut sich seit einigen Jahren ein neues Genre in der Literatur großer Popularität, verkündet Stephen Morison Jr.: der Bürokratenroman. "Fans behaupten, dass diese Romane sehr unterhaltsam sind und gleichzeitig wertvolle Einblicke in das byzantinische System von Verhaltensweisen und Etikette liefern, das in China der Schlüssel zum Erfolg in Bürojobs ist. Aber der Trend könnte auch einen viel wichtigeren Wandel in der Kultur signalisieren - einen, der über literarische Geschmacksfragen hinausgeht. Wang Yuewen wird weithin das Verdienst zugeschrieben, 1998 mit 'Painting' den ersten erfolgreichen Bürokratenroman geschrieben zu haben. 'Ich habe mit der Zeit gelernt, dass es sehr schwer ist, wegen seines Talents oder harter Arbeit gefördert zu werden', sagte der frühere Bürokrat in einem Interview mit der China Daily. Also wandte er sich der Literatur zu und schrieb Romane, die von seiner persönlichen Erfahrung im Umgang mit der komplizierten Maschinerie der kommunistischen Regierung und der staatskontrollierten Fimen profitieren. Seit dem blüht das Genre."
Außerdem: Alex Dimitrov stellt das Blog "The Invisible Library" vor. Es ist Büchern gewidmet, die in Romanen erwähnt werden, die es aber gar nicht gibt. Zum Beispiel "Die endlose Rose" von Hans Reiter in Bolanos "2666" oder "When the Train Passes" von Elisabeth Ducharme in Vladimir Nabokovs "Bend Sinister". Gerade gab es in London eine Ausstellung zu diesen unsichtbaren Büchern.
Kommentieren












