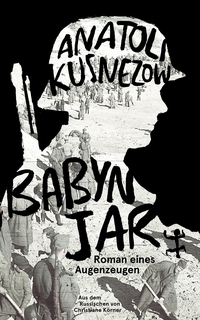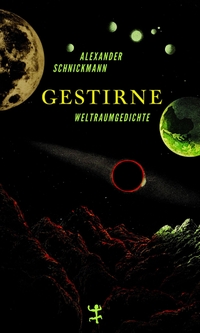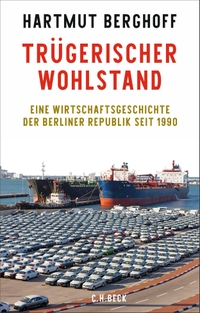Magazinrundschau
Die Magazinrundschau
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
14.11.2006. The Nation will die Meinungsseiten abschaffen. In Outlook India kritisiert der Historiker Irfan Habib die Kolonialisten. Der Guardian kritisiert nur die schlechten Kolonialisten. In Nepszabadsag sieht György Konrad immer noch das Gespenst der Fehde durch Südosteuropa ziehen. Elet es Irodalom singt ein Loblied auf die Sulzbergers. Folio geht shoppen. Foreign Policy auch: Schnittblumen und Kanonen bei Viktor Bout. Der Spectator sah die Zukunft des amerikanischen Konservatismus. Die New York Times kapituliert vor Londoner Taxifahrern.
The Nation (USA), 27.11.2006
 Kein Mensch braucht Meinungsseiten und Leitartikel, findet Eric Alterman. "Würden viele Zeitungen nicht sofort viel besser werden, wenn sie ihren Kommentarteil rausschmeißen und die politische Bandbreite und das Fachwissen ihrer Kolumnisten erweitern würden? Ich würde sogar noch weiter gehen: Warum nicht dem Beispiel des allgemein bewunderten britischen (liberalen) Guardian und des (konservativen) Economist folgen und die ohnehin meist künstliche Trennung von 'Tatsachen' und 'Meinung' aufheben? Warum lassen wir Journalisten nicht einfach erzählen, was sie für wahr halten und inwiefern und warum sie das tun? Diese Lösung würde den spannendsten Teil der Blogosphäre übernehmen, ohne die entscheidende Funktion von Zeitungen in einer demokratischen Gesellschaft aufzuheben."
Kein Mensch braucht Meinungsseiten und Leitartikel, findet Eric Alterman. "Würden viele Zeitungen nicht sofort viel besser werden, wenn sie ihren Kommentarteil rausschmeißen und die politische Bandbreite und das Fachwissen ihrer Kolumnisten erweitern würden? Ich würde sogar noch weiter gehen: Warum nicht dem Beispiel des allgemein bewunderten britischen (liberalen) Guardian und des (konservativen) Economist folgen und die ohnehin meist künstliche Trennung von 'Tatsachen' und 'Meinung' aufheben? Warum lassen wir Journalisten nicht einfach erzählen, was sie für wahr halten und inwiefern und warum sie das tun? Diese Lösung würde den spannendsten Teil der Blogosphäre übernehmen, ohne die entscheidende Funktion von Zeitungen in einer demokratischen Gesellschaft aufzuheben."Outlook India (Indien), 20.11.2006
 Von wegen faul! Der indische Historiker Irfan Habib antwortet auf die vor einigen Wochen in Outlook erhobenen Vorwürfe des in Delhi lebenden britischen Historikers William Dalrymple ("The Last Mughal"), indische Historiker begegneten der indischen Vergangenheit mit Indifferenz, ja Faulheit. Kritik übt Habib aber vor allem an Dalrymples Sicht der islamischen Beteiligten am Sepoy-Aufstand von 1857 als Vorläufer der Terrororganisation Al-Qaida: "Dass Religion damals das adäquate Medium war, in dem sich der Groll über die zahlreichen Ungerechtigkeiten der britischen Herrschaft kundtat, bleibt so unberücksichtigt... Die Sepoys der bengalischen Armee bewahrten durchweg eine erstaunliche Einheit ihrer Gemeinschaft, eine Tatsache, die Syed Ahmed Khan in seinem Buch 'Asbab Baghawat-i Hind' beschrieben hat. Er gab zu, dass die hinduistischen und muslimischen Sepoys, die solange gemeinsam ihr Blut für die britischen Herren vergossen hatten, so eng in einer gemeinsamen Bruderschaft verbunden waren, dass sie gar nicht anders konnten, als bis zum Ende des Aufstandes zu kämpfen. Dieser antikoloniale Geist beschwört Analogien herauf zu Vietnam, Irak oder Palästina. Es wäre zu engstirnig, ihn nur innerhalb eines Jehad-Konstrukts eigener Machart zu betrachten."
Von wegen faul! Der indische Historiker Irfan Habib antwortet auf die vor einigen Wochen in Outlook erhobenen Vorwürfe des in Delhi lebenden britischen Historikers William Dalrymple ("The Last Mughal"), indische Historiker begegneten der indischen Vergangenheit mit Indifferenz, ja Faulheit. Kritik übt Habib aber vor allem an Dalrymples Sicht der islamischen Beteiligten am Sepoy-Aufstand von 1857 als Vorläufer der Terrororganisation Al-Qaida: "Dass Religion damals das adäquate Medium war, in dem sich der Groll über die zahlreichen Ungerechtigkeiten der britischen Herrschaft kundtat, bleibt so unberücksichtigt... Die Sepoys der bengalischen Armee bewahrten durchweg eine erstaunliche Einheit ihrer Gemeinschaft, eine Tatsache, die Syed Ahmed Khan in seinem Buch 'Asbab Baghawat-i Hind' beschrieben hat. Er gab zu, dass die hinduistischen und muslimischen Sepoys, die solange gemeinsam ihr Blut für die britischen Herren vergossen hatten, so eng in einer gemeinsamen Bruderschaft verbunden waren, dass sie gar nicht anders konnten, als bis zum Ende des Aufstandes zu kämpfen. Dieser antikoloniale Geist beschwört Analogien herauf zu Vietnam, Irak oder Palästina. Es wäre zu engstirnig, ihn nur innerhalb eines Jehad-Konstrukts eigener Machart zu betrachten."Guardian (UK), 13.11.2006
 Geoffrey Moorhouse findet dagegen William Dalrymples Biografie des letzten Moguls von Indien einfach "glänzend". Im Grunde, schließt er aus dem Buch, waren die Briten Schuld an dem Aufstand, denn sie hatten die Kipling-Sorte von Kolonialherren abserviert. "Britanniens Indienpolitik in den 1850er Jahren wurde nicht länger von der Männern wie Warren Hastings oder William Jones bestimmt, die indische Werte und Traditionen verstanden und respektierten. Direkt verantwortlich für den Aufstand war statt dessen die "ständig wachsende Dickfelligkeit" von Leuten wie Rev. Midgeley John Jennings und ihrer Vorgesetzten: der Patzer (und es war nicht mehr als das) mit der mit Fett beschmierten Munition war einfach der letzte Tropfen, der das Fass für die bereits aufgebrachten Sepoys zum Überlaufen brachte. Wenn die Armee ihre Instruktionen befolgt hätte - dass Ziegen- oder Schaffett die religiösen Empfindlichkeiten weder von Hindus noch von Moslems verletzt, aber auf keinen Fall Rinder- oder Schweinefett benutzt werden darf - hätte es kein Problem gegeben."
Geoffrey Moorhouse findet dagegen William Dalrymples Biografie des letzten Moguls von Indien einfach "glänzend". Im Grunde, schließt er aus dem Buch, waren die Briten Schuld an dem Aufstand, denn sie hatten die Kipling-Sorte von Kolonialherren abserviert. "Britanniens Indienpolitik in den 1850er Jahren wurde nicht länger von der Männern wie Warren Hastings oder William Jones bestimmt, die indische Werte und Traditionen verstanden und respektierten. Direkt verantwortlich für den Aufstand war statt dessen die "ständig wachsende Dickfelligkeit" von Leuten wie Rev. Midgeley John Jennings und ihrer Vorgesetzten: der Patzer (und es war nicht mehr als das) mit der mit Fett beschmierten Munition war einfach der letzte Tropfen, der das Fass für die bereits aufgebrachten Sepoys zum Überlaufen brachte. Wenn die Armee ihre Instruktionen befolgt hätte - dass Ziegen- oder Schaffett die religiösen Empfindlichkeiten weder von Hindus noch von Moslems verletzt, aber auf keinen Fall Rinder- oder Schweinefett benutzt werden darf - hätte es kein Problem gegeben."Der Guardian druckt einen Auszug aus Patrick Süskinds demnächst erscheinendem Essayband "Über Liebe und Tod". Sind Eros und Thanatos wirklich Gegenspieler? "Wir können uns in Menschen hineinversetzen, die sich aus Liebe töten oder für die Liebe sterben. Wenn es nicht so wäre, wie könnten wir 'Die Leiden des jungen Werther', 'Anna Karenina', 'Madame Bovary' oder 'Effie Briest' ohne Bewegung lesen? Doch der Punkt, an dem die Empathie endet und das Interesse schwindet, sich regelrechter Widerwille regt, ist erreicht, wenn Eros sich stürmisch in die Arme von Thanatos stürzt, als wollte er sich mit ihm vereinen, wenn Liebe ihre höchste und reinste Form, ihre Erfüllung, im Tod zu finden sucht."
Weiteres: A.L. Kennedy liest betrübt "The Unpublished Spike Milligan", einen neuen Band mit Briefen, Tagebucheintragungen und Notizen von Spike Milligan, dem wohl depressivsten Komiker aller Zeiten. Geweint und frohlockt hat Simon Callow über Robert Aldrichs Weltgeschichte der Homosexualität "Gay Life and Culture".
DU (Schweiz), 01.11.2006
 Diese Ausgabe widmet sich dem sizilianischen Schriftsteller Andrea Camilleri. Dietmar Polaczek stellt fest, dass Camilleri "Ernsteres zu sagen" hat, als nur über Leben und Abenteuer des von ihm erfundenen Kommissars Salvo Montalbano zu berichten. Nach dem Tod des Philosophen Norberto Bobbio habe Camilleri dessen Nachfolge als politisches Gewissen Italiens angetreten. "Als politischer Kommentator ist Camilleri - wie Umberto Eco oder Luigi Malerba - Nutznießer seiner literarischen Berühmtheit. Eine Art Umwegrentabilität."
Diese Ausgabe widmet sich dem sizilianischen Schriftsteller Andrea Camilleri. Dietmar Polaczek stellt fest, dass Camilleri "Ernsteres zu sagen" hat, als nur über Leben und Abenteuer des von ihm erfundenen Kommissars Salvo Montalbano zu berichten. Nach dem Tod des Philosophen Norberto Bobbio habe Camilleri dessen Nachfolge als politisches Gewissen Italiens angetreten. "Als politischer Kommentator ist Camilleri - wie Umberto Eco oder Luigi Malerba - Nutznießer seiner literarischen Berühmtheit. Eine Art Umwegrentabilität." Saverio Lodato, der mit Camilleri zusammen das Buch "La linea della palma" ("Mein Leben") verfasst hat, in dem der Autor über die Lage Italiens unter Berlusconi kein Blatt vor den Mund nimmt, erzählt, wie es zur Zusammenarbeit kam: "Ich wollte ihn anspitzen. Ich wusste, dass er als junger Mann Kommunist gewesen war, aber nicht, ob er es immer noch war. Doch ich vermutete, dass ihm dieses hässliche, elende Italien missfiel. Natürlich hatte ich nicht die leiseste Ahnung, wie er reagieren würde. Es wäre völlig legitim gewesen, nicht auf meinen Vorschlag einzugehen. Schließlich war er nicht verpflichtet, sich mit mächtigen Institutionen anzulegen, die ihn hofierten und hätschelten und alles taten, um ihn für sich zu gewinnen. Doch zu meinem großen Glück schien Camilleri nur auf die passende Gelegenheit gewartet zu haben. Als ich ihm meine Idee darlegte, ähnelte er einem Kater, der sich angesichts einer üppigen Portion gebratener Fischchen die Schnurrhaare leckt. Er schloss die Augen halb und grinste."
Nepszabadsag (Ungarn), 11.11.2006
 Noch vor wenigen Jahren war Südosteuropa Schauplatz von Kriegen und ethnischen oder religiösen Konflikten. Vor dem EU-Beitritt Bulgariens und Rumäniens denkt der Schriftsteller György Konrad darüber nach, wie die transnationale Zusammenarbeit in der Region gefördert werden kann: "Das Gespenst der Fehde und des Verrats geht im Südosten und im Osten Europas herum, obwohl es manchmal scheint, als ob die Region die Verherrlichung der rohen, männlichen Gewalt, des blutigen Ausgangs von Konflikten überwunden hätte. Es ist nicht einfach, mit dieser Tradition zu brechen, Hilfe von außen ist nötig, um den Wandel zu vollziehen... Viele Politiker unserer Region haben immer noch nicht verstanden, dass nicht sie im Mittelpunkt der Geschichte stehen, dass sie keine Hauptfiguren unserer Zeit mehr sind, dass sie dem Volk dienen, nicht über das Volk herrschen sollen, und dass die Bürger keine Anführer mehr brauchen."
Noch vor wenigen Jahren war Südosteuropa Schauplatz von Kriegen und ethnischen oder religiösen Konflikten. Vor dem EU-Beitritt Bulgariens und Rumäniens denkt der Schriftsteller György Konrad darüber nach, wie die transnationale Zusammenarbeit in der Region gefördert werden kann: "Das Gespenst der Fehde und des Verrats geht im Südosten und im Osten Europas herum, obwohl es manchmal scheint, als ob die Region die Verherrlichung der rohen, männlichen Gewalt, des blutigen Ausgangs von Konflikten überwunden hätte. Es ist nicht einfach, mit dieser Tradition zu brechen, Hilfe von außen ist nötig, um den Wandel zu vollziehen... Viele Politiker unserer Region haben immer noch nicht verstanden, dass nicht sie im Mittelpunkt der Geschichte stehen, dass sie keine Hauptfiguren unserer Zeit mehr sind, dass sie dem Volk dienen, nicht über das Volk herrschen sollen, und dass die Bürger keine Anführer mehr brauchen." Elet es Irodalom (Ungarn), 10.11.2006
 Miklos Radvanyi, Vizepräsident des amerikanischen Frontiers of Freedom Institute, diagnostiziert eine grundlegende Krise der Demokratien in Mittel- und Osteuropa: "Das 'Neue Europa' stellte sich als Wunschtraum einiger wohlmeinender Politiker heraus. Die Unruhen in der Budapester Innenstadt demonstrierten, wie gefährlich unstabil die ungarische Demokratie ist. Die schwere politische Krise in Polen, die Gelähmtheit der tschechischen, der extreme Nationalismus der slowakischen Regierung, die beinahe lächerlichen Zustände in Bulgarien und Rumänien, das Scheitern der Orangen Revolutionen in Kiew und Tblissi zeigen, dass die institutionellen und wirtschaftlichen Grundlagen der Demokratie angelsächsischen Typs in diesen Ländern fehlen."
Miklos Radvanyi, Vizepräsident des amerikanischen Frontiers of Freedom Institute, diagnostiziert eine grundlegende Krise der Demokratien in Mittel- und Osteuropa: "Das 'Neue Europa' stellte sich als Wunschtraum einiger wohlmeinender Politiker heraus. Die Unruhen in der Budapester Innenstadt demonstrierten, wie gefährlich unstabil die ungarische Demokratie ist. Die schwere politische Krise in Polen, die Gelähmtheit der tschechischen, der extreme Nationalismus der slowakischen Regierung, die beinahe lächerlichen Zustände in Bulgarien und Rumänien, das Scheitern der Orangen Revolutionen in Kiew und Tblissi zeigen, dass die institutionellen und wirtschaftlichen Grundlagen der Demokratie angelsächsischen Typs in diesen Ländern fehlen."ES-Chefredakteur Zoltan Kovacs kritisiert den Unternehmer Gabor Szeles, Mehrheitseigentümer von Magyar Hirlap, einer der wichtigsten Tageszeitungen Ungarns, weil er Chefredakteuren und führenden Publizisten gekündigt hat, um die politische Linie der Zeitung seinem Geschmack anzupassen. "Die New York Times ist eine der Zeitungen mit dem größten Ansehen weltweit, aber das ist auch das Verdienst der Eigentümer. Für sie ist die Presse mehr als nur ein Geschäftsunternehmen, mehr als nur ein Instrument politischer Einflussnahme... Macht ist für sie nicht das Ziel, sondern ein Mittel, um dem Gemeinwohl zu dienen. Die New York Times fördert Aufdeckung statt Verschweigen, Solidarität statt Komplizenschaft. Die Interessen der Familie Sulzberger und der Gesellschaft widersprechen sich nicht - auch wenn in Streitfällen Arthur Sulzberger immer das letzte Wort hat."
Weiteres: Der Verfassungsjurist Istvan Lövetei plädiert im Interview dafür, das Versammlungsrecht in der ungarischen Verfassung zu reformieren und bezahlte Demonstrationen zu verbieten. Andras B. Vagvölgyi findet es richtig, dass die Aufsichtsbehörde ORTT den privaten Fernsehsender Hir TV zu einer Geldstrafe verurteilt hat, weil er die Unruhen in Budapest mehrmals als "Revolution" bezeichnete. Der Novellenband "Transit" der jungen Autorin Noemi Kiss wird als Revolution des weiblichen Schreibens gepriesen (hier ein Text von Kiss über eine Reise in die Bukowina) und "Endlich eine gute Ehe", der 1929 entstandene Roman des völlig vergessenen Schriftstellers Akos Molnar, als Wiederentdeckung der Saison gefeiert.
Times Literary Supplement (UK), 10.11.2006
 Die Musik des amerikanischen Komponisten Aaron Copland (die "Fanfare for the Common Man" als mp3) erinnert Allen Shawn an die Gemälde Edward Hoppers und die Lyrik Robert Lee Frosts. Einen neuen Band mit Briefen des Pioniers amerikanischer E-Musik empfiehlt er wärmstens - vor allem dem Künstlernachwuchs. "Die Briefe zeigen sehr eindrücklich, dass man etwas mit Hingabe tun kann, ohne seine Großmut und seine Zugehörigkeit zur Welt aufzugeben, dass man als Künstler nicht extra neurotisch werden muss, dass starke Überzeugungen diplomatisches Geschick nicht ausschließen, dass es möglich ist, wichtige Werke zu schaffen und dabei bescheiden zu bleiben. In Bezug auf letzteres rät Copland dem jungen Henry Brant: 'Ein freundlicher Rat: Legen Sie sich eine andere Verbeugung zu, Ihre jetzige ist nicht einfach genug.'"
Die Musik des amerikanischen Komponisten Aaron Copland (die "Fanfare for the Common Man" als mp3) erinnert Allen Shawn an die Gemälde Edward Hoppers und die Lyrik Robert Lee Frosts. Einen neuen Band mit Briefen des Pioniers amerikanischer E-Musik empfiehlt er wärmstens - vor allem dem Künstlernachwuchs. "Die Briefe zeigen sehr eindrücklich, dass man etwas mit Hingabe tun kann, ohne seine Großmut und seine Zugehörigkeit zur Welt aufzugeben, dass man als Künstler nicht extra neurotisch werden muss, dass starke Überzeugungen diplomatisches Geschick nicht ausschließen, dass es möglich ist, wichtige Werke zu schaffen und dabei bescheiden zu bleiben. In Bezug auf letzteres rät Copland dem jungen Henry Brant: 'Ein freundlicher Rat: Legen Sie sich eine andere Verbeugung zu, Ihre jetzige ist nicht einfach genug.'" al-Sharq al-Awsat (Saudi Arabien / Vereinigtes Königreich), 08.11.2006
"Zeitbomben" bedrohen die ägyptische Filmindustrie, berichtet Ayhab al-Hadri. Gemeint sind die Erben von Berühmtheiten. So scheiterten jüngst zwei Filmprojekte über den Musiker Muhammad Abdul Wahab und den Sänger Farid al-Atrash an den Protesten von Angehörigen, die ein weitgehendes Mitspracherecht bei der Produktion der Filme einforderten. "Dieses Problem wird sich erst mit einem Wandel des arabischen Denkens lösen", so Hadri, "wenn sich nämlich die Erkenntnis durchsetzt, dass Stars keine Engel sind - und dass man sie nicht wie Esel behandeln sollte, die Goldtaler zum Wohle ihrer Erben und anderer Profiteure auswerfen. Erst dann wird es für diese Art von Filmdramen auch ein interessiertes Publikum geben, welches dem kreativen Schaffen neue Horizonte eröffnet, statt der Zensur eine weitere Tür aufzustoßen."
Hani Nasira stellt das Buch "Die Moderne - Zwischen Pascha und General" des ägyptischen Professors für Philosophie Ali Mabrouk vor, der die Geschichte der Modernisierung der arabischen Gesellschaften seit der französischen Besetzung Ägyptens 1798 nachzeichnet. Der Druck zur Modernisierung ging laut Mabrouk lange Zeit entweder von der staatlichen Gewalt, dem Pascha, oder von äußeren Mächten, den Generälen, aus: "Deshalb wurde Modernisierung in der Gesellschaft als etwas Aufgezwungenes wahrgenommen, als ein Element der Repressionen des Staates. So wurde die Frage der Modernisierung zu einem Teil der politischen Kämpfe, beschäftigte aber die Bereiche der Kultur und des Wissens nur insoweit, wie es die Politik erforderlich machte. Dies war auch der Grund, weshalb die Moderne nicht zu einer bestimmenden Größe in den Kämpfen um die gesellschaftlichen Verhältnisse werden konnte."
Hani Nasira stellt das Buch "Die Moderne - Zwischen Pascha und General" des ägyptischen Professors für Philosophie Ali Mabrouk vor, der die Geschichte der Modernisierung der arabischen Gesellschaften seit der französischen Besetzung Ägyptens 1798 nachzeichnet. Der Druck zur Modernisierung ging laut Mabrouk lange Zeit entweder von der staatlichen Gewalt, dem Pascha, oder von äußeren Mächten, den Generälen, aus: "Deshalb wurde Modernisierung in der Gesellschaft als etwas Aufgezwungenes wahrgenommen, als ein Element der Repressionen des Staates. So wurde die Frage der Modernisierung zu einem Teil der politischen Kämpfe, beschäftigte aber die Bereiche der Kultur und des Wissens nur insoweit, wie es die Politik erforderlich machte. Dies war auch der Grund, weshalb die Moderne nicht zu einer bestimmenden Größe in den Kämpfen um die gesellschaftlichen Verhältnisse werden konnte."
Gazeta Wyborcza (Polen), 11.11.2006
 Nachdem die Abrechnung mit der Vergangenheit zu einem zentralen Motiv der politischen Debatte geworden ist, zieht die Kunst nach - schreibt Roman Pawlowski. "Noch nie wurden in Polen so viele historische Filme gedreht, wie 2006: Von Andrzej Wajdas Film "Post mortem. Die Geschichte von Katyn" (mehr hier und hier), über eine Popieluszko-Biografie und verschiedene Geschichten über polnische und sowjetische Geheimdienste bis hin zu Schlöndorffs 'Solidarnosc'-Epos. Das alles haben wir nicht nur der politischen Konjunktur zu verdanken - seit die Mittel für den staatlichen Filmfonds erhöht wurden, können Geschichtsfilme, die von Natur aus teurer sind, vermehrt realisiert werden."
Nachdem die Abrechnung mit der Vergangenheit zu einem zentralen Motiv der politischen Debatte geworden ist, zieht die Kunst nach - schreibt Roman Pawlowski. "Noch nie wurden in Polen so viele historische Filme gedreht, wie 2006: Von Andrzej Wajdas Film "Post mortem. Die Geschichte von Katyn" (mehr hier und hier), über eine Popieluszko-Biografie und verschiedene Geschichten über polnische und sowjetische Geheimdienste bis hin zu Schlöndorffs 'Solidarnosc'-Epos. Das alles haben wir nicht nur der politischen Konjunktur zu verdanken - seit die Mittel für den staatlichen Filmfonds erhöht wurden, können Geschichtsfilme, die von Natur aus teurer sind, vermehrt realisiert werden."Im westukrainischen Drohobytsch beginnt das Internationale Bruno-Schulz-Festival, bei dem der polnisch-jüdische Schriftsteller geehrt wird. "Erst langsam entsteht in der Stadt ein Kreis von ukrainischen Schulz-Forschern. Die bisherige Vernachlässigung des Erbes führte unter anderem dazu, dass einzigartige Wandgemälde des Künstlers durch Mitarbeiter des Yad Vashem illegal entfernt wurden. Während des Festivals wird endlich eine Gedenktafel für Bruno Schulz enthüllt - an der Stelle, wo er vor 64 Jahren von einem Gestapo-Offizier erschossen wurde."
Folio (Schweiz), 06.11.2006
 "Shopping hat zu Unrecht den Ruf, eine anspruchslose Tätigkeit zu sein. In Wahrheit ist es wohl die am meisten unterschätze Kulturtechnik unserer Zeit", führt Reto U. Schneider in das Thema dieses Heft ein. Vom Kreuzzug gegen das Shopping berichtet Marc Pitzke. Der Performancekünstler Bill Talen predigt als Reverend Billy mit seiner 'Church of Stop Shopping' im Stil der Fernsehevangelisten - und findet immer mehr Zuhörer. "Seine Jünger sind sich einig: Der Teufel - 'die Bestie, das Böse!' ruft Reverend Billy - schwimmt im Fließband-Latte-macchiato von Starbucks, dessen Filialen 'unsere Nachbarschaft zerstören'. Er döst in den Endlosregalen von Wal-Mart, der weltgrößten Handelskette aus Arkansas, deren Umsatz höher ist als das Bruttosozialprodukt der Schweiz. Er lugt durch die BH-Auslagen von Victoria's Secret, der Reizwäschefabrik aus Ohio, die mit der Produktion von Millionen von Katalogen 'ganze Wälder in Postwurfsendungen verwandelt'."
"Shopping hat zu Unrecht den Ruf, eine anspruchslose Tätigkeit zu sein. In Wahrheit ist es wohl die am meisten unterschätze Kulturtechnik unserer Zeit", führt Reto U. Schneider in das Thema dieses Heft ein. Vom Kreuzzug gegen das Shopping berichtet Marc Pitzke. Der Performancekünstler Bill Talen predigt als Reverend Billy mit seiner 'Church of Stop Shopping' im Stil der Fernsehevangelisten - und findet immer mehr Zuhörer. "Seine Jünger sind sich einig: Der Teufel - 'die Bestie, das Böse!' ruft Reverend Billy - schwimmt im Fließband-Latte-macchiato von Starbucks, dessen Filialen 'unsere Nachbarschaft zerstören'. Er döst in den Endlosregalen von Wal-Mart, der weltgrößten Handelskette aus Arkansas, deren Umsatz höher ist als das Bruttosozialprodukt der Schweiz. Er lugt durch die BH-Auslagen von Victoria's Secret, der Reizwäschefabrik aus Ohio, die mit der Produktion von Millionen von Katalogen 'ganze Wälder in Postwurfsendungen verwandelt'." Außerdem besucht Burkhard Strassmann das offiziell chaotische Lager von Amazon in Bad Hersfeld, Sabine Kobes, Textchefin der Gala, berichtet über die Shoppinggewohnheiten von Promis und Hollywood-Diven, Anja Jardine über einen Besuch beim Maßschneider, Mikael Krogerus unterhält sich mit shoppenden Teenagern, und Herbert Cerutti bietet kleine Kulturgeschichten des Shopping-Mobiliars: der Plastiktüte, des Einkaufwagens, der Registrierkasse und der Rolltreppe.
Und in der Duftnote ruft der weltbeste Parfumkritiker Luca Turin in einem leidenschaftlichen offenen Brief den Vorsitzenden der Coty Inc. Dr. Harf auf, die Kreationen des legendären Parfumeurs Francois Coty wieder aufzulegen: "Wem etwas an Parfum liegt, kennt seine Meisterwerke: L'Origan, Ambra Antique, L'Aimant, Chypre, Emeraude. Leider sind alle außer Emeraude und L'Aimant verschwunden, und was erhalten blieb, hat mit den ursprünglichen Düften wenig gemein. ... Bringen Sie die Coty-Klassiker in ihrer ursprünglichen Formel neu heraus!" Vor Schreck ist den angesprochenen Herren die Biografie von der Website gerutscht. Das ist nicht nötig. Wir bestellen Chypre sofort!
Foreign Policy (USA), 01.11.2006
 Douglas Farah und Stephen Braun begeben sich auf die Spur des russischen Waffenhändlers Viktor Bout, von dem seine Freunde sagen, er sei freundlich, klug und wohltätig. "Frühere Kollegen beschreiben ihn als Zusteller, in der Lage, jedes Paket an jeden Ort dieser Welt zu liefern. Noch keine vierzig, ist der russische Staatsbürger auch der berüchtigste Waffenhändler der Welt. Mehr als jeder andere nutzt er die Anarchie der Globalisierung, um seine - meist verbotene - Ware auf den Markt zu bringen. Er ist ein gefragter Mann, erwünscht von denen, die sich ein militärisches Arsenal zulegen wollen, gesucht von Strafverfolgungsbehörden. Waffenhändler haben lange die Dritte Welt mit AK-47, Panzerabwehrraketen und Warenlagern voller Munition und Landminen beliefert. Doch anders als seine Rivalen, die eher kleinere Reviere abstecken, werfen Bouts Flugzeuge ihre vielsagende militärgrüne Fracht ebenso über den Dschungelpisten des Kongos ab wie über den Landebahnen in Afghanistan. Er hat ein weltweites logistisches Netzwerk aufgebaut, wobei er durch ein Labyrinth von Vermittlern, Transportfirmen, Finanziers und Waffenherstellern manövriert, um vier Kontinente mit allem zu beliefern, was gebraucht wird: Schnittblumen, gefrorenes Geflügel, UN-Peacekeeper, Sturmgewehre und Boden-Luft-Raketen."
Douglas Farah und Stephen Braun begeben sich auf die Spur des russischen Waffenhändlers Viktor Bout, von dem seine Freunde sagen, er sei freundlich, klug und wohltätig. "Frühere Kollegen beschreiben ihn als Zusteller, in der Lage, jedes Paket an jeden Ort dieser Welt zu liefern. Noch keine vierzig, ist der russische Staatsbürger auch der berüchtigste Waffenhändler der Welt. Mehr als jeder andere nutzt er die Anarchie der Globalisierung, um seine - meist verbotene - Ware auf den Markt zu bringen. Er ist ein gefragter Mann, erwünscht von denen, die sich ein militärisches Arsenal zulegen wollen, gesucht von Strafverfolgungsbehörden. Waffenhändler haben lange die Dritte Welt mit AK-47, Panzerabwehrraketen und Warenlagern voller Munition und Landminen beliefert. Doch anders als seine Rivalen, die eher kleinere Reviere abstecken, werfen Bouts Flugzeuge ihre vielsagende militärgrüne Fracht ebenso über den Dschungelpisten des Kongos ab wie über den Landebahnen in Afghanistan. Er hat ein weltweites logistisches Netzwerk aufgebaut, wobei er durch ein Labyrinth von Vermittlern, Transportfirmen, Finanziers und Waffenherstellern manövriert, um vier Kontinente mit allem zu beliefern, was gebraucht wird: Schnittblumen, gefrorenes Geflügel, UN-Peacekeeper, Sturmgewehre und Boden-Luft-Raketen." London Review of Books (UK), 16.11.2006
 Unter vier Darstellungen des Ungarn-Aufstands von 1956 hebt der Historiker Eric Hobsbawm, lange Jahre Mitglied der Kommunistischen Partei Englands, vor allem die von Charles Gati hervor ("Failed Illusions: Moscow, Washington, Budapest and the 1956 Hungarian Revolt"), in der der Autor nahelegt, dass Imre Nagy durchaus als verhängnisvolle Figur gesehen werden müsse, insbesondere, weil er die Attacke auf das Hauptquartier der Kommunistischen Partei am 30. Oktober nicht verhindern konnte. Moskau hätte bereits den Rückzug seiner Truppen angekündigt, als "das Gebäude erobert, der Budapester Parteichef - ein starker Befürworter von Reformen - getötet und 23 Geheimpolizisten vor den Kameralinsen der Weltpresse vom Mob gelyncht wurden. Es war diese Demonstration anarchistischer Wut, kombiniert mit Nagys steigenden Zugeständnissen an maximale Forderungen der Straße, die beide, Moskau und Peking, davon überzeugten, dass die Situation in Ungarn völlig außer Kontrolle war. 'Am Ende', schreibt Gati, 'wurde Nagy ein Revolutionär wider Willen, der den plötzlichen Ausbruch der Gewalt nicht kontrollieren konnte... und das war der Hauptgrund, warum er das Vertrauen Moskaus verlor.'"
Unter vier Darstellungen des Ungarn-Aufstands von 1956 hebt der Historiker Eric Hobsbawm, lange Jahre Mitglied der Kommunistischen Partei Englands, vor allem die von Charles Gati hervor ("Failed Illusions: Moscow, Washington, Budapest and the 1956 Hungarian Revolt"), in der der Autor nahelegt, dass Imre Nagy durchaus als verhängnisvolle Figur gesehen werden müsse, insbesondere, weil er die Attacke auf das Hauptquartier der Kommunistischen Partei am 30. Oktober nicht verhindern konnte. Moskau hätte bereits den Rückzug seiner Truppen angekündigt, als "das Gebäude erobert, der Budapester Parteichef - ein starker Befürworter von Reformen - getötet und 23 Geheimpolizisten vor den Kameralinsen der Weltpresse vom Mob gelyncht wurden. Es war diese Demonstration anarchistischer Wut, kombiniert mit Nagys steigenden Zugeständnissen an maximale Forderungen der Straße, die beide, Moskau und Peking, davon überzeugten, dass die Situation in Ungarn völlig außer Kontrolle war. 'Am Ende', schreibt Gati, 'wurde Nagy ein Revolutionär wider Willen, der den plötzlichen Ausbruch der Gewalt nicht kontrollieren konnte... und das war der Hauptgrund, warum er das Vertrauen Moskaus verlor.'"Weitere Artikel: Michael Wood ist verblüfft von Jack Nicholsons kranker schauspielerischer Leistung im neuen Scorsese-Film "The Departed": Nicholson spiele seine Gangster-Figur als "Psychopathen, der vorgibt, ein Witzbold zu sein", oder mehr noch, als einen, "der so tut, als würde er nur so tun". Und Andrew O'Hagan amüsiert sich blendend bei der Lektüre des vom britischen Innenministerium herausgegebenen Informationshandbuchs für Anwärter auf die britische Staatsangehörigkeit, "Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship".
Economist (UK), 10.11.2006
 Der Economist kommentiert den Prozess gegen Saddam Hussein, der letzte Woche zum Tod durch den Strang verurteilt wurde. "Viele westliche Menschenrechtslobbyisten halten die Fehler im Dudschail-Prozess für so schwerwiegend, dass ihrer Meinung nach das Urteil verworfen und Saddam Hussein erneut vor ein unabhängiges internationales Gericht gestellt werden müsste. Diese Zeitschrift glaubt, dass das Urteil Bestand haben sollte, nicht jedoch die Strafe. Vor allem, weil die Todesstrafe an sich falsch ist, sogar für Ungeheuer wie Saddam Hussein. Dem Menschenleben größeren Respekt zu zollen, als er es jemals getan hat, hätte einen seltenen moralischen Sieg für die Besatzer des Iraks bedeutet."
Der Economist kommentiert den Prozess gegen Saddam Hussein, der letzte Woche zum Tod durch den Strang verurteilt wurde. "Viele westliche Menschenrechtslobbyisten halten die Fehler im Dudschail-Prozess für so schwerwiegend, dass ihrer Meinung nach das Urteil verworfen und Saddam Hussein erneut vor ein unabhängiges internationales Gericht gestellt werden müsste. Diese Zeitschrift glaubt, dass das Urteil Bestand haben sollte, nicht jedoch die Strafe. Vor allem, weil die Todesstrafe an sich falsch ist, sogar für Ungeheuer wie Saddam Hussein. Dem Menschenleben größeren Respekt zu zollen, als er es jemals getan hat, hätte einen seltenen moralischen Sieg für die Besatzer des Iraks bedeutet."Und der Economist empfiehlt den Besuch der außergewöhnlichen Ikonen-Ausstellung "Holy Image, Hallowed Ground: Icons from Sinai" (im Getty Museum in Los Angeles), die den umstrittenen Versuch unternimmt, die Besucher in eine Atmosphäre klösterlicher Andacht eintauchen zu lassen.
Point (Frankreich), 09.11.2006
 In seinen Bloc-notes verwehrt sich Bernard-Henri Levy gegen die verbreitete Ansicht, der Prozess gegen Saddam Hussein sei "stümperhaft" geführt worden. "Hitler hat sich umgebracht, Stalin und Mao sind in ihren Betten gestorben, Mengistu verlebt in Zimbabwe ruhige Tage. Die Opfer von Pinochet oder Pol Pot haben Jahrzehnte - ein Leben lang - warten müssen, bis man daran dachte, ihre Peiniger zur Rechenschaft zu ziehen. Saddams Opfer hatten seit seinem Sturz den bescheidenen Trost eines Ansatzes von Gerechtigkeit. Und Saddam Hussein selbst wurde jenes Recht zuteil, das er den unzähligen Männern und Frauen, die er ermordet hat, 24 Jahre lang verweigerte: Anwälte, Be- und Entlastungszeugen, Diskussionen - kurz: ein Anhörungsprozess, der quasi live im gesamten Irak gesendet wurde und der, ob man nun will oder nicht, formalen Regeln und Verfahrensweisen unterlag. Er war der erste seiner Art in der arabischen Welt und in gewisser Hinsicht in der Geschichte gefallener Diktaturen überhaupt."
In seinen Bloc-notes verwehrt sich Bernard-Henri Levy gegen die verbreitete Ansicht, der Prozess gegen Saddam Hussein sei "stümperhaft" geführt worden. "Hitler hat sich umgebracht, Stalin und Mao sind in ihren Betten gestorben, Mengistu verlebt in Zimbabwe ruhige Tage. Die Opfer von Pinochet oder Pol Pot haben Jahrzehnte - ein Leben lang - warten müssen, bis man daran dachte, ihre Peiniger zur Rechenschaft zu ziehen. Saddams Opfer hatten seit seinem Sturz den bescheidenen Trost eines Ansatzes von Gerechtigkeit. Und Saddam Hussein selbst wurde jenes Recht zuteil, das er den unzähligen Männern und Frauen, die er ermordet hat, 24 Jahre lang verweigerte: Anwälte, Be- und Entlastungszeugen, Diskussionen - kurz: ein Anhörungsprozess, der quasi live im gesamten Irak gesendet wurde und der, ob man nun will oder nicht, formalen Regeln und Verfahrensweisen unterlag. Er war der erste seiner Art in der arabischen Welt und in gewisser Hinsicht in der Geschichte gefallener Diktaturen überhaupt." Spectator (UK), 14.10.2006
 Allister Heath porträtiert den jungen Konservativen John Hulsman, der gerade zusammen mit dem "feurigen linken Pamphletisten" (NYT) Anatol Lieven ein Buch über Amerikas künftige Rolle in der Welt veröffentlicht hat: "Ethic Realism". Hulsman hat sich vom Befürworter in einen scharfen Gegner von Bushs Irakkrieg gewandelt. Was ihn für Heath interessant macht, "ist die Tatsache, dass er immer noch zutiefst von der Notwendigkeit überzeugt ist, Al Qaida zu bekämpfen - anders als die linken Kriegsgegner, die es meist vorziehen, den Umfang und das Ausmaß des Risikos zu leugnen, das von den Fanatikern ausgeht. 'Die Bedrohung durch islamische Terroristen muss sehr ernst genommen werden, ernster als andere Sicherheitsfragen', sagt Hulsman und er meint es auch so. 'Die Neocons haben sich geirrt, als sie uns Humanitarismus auf Steroiden anboten', sagte er mir. 'Es war ein falscher Realismus zu glauben, man könne Demokratie mit einer Kanone errichten und die Leute würden das mögen. Als ob eine Größe allen passen würde - Kultur und Geschichte spielen keine Rolle. Im Grunde sind die Neokonservativen immer noch jakobinische utopistische rousseauistische Trotzkisten, Verfechter der permanenten Revolution. Das ist ihr Ding.'"
Allister Heath porträtiert den jungen Konservativen John Hulsman, der gerade zusammen mit dem "feurigen linken Pamphletisten" (NYT) Anatol Lieven ein Buch über Amerikas künftige Rolle in der Welt veröffentlicht hat: "Ethic Realism". Hulsman hat sich vom Befürworter in einen scharfen Gegner von Bushs Irakkrieg gewandelt. Was ihn für Heath interessant macht, "ist die Tatsache, dass er immer noch zutiefst von der Notwendigkeit überzeugt ist, Al Qaida zu bekämpfen - anders als die linken Kriegsgegner, die es meist vorziehen, den Umfang und das Ausmaß des Risikos zu leugnen, das von den Fanatikern ausgeht. 'Die Bedrohung durch islamische Terroristen muss sehr ernst genommen werden, ernster als andere Sicherheitsfragen', sagt Hulsman und er meint es auch so. 'Die Neocons haben sich geirrt, als sie uns Humanitarismus auf Steroiden anboten', sagte er mir. 'Es war ein falscher Realismus zu glauben, man könne Demokratie mit einer Kanone errichten und die Leute würden das mögen. Als ob eine Größe allen passen würde - Kultur und Geschichte spielen keine Rolle. Im Grunde sind die Neokonservativen immer noch jakobinische utopistische rousseauistische Trotzkisten, Verfechter der permanenten Revolution. Das ist ihr Ding.'"War der Prozess gegen Saddam Hussein fair? Das kümmert Alasdair Palmer einen Dreck: "Ein Prozess ist besser als eine sofortige Hinrichtung. Und es gibt eine Sache, die noch schlimmer ist als die sofortige Hinrichtung eines früheren Staatsoberhauptes, das ein Massenmörder war: seine Freilassung. Das ist natürlich eine Option, die ein 'fairer Prozess' offen halten muss. Und es ist der Grund, warum Prozesse gegen Massenmörder niemals fair sein sollten."
New York Times (USA), 13.11.2006
Jim Windolf ist einfach hingerissen von Stephen Kings Gruselmärchen "Lisey's Story" (Auszug), eine "Ode an Schwesternschaft und Blut". Das überrascht den Leser, der zu Beginn der Rezension erfährt, dass die Hauptperson in dem Roman eigentlich Liseys Mann ist, der verstorbene Pulitzerpreisträger Scott Landon. "Stephen King hat über Zombies geschrieben, Vampire und das Ende der Welt. Er hat ein mörderisches Auto, einen mörderischen Hund, einen mörderischen Clown und ein mörderisches Handy erfunden. Aber wenn er Ihnen wirklich Angst einjagen will, holt er das fürchterlichste Monster von allen hervor, diese zitternde Masse aus Ego und Unsicherheit - den Schriftsteller."
Nathaniel Rich hat keinen Gefallen gefunden an Will Selfs neuem Roman "The Book of Dave" (Auszug). "Self überlegt, was wäre, wenn die englische Gesellschaft in 500 Jahren nicht von der jüdisch-christlichen Theologie, sondern von den unflätigen Schimpfreden eines hasserfüllten Londoner Taxifahrers aus dem 21. Jahrhundert geprägt wäre." Diese Vision missfällt Rich nicht nur, er versteht sie auch nicht, denn Selfs Held spricht einen Cockney-Dialekt, der einem Amerikaner den letzten Nerv raubt: "Mi awdas R onle 2 tayk U sarf 2 Wyc, ware U R 2 B landid. Eye no nuffing uv oo U R aw wot U av dun, mayt, so folla ve rools uv mi ferre an Eyel giv U no aggro." Hugh.
Weitere Besprechungen: James Traub nennt Anatol Lievens und John Hulsmans Bush-Kritik "Ethical Realism" eine "perverse Errungenschaft neokonservativer Theorie und Praxis". Elena Lappin stellt nach der Lektüre von Jeffrey Goldbergs Buch "A Muslim and a Jew Across the Middle East Divide" (Auszug) fest: "Der Nahe Osten wird ein großes Gefängnis bleiben, solange es keine Bücher über die Freundschaft zwischen Juden und Arabern gibt, die Araber geschrieben haben." Charles Taylor stellt Nick Rennisons (natürlich) unautorisierte Biografie über Sherlock Holmes vor.
Nathaniel Rich hat keinen Gefallen gefunden an Will Selfs neuem Roman "The Book of Dave" (Auszug). "Self überlegt, was wäre, wenn die englische Gesellschaft in 500 Jahren nicht von der jüdisch-christlichen Theologie, sondern von den unflätigen Schimpfreden eines hasserfüllten Londoner Taxifahrers aus dem 21. Jahrhundert geprägt wäre." Diese Vision missfällt Rich nicht nur, er versteht sie auch nicht, denn Selfs Held spricht einen Cockney-Dialekt, der einem Amerikaner den letzten Nerv raubt: "Mi awdas R onle 2 tayk U sarf 2 Wyc, ware U R 2 B landid. Eye no nuffing uv oo U R aw wot U av dun, mayt, so folla ve rools uv mi ferre an Eyel giv U no aggro." Hugh.
Weitere Besprechungen: James Traub nennt Anatol Lievens und John Hulsmans Bush-Kritik "Ethical Realism" eine "perverse Errungenschaft neokonservativer Theorie und Praxis". Elena Lappin stellt nach der Lektüre von Jeffrey Goldbergs Buch "A Muslim and a Jew Across the Middle East Divide" (Auszug) fest: "Der Nahe Osten wird ein großes Gefängnis bleiben, solange es keine Bücher über die Freundschaft zwischen Juden und Arabern gibt, die Araber geschrieben haben." Charles Taylor stellt Nick Rennisons (natürlich) unautorisierte Biografie über Sherlock Holmes vor.