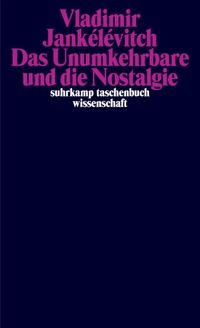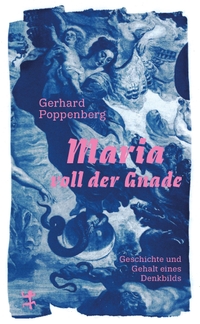Magazinrundschau
Die Regierung war tot
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
04.09.2018. Der New Yorker betrachtet mit Wolfgang Tillmans, was neu ist. Im Merkur diagnostiziert die Soziologin Cornelia Koppetsch eine Ära der gesellschaftlichen Schließung. Im Guardian erklärt Kwame Anthony Appiah das Problem mit der lupenreinen Identität am Beispiel seines Verhältnisses zu Taxifahrern. Das Smithsonian Magazine stellt Codeknackerinnen im Kalten Krieg vor. The Atlantic erzählt, wie russische Neonazis versuchten, Montenegro aufzumischen. Wired erzählt, wie russische Hacker die Ukraine lahm legten. Die New York Times feiert die Fluidität des Comme-des-Garcons-Mannes.
New Yorker (USA), 10.09.2018
 In der aktuellen Ausgabe des New Yorker widmet Emily Witt dem Fotografen Wolfgang Tillmans einen schönen Text. Tillmans Arbeit, findet Witt, ist auch Ausdruck erreichter Freiheit, also politisch: "1968 geboren, gehört Tillmans zur ersten Generation von Europäern, die nach dem Krieg reisen, verschiedene Nationalitäten annehmen und legal gleichgeschlechtliche Beziehungen haben konnten. 1997 wurde bei ihm HIV diagnostiziert, und er konnte eine antiretrovirale Therapie machen. Dem Optimismus seiner Zeit begegnete er mit Bildern, die laut Tillmans eine 'Wirklichkeit zeigten, in der Leute zusammen Ecstasy nehmen und Partys in Parks feiern und gleichzeitig ernsthafte Individuen sein oder nackt in Bäumen sitzen oder in einem dunklen Klo einen Schwanz lutschen konnten.' Außerhalb der Welt seiner Fotos, gibt er zu, existiert diese Freiheit nur in 'kleinen Bereichen'. Ein anderer Themenstrang seiner Arbeit erkundet die Fragilität des politischen Konsenses, von dem seine persönliche Utopie abhängt. Er hat Schwulen- und Lesbenparaden fotografiert, Antikriegsmärsche und Black Lives Matter-Zusammenkünfte. Mit seinen Fotos vom Nachthimmel, in denen Sterne und optische Verzerrungen der Technik ununterscheidbar sind, wollte er auf die Unzuverlässigkeit des Blicks hinweisen. In einem Bild von HIV-Medikamenten-Fläschchen aus dem Jahr 2014 würdigte er das Wunder der Chemie, das ihn am Leben hält. Häufig zeigt seine Kunst, was neu ist. Er hat kleinste Veränderungen im Design oder in Landschaften dokumentiert: den Wechsel von freundlich aussehenden PKW-Scheinwerfern zu aggressiven, Anti-Obdachlosen-Stacheln auf Gehwegen, ein Flughafen-Schild mit der Aufschrift 'Restwelt-Nationalitäten', nicht feuerfeste Fassaden im sozialen Wohnungsbau."
In der aktuellen Ausgabe des New Yorker widmet Emily Witt dem Fotografen Wolfgang Tillmans einen schönen Text. Tillmans Arbeit, findet Witt, ist auch Ausdruck erreichter Freiheit, also politisch: "1968 geboren, gehört Tillmans zur ersten Generation von Europäern, die nach dem Krieg reisen, verschiedene Nationalitäten annehmen und legal gleichgeschlechtliche Beziehungen haben konnten. 1997 wurde bei ihm HIV diagnostiziert, und er konnte eine antiretrovirale Therapie machen. Dem Optimismus seiner Zeit begegnete er mit Bildern, die laut Tillmans eine 'Wirklichkeit zeigten, in der Leute zusammen Ecstasy nehmen und Partys in Parks feiern und gleichzeitig ernsthafte Individuen sein oder nackt in Bäumen sitzen oder in einem dunklen Klo einen Schwanz lutschen konnten.' Außerhalb der Welt seiner Fotos, gibt er zu, existiert diese Freiheit nur in 'kleinen Bereichen'. Ein anderer Themenstrang seiner Arbeit erkundet die Fragilität des politischen Konsenses, von dem seine persönliche Utopie abhängt. Er hat Schwulen- und Lesbenparaden fotografiert, Antikriegsmärsche und Black Lives Matter-Zusammenkünfte. Mit seinen Fotos vom Nachthimmel, in denen Sterne und optische Verzerrungen der Technik ununterscheidbar sind, wollte er auf die Unzuverlässigkeit des Blicks hinweisen. In einem Bild von HIV-Medikamenten-Fläschchen aus dem Jahr 2014 würdigte er das Wunder der Chemie, das ihn am Leben hält. Häufig zeigt seine Kunst, was neu ist. Er hat kleinste Veränderungen im Design oder in Landschaften dokumentiert: den Wechsel von freundlich aussehenden PKW-Scheinwerfern zu aggressiven, Anti-Obdachlosen-Stacheln auf Gehwegen, ein Flughafen-Schild mit der Aufschrift 'Restwelt-Nationalitäten', nicht feuerfeste Fassaden im sozialen Wohnungsbau." Außerdem: Jill Lepore überlegt, ob Bildung ein Grundrecht für wirklich alle ist. Jeffrey Toobin vergleicht den poltischen (Un-)stil von Rudy Giuliani und Donald Trump. Anna Russell stellt die New Yorker Designerin Batsheva Hay, deren körperverhüllende Mode von religiösen Hardlinern wie Viktorianern, Hasiden und Amish inspiriert ist. Anthony Lane sah im Kino Ethan Hawkes "The Blaze", ein Film über den 1989 gestorbenen Countrysänger Blaze Foley.
Merkur (Deutschland), 03.09.2018
 Die Soziologin Cornelia Koppetsch glaubt nicht daran, dass sich der Aufstieg des Rechtspopulismus damit erklären lässt, dass die Linke die soziale Frage vernachlässigt habe. Sie sieht darin eher das Ergebnis einer gesellschaftlichen Schließung, mit dem CDU und AfD den von den 68ern eingeleiteten Öffnungsprozess beendet hätten: "Eliten und herrschende Gruppen schotten sich ab, und anstelle von Pluralisierungstendenzen finden sich verschärfte Anpassungs-, Vereinheitlichungs- und Konformitätszwänge. Auch das Politische befindet sich auf dem Rückzug. Die Idee der reflexiven Gestaltung des Sozialen, die durch die Jugendkultur der Alternativbewegungen in den 1980er Jahren in die Gesellschaft hineingetragen worden war, wurde zunächst aus dem Alltagsleben getilgt und schließlich auch durch die expertokratische Politik der Alternativlosigkeit und den Rückbau demokratischer Verfahren der Entscheidungsfindung aus den politischen Institutionen vertrieben. Die daraus entstandenen Mentalitäten sind zwar nicht explizit rechts, doch enthalten sie eine spezifische Grundbotschaft: Die Gesellschaftsordnung ist nicht verhandelbar und verlangt unbedingte Anpassung und Unterordnung."
Die Soziologin Cornelia Koppetsch glaubt nicht daran, dass sich der Aufstieg des Rechtspopulismus damit erklären lässt, dass die Linke die soziale Frage vernachlässigt habe. Sie sieht darin eher das Ergebnis einer gesellschaftlichen Schließung, mit dem CDU und AfD den von den 68ern eingeleiteten Öffnungsprozess beendet hätten: "Eliten und herrschende Gruppen schotten sich ab, und anstelle von Pluralisierungstendenzen finden sich verschärfte Anpassungs-, Vereinheitlichungs- und Konformitätszwänge. Auch das Politische befindet sich auf dem Rückzug. Die Idee der reflexiven Gestaltung des Sozialen, die durch die Jugendkultur der Alternativbewegungen in den 1980er Jahren in die Gesellschaft hineingetragen worden war, wurde zunächst aus dem Alltagsleben getilgt und schließlich auch durch die expertokratische Politik der Alternativlosigkeit und den Rückbau demokratischer Verfahren der Entscheidungsfindung aus den politischen Institutionen vertrieben. Die daraus entstandenen Mentalitäten sind zwar nicht explizit rechts, doch enthalten sie eine spezifische Grundbotschaft: Die Gesellschaftsordnung ist nicht verhandelbar und verlangt unbedingte Anpassung und Unterordnung."Weiteres: In seiner Architekturkolumne geißelt der Architekt Philipp Oswalt die baupolitische Schizophrenie Baupolitiker in der Frankfurter Altstadt: "Es ist eine Medienarchitektur, die aus technischen Bildern generiert nun vor allem der Erzeugung neuer medialer Bilder dient."
Guardian (UK), 03.09.2018
"Im Handumdrehen haben die Internet-Konzernen weltweites Informationschaos entfesselt und sich zu den mächtigsten Organisationen entwickelt, die die Welt je gesehen hat", schreibt der frühere Guardian-Chefredakteur Alan Rusbridger in einem Auszug aus seinem Buch mit dem genialen "Breaking News". Darin gibt er dem Journalismus selbst auch eine Mitschuld an seinem Niedergang und erinnert etwa an die großen Abhörskandale der Murdoch-Blätter, mit denen der Boulevard bewies, dass auch er aus Überwachung Profit schlagen konnte.
Smithsonian Magazine (USA), 01.09.2018
 In der neuen Ausgabe des Magazins berichtet Liza Mundy über die Frauen, die von den USA als Abwehrspezialistinnen im Kampf gegen die kryptografischen Künste der Sowjets eingesetzt wurden: "Ihre Ausdauer und ihr Talent sorgten für einen der größten Triumphe der Spionageabwehr im Kalten Krieg: Venona, das strenggeheime US-Projekt zur Entzifferung sowjetischer Geheimdienstkommunikation. 40 Jahre lang halfen diese Frauen, diejenigen zu identifizieren, die während des Zweiten Weltkriegs US-Geheimnisse an die Sowjets verrieten. Sie halfen den britischen Geheimdienstmitarbeiter Kim Philby, den britischen Diplomaten Donald Maclean, den deutschstämmigen Wissenschaftler Klaus Fuchs und viele andere zu enttarnen. Sie legten sowjetische Spionagepraxis offen. Ihre Arbeit war derart geheim, dass Präsident Truman davon nichts wusste … Die Venona Nachrichten waren so komplex kodiert, so schwierig nachzuverfolgen, dass die Frauen sie manchmal jahrzehntelang bearbeiteten, in endlosen Arbeitsgängen Code-Gruppen entschlüsselten und Namen eruierten, immer wieder von vorn beginnend, sobald neue Informationen auftauchten. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, zugleich der Höhepunkt der Babyboomer-Ära, als die amerikanische Frau vor allem den Haushalt führte, waren es Frauen, die dieses Arbeit machten."
In der neuen Ausgabe des Magazins berichtet Liza Mundy über die Frauen, die von den USA als Abwehrspezialistinnen im Kampf gegen die kryptografischen Künste der Sowjets eingesetzt wurden: "Ihre Ausdauer und ihr Talent sorgten für einen der größten Triumphe der Spionageabwehr im Kalten Krieg: Venona, das strenggeheime US-Projekt zur Entzifferung sowjetischer Geheimdienstkommunikation. 40 Jahre lang halfen diese Frauen, diejenigen zu identifizieren, die während des Zweiten Weltkriegs US-Geheimnisse an die Sowjets verrieten. Sie halfen den britischen Geheimdienstmitarbeiter Kim Philby, den britischen Diplomaten Donald Maclean, den deutschstämmigen Wissenschaftler Klaus Fuchs und viele andere zu enttarnen. Sie legten sowjetische Spionagepraxis offen. Ihre Arbeit war derart geheim, dass Präsident Truman davon nichts wusste … Die Venona Nachrichten waren so komplex kodiert, so schwierig nachzuverfolgen, dass die Frauen sie manchmal jahrzehntelang bearbeiteten, in endlosen Arbeitsgängen Code-Gruppen entschlüsselten und Namen eruierten, immer wieder von vorn beginnend, sobald neue Informationen auftauchten. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, zugleich der Höhepunkt der Babyboomer-Ära, als die amerikanische Frau vor allem den Haushalt führte, waren es Frauen, die dieses Arbeit machten."The Atlantic (USA), 29.08.2018
Angesichts dieses Artikels fühlt man sich versucht, sich die Chemnitzer Ereignisse nochmal aus ganz anderer Perspektive anzusehen. Michael Carpenter, Politologe an der University of Pennsylvania, legt einige krasse Fälle der Instrumentalisierung von Neonazis, Rockern und Kampfsportgruppen durch russische Geheimdienste dar. Schauplätze sind vor allem Osteuropa, aber auch Schweden und sogar die USA. Der krasseste Fall war Montenegro, "wo der russische Militärgeheimdienst GRU versuchte, einen Staatsstreich zu organisieren, um den Premierminister des Landes zu ermorden und Chaos bei der jüngsten Parlamentswahl im Land im Oktober 2016 zu verbreiten. Der Plan der GRU, so Montenegros Chef-Sonderstaatsanwalt bei der Untersuchung des versuchten Coups, beinhaltete die Verwendung von Cyberattacken, um sich in populäre Messaging-Apps wie Viber und WhatsApp zu hacken und falsche Gerüchte zu verbreiten, dass die Stimmenauszählung von der regierenden Partei manipuliert worden sei. Mit diesen Falschinformationen, so die Staatsanwälte wollte die GRU Demonstranten auf der Straße mobilisieren. Dann sollte eine Gruppe gemieteter Söldner in gestohlenen montenegrischen Polizeiuniformen das Parlamentsgebäude stürmen und auf Demonstranten schießen, um Panik und Aufruhr zu schaffen. Im anschließenden Chaos sollte der Premierminister ermordet werden, um das Land führungslos zu machen." Carpenter verweist auf eine Rekonstruktion der Ereignisse von Montenegro im Telegraph vor einem Jahr."
Republik (Schweiz), 03.09.2018
Wired (USA), 22.08.2018
 An Drastik lässt es Andy Greenberg in seinem Text über den in der deutschen Öffentlichkeit nur am Rande bemerkten NotPetya-Angriffs nicht fehlen. Die mutmaßlich vom russischen Militär lancierte Schadsoftware legte im vergangenen Jahr weite Teile der ukrainischen Infrastruktur lahm - und zwar laut Greenberg mit dem größt möglichen Schaden: Er wird auf rund zehn Milliarden Dollar beziffert. Auch jenseits der Ukraine kam es, da das Netz bekanntlich keine Nationalgrenzen kennt, zu zahlreichen Ausfällen. "NotPetya fraß ukrainische Computer zum Frühstück. Allein in Kiev wurden mindestens vier Krankenhäuser von dem Schlag getroffen, dazu sechs Energieunternehmen, zwei Flughäfen und mehr als 22 ukrainische Banken, Geldautomaten und Kartenbezahlsysteme in Handel und Transportwesen sowie so gut wie jede Einrichtung der Regierung. 'Die Regierung war tot', fasst die ukranische Verkehrsminister Volodymyr Omelyan die Lage zusammen. ... 60 Kilometer weiter waren selbst jene Computer, mit denen die Wissenschaftler die Aufräumarbeiten in Tschernobyl koordinierten, von dem Angriff betroffen. 'Sämtliche unserer Systeme standen massiv unter Beschuss', sagt Omelyan. ... Im ganzen Land stellten sich Ukrainer ähnliche Fragen: Hatten sie genug Geld im Haus, um sich für die Dauer des Schlags mit Lebensmittel und Benzin zu versorgen? Würden sie ihr Gehalt und ihre Renten erhalten? Würden sie weiterhin Medikamente erhalten? In der Nacht, als die Welt draußen noch darüber diskutierte, ob es sich bei NotPetya um kriminelle Ransomware oder um eine Waffe in einem staatlich gelenkten Cyber-Krieg handelte, sprachen die Mitarbeiter des internationalen Cyber-Security-Zusammenschlusses ISSP bereits von einem neuartigen Phänomen: einer 'massiven, koordinierten Cyber-Invasion'."
An Drastik lässt es Andy Greenberg in seinem Text über den in der deutschen Öffentlichkeit nur am Rande bemerkten NotPetya-Angriffs nicht fehlen. Die mutmaßlich vom russischen Militär lancierte Schadsoftware legte im vergangenen Jahr weite Teile der ukrainischen Infrastruktur lahm - und zwar laut Greenberg mit dem größt möglichen Schaden: Er wird auf rund zehn Milliarden Dollar beziffert. Auch jenseits der Ukraine kam es, da das Netz bekanntlich keine Nationalgrenzen kennt, zu zahlreichen Ausfällen. "NotPetya fraß ukrainische Computer zum Frühstück. Allein in Kiev wurden mindestens vier Krankenhäuser von dem Schlag getroffen, dazu sechs Energieunternehmen, zwei Flughäfen und mehr als 22 ukrainische Banken, Geldautomaten und Kartenbezahlsysteme in Handel und Transportwesen sowie so gut wie jede Einrichtung der Regierung. 'Die Regierung war tot', fasst die ukranische Verkehrsminister Volodymyr Omelyan die Lage zusammen. ... 60 Kilometer weiter waren selbst jene Computer, mit denen die Wissenschaftler die Aufräumarbeiten in Tschernobyl koordinierten, von dem Angriff betroffen. 'Sämtliche unserer Systeme standen massiv unter Beschuss', sagt Omelyan. ... Im ganzen Land stellten sich Ukrainer ähnliche Fragen: Hatten sie genug Geld im Haus, um sich für die Dauer des Schlags mit Lebensmittel und Benzin zu versorgen? Würden sie ihr Gehalt und ihre Renten erhalten? Würden sie weiterhin Medikamente erhalten? In der Nacht, als die Welt draußen noch darüber diskutierte, ob es sich bei NotPetya um kriminelle Ransomware oder um eine Waffe in einem staatlich gelenkten Cyber-Krieg handelte, sprachen die Mitarbeiter des internationalen Cyber-Security-Zusammenschlusses ISSP bereits von einem neuartigen Phänomen: einer 'massiven, koordinierten Cyber-Invasion'."Magyar Narancs (Ungarn), 04.09.2018
 Der junge Architekt Dávid Smiló macht sich für die Entdeckung und Anerkennung der postmodernen Architektur in den ehemaligen sozialistischen Ländern stark und weist auf eine schleichende aber doch systematische Umgestaltung von großen Plätzen insbesondere in polnischen und ungarischen Großstädten hin. "Architektonisch ist die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Ungarn und ehemaligen sozialistischen Block eine spannende Ära. Es sind Bauwerke entstanden, welche sich in die weltweit herrschenden Tendenzen einfügten, obwohl die Wirtschaft und das Umfeld, in dem Architekten ihr Wirken entfalteten, sich radikal unterscheiden konnte. Staatssozialismus statt Marktwirtschaft, staatliche Planungsinstitute statt individuellen, auf Wettbewerb ausgerichteten Architektenbüros. Der Stil der Ära ist noch nicht breit anerkannt, es wäre ein Verlust, wenn wir den gesamten Zeitraum als verfehlt verwerfen würden. (...) Warum will jede ehemals sozialistische Großstadt (wie in Warschau oder in Budapest) die damals entstandenen großen Plätze für feierliche Aufmärsche bebauen? Und wenn sie dann bebaut wurden, bleibt dann noch Platz, etwa für politische Kundgebungen? Diese Plätze wurden durch den Sozialismus erschaffen, aber auch für den Bürger einer Republik können sie nützlich sein, um dem politischen Willen Ausdruck zu verleihen."
Der junge Architekt Dávid Smiló macht sich für die Entdeckung und Anerkennung der postmodernen Architektur in den ehemaligen sozialistischen Ländern stark und weist auf eine schleichende aber doch systematische Umgestaltung von großen Plätzen insbesondere in polnischen und ungarischen Großstädten hin. "Architektonisch ist die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Ungarn und ehemaligen sozialistischen Block eine spannende Ära. Es sind Bauwerke entstanden, welche sich in die weltweit herrschenden Tendenzen einfügten, obwohl die Wirtschaft und das Umfeld, in dem Architekten ihr Wirken entfalteten, sich radikal unterscheiden konnte. Staatssozialismus statt Marktwirtschaft, staatliche Planungsinstitute statt individuellen, auf Wettbewerb ausgerichteten Architektenbüros. Der Stil der Ära ist noch nicht breit anerkannt, es wäre ein Verlust, wenn wir den gesamten Zeitraum als verfehlt verwerfen würden. (...) Warum will jede ehemals sozialistische Großstadt (wie in Warschau oder in Budapest) die damals entstandenen großen Plätze für feierliche Aufmärsche bebauen? Und wenn sie dann bebaut wurden, bleibt dann noch Platz, etwa für politische Kundgebungen? Diese Plätze wurden durch den Sozialismus erschaffen, aber auch für den Bürger einer Republik können sie nützlich sein, um dem politischen Willen Ausdruck zu verleihen."New York Times (USA), 04.09.2018

Kommentieren