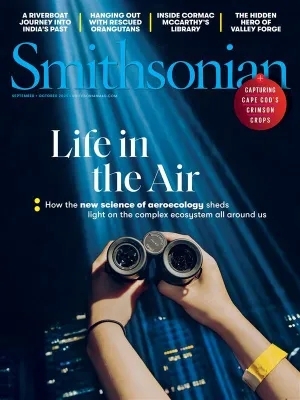
Richard Grant
begleitet ein Team von Literaturwissenschaftlern, das
Cormac McCarthys riesige Bibliothek in seinem entlegenen Anwesen in New Mexico katalogisieren und durchleuchten möchte. Dabei stellt sich unter anderem heraus, dass der zurückgezogen lebende, vor zwei Jahren gestorbene
Schriftsteller auch in handwerklichen Dingen - zahlreiche Möbel hatte er selbst gebaut und auch das Haus architektonisch modizifiert - gut bewandert war. Und dass er - Grillen braucht wohl jeder Mensch - trotz eines zumindest im Alter beträchtlichen Auskommens, an keinem
Geschirr-
Schnäppchen vorbeigehen konnte, ohne zuzuschlagen. "Die zweite große Entdeckung, in seinem Werk zu erahnen, aber durch seine Bibliothek zweifelsfrei belegt, ist die, dass McCarthy
ein intellektueller Universalgelehrter vom Rang eines Genies mit einer unstillbaren Neugier gewesen ist. Seine Interessen reichten von
Quantenphysik, die er sich durch die Lektüre von
190 Büchern über das berüchtigt herausfordernde Thema erschloss, über die Biologie der Wale, Geigen, obskure Nischen der französischen Geschichte im frühen Mittelalter bis zu den höchsten Ebenen der avancierten Mathematik. ... Dann erfuhr ich, dass er ein
bildhaftes Gedächtnis hatte und sich an nahezu alles erinnern konnte, was er je gelesen oder gehört hatte, darunter die Texte zu tausenden Songs. Mehr und mehr erschien McCarthy als ein Mann von zahllosen Talenten und grenzenloser Intelligenz, und doch lebte er im Kuddelmuddel eines
Hamsterers, der zu beschichteten Pfannen und Obstschalen einfach nicht Nein sagen konnte." Allerdings "fanden die Wissenschaftler
kaum Romane im Haus. Bis sie Kisten öffneten, die sein Bruder Dennis aus einem Außenlager in El Paso angefordert hatte. Aus ihnen purzelte der gesamte Kanon der westlichen Literatur, vom antiken Griechenland und Rom bis zu den besten Belletristen, Lyrikern und Essayisten der Siebziger, fast alle in billigen, abgenutzten Taschenbuchausgaben. 'Das sind die Bücher, die er in seinen Zwanzigern und Dreißigern und vielleicht noch in seinen Vierzigern las. Er war damals ständig pleite', erzählte Dennis. 'Sobald er zu Geld gekommen war, kaufte er all seine Bücher im Hardcover, wenn möglich, und las die letzten 40 Jahre seines Lebens dann so gut wie keine Belletristik mehr.' Warum? Eine Antwort findet man in McCarthys
tiefer Abscheu vor der modernen Gesellschaft, die er für verloren hielt, abgelöst von Natur, Geschichte und Tradition und auf dem Weg zum gesellschaftlichen Zusammenbruch und der Apokalypse. 'Cormac hielt die zeitgenössische Literatur für Zeitverschwendung', erzählte Denis, 'weil zeitgenössische Schriftsteller nicht mehr über die seriöse Kultur verfügen, um damit ihre Seelen zu füttern.'"