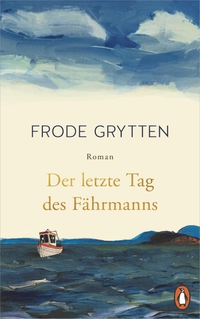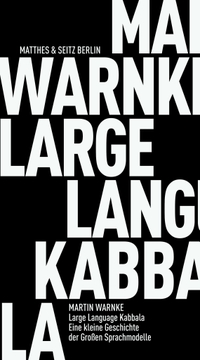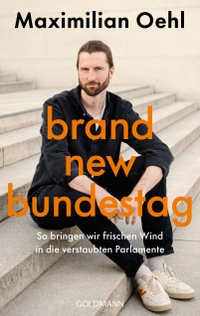9punkt - Die Debattenrundschau
Don't be Sorry, Be Angry
Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
Politik
Es gibt eine Wahrheit im Krieg, auch wenn sie sich manchmal schwer ermitteln lässt, schreibt die Politologin Kristin Helberg in der taz. Es gibt auch eine Wahrheit im Syrien-Krieg, wo bestimmte Fraktionen der Linken zu Relativismus neigen. Und es gibt auch eine Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Leider sind es gerade Medien und Experten, die die Unterscheidung verunklaren, meint Helberg: "Dies gilt auch für deutsche Professoren, die behaupten, sämtliche Chemiewaffenangriffe hätten 'unter falscher Flagge' stattgefunden, und damit den Boden der Wissenschaftlichkeit verlassen. Als Überzeugungstäter sind sie für die Verbreiter von Fake News besonders effektive Propagandainstrumente. Ein Wissenschaftler, der glaubt, was er sagt, wenn er Lügen verbreitet, ist das Beste, was Russia Today, Sputnik oder Fox News passieren kann." Und an die Adresse der Medien: "Morgens Experte A und nachmittags Experte B zu interviewen, hat nichts mit neutraler Berichterstattung zu tun, sondern entlarvt die eigene Unfähigkeit, Fake News zu erkennen."
"'Ehe für alle', Straffreiheit bei Abtreibung und ähnliche Errungenschaften rücken in Brasilien nun in weite Ferne", schreibt Hella Camargo bei hpd.de. Brasilien unter Jair Bolsonaro wäre ohne die Unterstützung der explosionsartig expandierenden evangelikalen Glaubensrichtungen, die solche gesellschaftlichen Errungenschaften bekämpfen, nicht denkbar: "Dies sorgte dafür, dass im Jahr 2000 noch etwa 15 Prozent der Bevölkerung den diversen Richtungen im Protestantismus zugerechnet werden konnten, 2010 bereits 22 Prozent und 2017 gar 27 Prozent. Etwa 15 Prozent davon werden den Frei- und Pfingstkirchen zugerechnet. Diese Zahlen spiegeln sich nicht nur in der Gesamtbevölkerung wider, sondern auch bei der Zusammensetzung der Abgeordneten. Waren es 1982 gerade einmal zwei Evangelikale im Parlament, finden sich heute etwa hundert von ihnen unter den 500 Abgeordneten."
Carole Cadwalladr, die für den Observer den Skandal um Cambridge Analytica aufdeckte und die in Großbritannien die Beziehungen zwischen den radikalen Brexiteers, Russland und der alt-Right-Bewegung in den USA untersuchte, insistiert im Blog der New York Review of Books: "Großbritannien und Amerika, Brexit und Trump, sind untrennbar miteinander verbunden. Durch Nigel Farage. Durch Cambridge Analytica. Durch Steve Bannon. Durch den russischen Botschafter in London, Alexander Jakowenko, der vom Sonderermittler Robert Mueller als Konnex zwischen dem Wahlkampfbüro Trumps und dem Kremls identifiziert wurde. Die selben Fragen, die sich zur amerikanischen Wahl stellen, stellen sich zum Brexit." Mit der Einschränkung, dass es in Großbritannien keine unabhängige Untersuchung gibt, so Cadwalladr.
Europa
Kulturmarkt
Urheberrecht

Der Künstler Nils Pooker hat das Richard-Wagner-Porträt des Reiss-Engelhorn-Museums, auf das das Museum Bildrechte geltend macht, verpixelt abgemalt und der Wikimedia-Stiftung geschenkt. Die Wikipedia darf das Gemälde nach einer Klage des Museums nicht abbilden. Im Blog Marta-Museums begründet Pooker, warum die Monopolisierung einer Reproduktion auf ein rechtefreies Bild durch ein der Öffentlichkeit verpflichtetes Museum ein Skandal für ihn ist: "Die willkürliche Interpretation des Gesetzestextes hat aus meiner Sicht nichts mit dem Werkcharakter der Reproduktion, nichts mit der Funktion des fotografischen Werkes und nichts mit dem beruflichen Selbstverständnis des dokumentierenden Fotografen zu tun, sondern allein mit dem Kontrollverlust über das Bild selbst. Ich sehe die Gefahr einer Wiederkehr historischer Bildverbote, lediglich neu interpretiert dank der Freiräume einer bürgerlichen und aufgeklärten Rechtsauffassung, die geschaffen wurden, um derartige Instrumentalisierungen für immer hinter sich zu lassen."
Ideen
Gesellschaft
Medien
Geschichte
In der NZZ erinnert Roswitha Schieb daran, dass der Erste Weltkrieg für die Völker Osteuropas eine Befreiung war: "Es ist erstaunlich, wie durch und durch deutsch (oder österreichisch) die jungen Studenten im Jahr 2018 empfinden, wie sehr sie von ihrer nationalen Geschichtsdarstellung durchdrungen und geprägt sind, wie wenig sie es vermögen, über den eigenen Tellerrand auf die nächsten Nachbarstaaten zu schauen und einen Perspektivwechsel vorzunehmen - und das bei einem Thema, das von Europa handelt. Denn '1918' klingt in anderen Ländern nicht nur nach Soldatenfriedhöfen, nicht nach Niederlage, Demütigung, Zerbrechen von Grossreichen, Ende der Monarchie, allgemeinem Untergang und Anfang vom Ende, sondern nach Befreiung, Unabhängigkeit und triumphalem Neuanfang."
Es gibt immer mehr Gedenkorte für die Opfer des Stalinismus in Russland. Meist sind es Tafeln mit den Namen der Opfer - damit kehrt das Individuum mit seiner Lebensgeschichte zurück ins Zentrum der Erinnerungskultur, schreibt die Osteuropahistorikerin Ekaterina Makhotina in der NZZ. Gleichzeitig wächst aber auch die Zahl der Denkmäler und Gedenktafeln zu Ehren Stalins. Putin steht dazwischen, gedenkt der Opfer, ohne die Täter zu nennen: "Die Erinnerung an den Stalinismus braucht ein anderes Format", meint Makhotina, "über das Gedenken an die Opfer hinaus. Es braucht zuerst und vor allem ein Bewusstsein für den Funktionsmechanismus des Stalinismus als politisches und soziales System, das Wissen über den Terror und seine Mitträgerschaft und Mittäterschaft in der Gesellschaft. Die Auseinandersetzung mit dem Stalinismus ist mehr als eine eindeutige negative juristische Bewertung von Stalins Figur. Sie braucht die Bereitschaft, sich dem Unbehagen der Erinnerung zu stellen, einer schmerzhaften Erinnerung. Schmerzhaft nicht nur wegen des Mitgefühls für die Opfer, sondern auch wegen des Wissens um eine Gesellschaft, in der der eine von der Not des anderen profitierte und sozial aufstieg, in der nach 'nationalen Verrätern' oder der 'fünften Kolonne' gesucht - und denunziert - wurde."