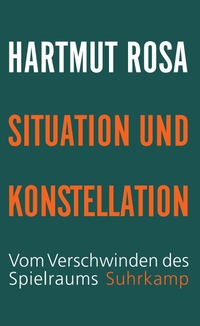9punkt - Die Debattenrundschau
Co-Autoren der Ordnung
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
21.11.2025. In der SZ sieht Jürgen Habermas schwarz für die Zukunft Europas. Vom Ukrainekrieg profitiert nur einer: Xi Jinping, meint Viktor Jerofejew in der FAZ. Xi ist allerdings von Paranoia geplagt, das lässt für China nichts Gutes erwarten, warnt in der NZZ der amerikanische Politikwissenschaftler Brahma Chellaney. Die Brandmauer muss bleiben, fordert in der SZ die Politikwissenschaftlerin Heike Klüver. Die nützt allerdings nichts mehr, wenn die AfD stärkste Partei wird. Die Zeit fragt: Wo sind eigentlich die anderen Parteien in Sachsen-Anhalt?
Efeu - Die Kulturrundschau
vom
21.11.2025
finden Sie hier
Europa
Wie sich herausstellt, haben Trump und Russland über die Köpfe der Ukraine und der EU hinweg permanent weiterverhandelt. Herauskam ein "Friedensplan", der darin besteht, dass die Ukraine Putin zum Fraß vorgeworfen wird. Alle Territorialgewinne soll Russland behalten, und die Ukraine soll ihre Armee halbieren. Zuerst lanciert wurde diese Meldung vom Nachrichtenportal Axios. Die deutschen Zeitungen reagieren heute praktisch noch gar nicht. Meduza.io sammelt erste Reaktionen, am zutreffendsten wohl die des ukrainischen Journalisten Illia Ponomarenko: "Oh ja, eine militaristische Diktatur für einen Angriffskrieg in Europa belohnen, ihre maximalistischen Forderungen vollständig erfüllen und dann die Opfer zu einer vollständigen Kapitulation zwingen - Opfer, die sie nicht einmal auf dem Schlachtfeld besiegen konnten. […] Absolut realistische und ernsthafte Ideen zur Erreichung eines 'dauerhaften Friedens', daran besteht kein Zweifel."
Vor dreißig Jahren hat das Dayton-Abkommen den Bosnienkrieg beendet. Dennoch ist es im Ergebnis ein Fiasko, meint Erich Rathfelder in der taz: Das Abkommen habe "das Land in ein Korsett presst, das keine ernsthaften Reformen zulässt. Indem das Land entlang streng 'ethnisch' definierter Zonen aufgeteilt und mit einer komplizierten Verfassung ausgestattet wurde, versuchte die Internationale Diplomatie damals um des Friedens willen den Kriegsparteien aus Serben, Kroaten und Bosniaken entgegenzukommen - mit dem Resultat, dass das Denken in Ethnien, die ideologische Basis des Krieges, verfestigt wurde. ... Die Struktur des Staates ist kompliziert, jeder Teilstaat hat eigene Parlamente, eigene Exekutiven, ein eigenes Gerichtssystem. Sie eröffnet viele Möglichkeiten der (Selbst-)Blockade."
Was wäre denn die Alternative gewesen, fragt im taz-Interview Christopher Hill, der damals für die USA an den Verhandlungen teilnahm: "Wir hatten keine Absicht, Probleme auf ethnischer Grundlage zu 'zementieren'. Das haben die Beteiligten selbst getan. Es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, wie brutal dieser Krieg war. Bis zu 200.000 Zivilisten wurden getötet, vielfach grausam ermordet. ... Die Hoffnung war, dass sich die Parteien über die Jahre von ethnischen zu themenbasierten Anliegen bewegen würden. Aber das liegt an ihnen - an den Bosniaken, Kroaten und Serben. Sie haben versagt. Wir haben nie erwartet, dass Dayton 30 Jahre später noch existiert. Ich lehne die Vorstellung ab, dass Dayton sie zum Scheitern verurteilt hat."
Putin hat den Angriff auf die Ukraine nur gewagt, weil die Chinesen ihn unterstützen, ist in der FAZ Viktor Jerofejew überzeugt. "Für China ist der russisch-ukrainische Krieg ein kostbares Geschenk. Denn er ermöglicht dem Land, seine Position als eine führende Weltmacht zu festigen, Russland in der internationalen Arena zu schwächen, in eine gewisse Isolation zu treiben und zugleich die politische Schwäche Europas vorzuführen, das wegen dieses Krieges gespalten dasteht und keine gute Figur macht. Europa hat nicht die politischen, diplomatischen und ökonomischen Hebel gefunden, um den Krieg zu beenden." Dafür hat Jerofejew eine Idee, deren Zynismus eines Putin würdig wäre: "Am besten wäre es für Xi, den goldenen Schlüssel [zum Frieden in der Ukraine, d. Perlentaucher] gegen die Einnahme von Taiwan einzutauschen."
Vor dreißig Jahren hat das Dayton-Abkommen den Bosnienkrieg beendet. Dennoch ist es im Ergebnis ein Fiasko, meint Erich Rathfelder in der taz: Das Abkommen habe "das Land in ein Korsett presst, das keine ernsthaften Reformen zulässt. Indem das Land entlang streng 'ethnisch' definierter Zonen aufgeteilt und mit einer komplizierten Verfassung ausgestattet wurde, versuchte die Internationale Diplomatie damals um des Friedens willen den Kriegsparteien aus Serben, Kroaten und Bosniaken entgegenzukommen - mit dem Resultat, dass das Denken in Ethnien, die ideologische Basis des Krieges, verfestigt wurde. ... Die Struktur des Staates ist kompliziert, jeder Teilstaat hat eigene Parlamente, eigene Exekutiven, ein eigenes Gerichtssystem. Sie eröffnet viele Möglichkeiten der (Selbst-)Blockade."
Was wäre denn die Alternative gewesen, fragt im taz-Interview Christopher Hill, der damals für die USA an den Verhandlungen teilnahm: "Wir hatten keine Absicht, Probleme auf ethnischer Grundlage zu 'zementieren'. Das haben die Beteiligten selbst getan. Es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, wie brutal dieser Krieg war. Bis zu 200.000 Zivilisten wurden getötet, vielfach grausam ermordet. ... Die Hoffnung war, dass sich die Parteien über die Jahre von ethnischen zu themenbasierten Anliegen bewegen würden. Aber das liegt an ihnen - an den Bosniaken, Kroaten und Serben. Sie haben versagt. Wir haben nie erwartet, dass Dayton 30 Jahre später noch existiert. Ich lehne die Vorstellung ab, dass Dayton sie zum Scheitern verurteilt hat."
Putin hat den Angriff auf die Ukraine nur gewagt, weil die Chinesen ihn unterstützen, ist in der FAZ Viktor Jerofejew überzeugt. "Für China ist der russisch-ukrainische Krieg ein kostbares Geschenk. Denn er ermöglicht dem Land, seine Position als eine führende Weltmacht zu festigen, Russland in der internationalen Arena zu schwächen, in eine gewisse Isolation zu treiben und zugleich die politische Schwäche Europas vorzuführen, das wegen dieses Krieges gespalten dasteht und keine gute Figur macht. Europa hat nicht die politischen, diplomatischen und ökonomischen Hebel gefunden, um den Krieg zu beenden." Dafür hat Jerofejew eine Idee, deren Zynismus eines Putin würdig wäre: "Am besten wäre es für Xi, den goldenen Schlüssel [zum Frieden in der Ukraine, d. Perlentaucher] gegen die Einnahme von Taiwan einzutauschen."
Ideen
Jürgen Habermas sieht in einem Vortrag, den er vorgestern in der Münchner Siemens-Stiftung gehalten hat und den die SZ heute abdruckt, schwarz für die Zukunft Europas: Die USA entwickeln sich in seinen Augen unaufhaltsam in ein "politisch autoritär gesteuertes, technokratisch verwaltetes, aber ökonomisch libertäres Gesellschaftssystem", das seine Führungsrolle in der Welt schon verloren habe. Der Ukrainekrieg habe Europa jedoch gezeigt, wie schwach es ohne die USA sei. Nötig wäre laut Habermas der "Aufbau einer gemeinsamen europäischen Verteidigung" und eine "engere wirtschaftliche Integration" mit Frankreich (von den Osteuropäern hält er nach wie vor nicht viel), wozu auch Eurobonds gehörten. Aber nichts davon wird geschehen, fürchtet er: "Darum halte ich es für wahrscheinlich, dass Europa weniger denn je in der Lage sein wird, sich von der bisherigen Führungsmacht USA abzukoppeln. Ob es in diesem Sog sein normatives und bislang immer noch demokratisches und liberales Selbstverständnis aufrechterhalten kann, wird dann aber die zentrale Herausforderung sein. Am Ende eines politisch eher begünstigten politischen Lebens fällt mir die trotz allem beschwörende Schlussfolgerung nicht leicht: Die weitere politische Integration wenigstens im Kern der Europäischen Union war für uns noch nie so überlebenswichtig wie heute. Und noch nie so unwahrscheinlich."
In einem nebenstehen SZ-Artikel resümiert Jens-Christian Rabe weitere Beiträge des Münchner Kolloquiums, die weniger deprimierend waren: "Besonders die Vorträge des Soziologen Hauke Brunkhorst und des Frankfurter Rechtstheoretikers Klaus Günther allerdings ließen sich schon als beherzte Versuche der Rückeroberung interpretieren, des richtigen Verständnisses davon, was die Demokratie eigentlich ist, oder der Rechtstaat. Gegen die zuletzt erstaunlich erfolgreiche rechtspopulistische Strategie, so zu tun, als müsse die Demokratie vor allem als blanke Herrschaft der Mehrheit wiederentdeckt werden, hielt Brunkhorst ein engagiertes Plädoyer für die Demokratie als Idee, die nur dann wirklich bei sich sei, wenn sich 'freie und gleiche Bürgerinnen und Bürger' als ständige Co-Autoren der Ordnung begreifen - und nicht bloß alle paar Jahre mal als Wahlverlierer oder Wahlgewinner."
Libertäre werden oft als radikalisierte Liberale verstanden, aber der Trumpismus und Tendenzen in Europa zeigen, dass sie in ihrer emphatischen Ablehnung des Staats auch nur eine Ideologie pflegen, die den Einzelnen am Ende negiert, schreibt Alan Posener in seinem Blog: "Die Libertären ... verabsolutieren die Kritik am demokratischen Staat, den sie als Feind ansehen, und verbünden sich im Namen der Freiheit mit den reaktionärsten Kräften - auch deshalb, weil sie letztlich, wie die Reaktionären, die Masse verachten, das Schwache verabscheuen und das Starke anbeten. Deshalb haben sie eine offene Flanke hin zum Faschismus, der die Förderung der angeblich überlegenen Rasse und der Starken innerhalb dieser Rasse zur Aufgabe des Staates, ja die Freiheit des Starken gegenüber den Schwachen zum Kern ihrer Moral machte."
In einem nebenstehen SZ-Artikel resümiert Jens-Christian Rabe weitere Beiträge des Münchner Kolloquiums, die weniger deprimierend waren: "Besonders die Vorträge des Soziologen Hauke Brunkhorst und des Frankfurter Rechtstheoretikers Klaus Günther allerdings ließen sich schon als beherzte Versuche der Rückeroberung interpretieren, des richtigen Verständnisses davon, was die Demokratie eigentlich ist, oder der Rechtstaat. Gegen die zuletzt erstaunlich erfolgreiche rechtspopulistische Strategie, so zu tun, als müsse die Demokratie vor allem als blanke Herrschaft der Mehrheit wiederentdeckt werden, hielt Brunkhorst ein engagiertes Plädoyer für die Demokratie als Idee, die nur dann wirklich bei sich sei, wenn sich 'freie und gleiche Bürgerinnen und Bürger' als ständige Co-Autoren der Ordnung begreifen - und nicht bloß alle paar Jahre mal als Wahlverlierer oder Wahlgewinner."
Libertäre werden oft als radikalisierte Liberale verstanden, aber der Trumpismus und Tendenzen in Europa zeigen, dass sie in ihrer emphatischen Ablehnung des Staats auch nur eine Ideologie pflegen, die den Einzelnen am Ende negiert, schreibt Alan Posener in seinem Blog: "Die Libertären ... verabsolutieren die Kritik am demokratischen Staat, den sie als Feind ansehen, und verbünden sich im Namen der Freiheit mit den reaktionärsten Kräften - auch deshalb, weil sie letztlich, wie die Reaktionären, die Masse verachten, das Schwache verabscheuen und das Starke anbeten. Deshalb haben sie eine offene Flanke hin zum Faschismus, der die Förderung der angeblich überlegenen Rasse und der Starken innerhalb dieser Rasse zur Aufgabe des Staates, ja die Freiheit des Starken gegenüber den Schwachen zum Kern ihrer Moral machte."
Gesellschaft
Die Brandmauer muss stehen bleiben, fordert in der SZ die Politikwissenschaftlerin Heike Klüver in der Debatte über den Umgang der CDU mit der AfD. Sie verweist auf Untersuchungen des Instituts für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität, das "57 Demokratien, 1237 Regierungen, vom Ende der 1970er-Jahre bis in die Gegenwart" begleitet habe. "Das Ergebnis ist eindeutig: Regierungsbeteiligung schwächt die radikale Rechte nicht, sondern stärkt sie. Weder formelle Regierungsbeteiligung noch die lose Unterstützung von Minderheitsregierungen führt zu einem Rückgang rechter Wählerzustimmung. Im Gegenteil: Im Durchschnitt gewinnen rechtsradikale Parteien bis zur nächsten Wahl rund sechs Prozentpunkte hinzu. Die Idee, man könne die radikale Rechte 'entzaubern', indem man sie in die Verantwortung hebt, findet in den Daten keinerlei Bestätigung."
Die Frage könnte sich allerdings bald stellen, ob die AfD überhaupt noch jemanden braucht, der sie "in die Verantwortung hebt", wie Klüver es ausdrückt. Beim Wahlkampf auf dem Land in Sachsen-Anhalt scheint sie als einzige Partei wirklich präsent zu sein, liest man die Reportage von Tilmann Steffen in der Zeit: "Auf Instagram ist das letzte Foto, auf dem ein lokaler Infostand der Sozialdemokraten zu sehen ist, aus dem Bundestagswahlkampf im Februar 2025. Die Aktivitäten der regionalen Bundespolitiker erschöpfen sich in Unternehmensbesuchen. Viele Facebook-Auftritte der länger etablierten Landesparteien sind seit Monaten, teils Jahren nicht aktualisiert, wenn sich - auch auf den Websites der Verbände - öffentliche Veranstaltungen finden, liegen sie Monate oder noch länger zurück. Ankündigungen oder Einladungen sucht man vergebens. Die AfD dagegen feuert ihre Botschaften im Tages- und Stundentakt in sämtliche der verbreiteten sozialen Netzwerke ab."
Die Frage könnte sich allerdings bald stellen, ob die AfD überhaupt noch jemanden braucht, der sie "in die Verantwortung hebt", wie Klüver es ausdrückt. Beim Wahlkampf auf dem Land in Sachsen-Anhalt scheint sie als einzige Partei wirklich präsent zu sein, liest man die Reportage von Tilmann Steffen in der Zeit: "Auf Instagram ist das letzte Foto, auf dem ein lokaler Infostand der Sozialdemokraten zu sehen ist, aus dem Bundestagswahlkampf im Februar 2025. Die Aktivitäten der regionalen Bundespolitiker erschöpfen sich in Unternehmensbesuchen. Viele Facebook-Auftritte der länger etablierten Landesparteien sind seit Monaten, teils Jahren nicht aktualisiert, wenn sich - auch auf den Websites der Verbände - öffentliche Veranstaltungen finden, liegen sie Monate oder noch länger zurück. Ankündigungen oder Einladungen sucht man vergebens. Die AfD dagegen feuert ihre Botschaften im Tages- und Stundentakt in sämtliche der verbreiteten sozialen Netzwerke ab."
Politik
Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping entlässt immer wieder Beamte - zuletzt neun hochrangige Generäle -, die angeblich korrupt sein sollen, aber es geht im wohl eher darum, "endlos potenzielle Rivalen auszuschalten", meint in der NZZ der amerikanische Politikwissenschaftler Brahma Chellaney, der das für ein Zeichen von Schwäche hält. "Xis Befürchtungen sind nicht ganz unberechtigt: Jede neue Säuberungsaktion vertieft das Misstrauen innerhalb von Chinas Elite und droht ehemalige Loyalisten zu Feinden zu machen. Von Mao Zedong bis Josef Stalin gibt es reichlich Belege dafür, dass eine Ein-Mann-Herrschaft Paranoia hervorruft. Inzwischen ist Xi womöglich gar nicht mehr imstande, Verbündete von Feinden zu unterscheiden. Mit seinen 72 Jahren ist sich Xi seiner Position derart unsicher, dass er sich - anders als Mao - weigert, einen Nachfolger zu benennen, weil er fürchtet, ein sichtbarer Erbe könnte seinen eigenen Untergang beschleunigen. Das alles verheißt nichts Gutes für China."
1 Kommentar