Efeu - Die Kulturrundschau
Mimik ohne Scheu
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
Film

Alle Feuilletons trauern um Hannelore Elsner, die am Osterwochenende nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben ist. Es gab und gibt nicht viele Stars in Deutschland, aber sie war eine der großen Ausnahmen und ihr Stern strahlte besonders hell am Kino-Firmament, schreiben Christiane Peitz und Gunda Bartels im Tagesspiegel: "Die starke Frau, die schwache Frau, das sexy Mädel, das überkommene deutsche Rollenbild der adretten, patenten, tüchtigen Frau, und auch die moderne, selbstständige Frau, die sich um Rollenbilder nicht länger schert - sie hat sie verkörpert. Auch die scheiternde Heldin. Die Frauen der Nachkriegs-Jahrzehnte, in Haupt- und in Nebenrollen."
In der FAZ schreibt der Schriftsteller Bodo Kirchhoff einen Liebesbrief an die Verstorbene: "Als sie zum ersten Mal auf mich zutrat, im Gedränge einer Buchmesseparty, war ich fast erschrocken über diese Schönheit, auf die die üblichen Beiworte nicht zutrafen. Hannelore war in allem apart, eine Eigenwelt, mit ihrer auch eigenen Einsamkeit, und zu diesem aparten Wesen gehörte die Stimme, der man nicht müde wurde zuzuhören, eine Stimme, die das Gesagte manchmal in den Hintergrund treten ließ wie das Libretto bei einem tragenden Gesang." Auf diese besondere Stimme kommen auch Anne Fromm (in einer taz-Notiz) und Anke Sterneborg auf ZeitOnline zu sprechen: "Diese wunderbare Stimme schmeichelt sich in die Erinnerung. Dieser sinnliche, zugleich tiefe und weiche und vor allem ewig junge Klang von Hannelore Elsners Timbre, während sie ganz furchtlos mit dem Alter spielte, als wolle sie seine Wirkung auskosten, es für sich selber und alle anderen ergründen."
Jan Feddersen geht in der taz auf die Knie vor Elsners Leistung in ihrem frühen Film "Die endlose Nacht", den Will Tremper 1963 nachts auf dem Flughafen Tempelhof gedreht hat, über dessen Gelände die junge Elsner als melancholische Diva irrlichtert: Das war "fast Film noir, das war Nouvelle vague, und das war eine Hannelore Elsner, die aus dieser Figur so etwas wie einen Kern an überlebenswilliger Glaubwürdigkeit ohne Würdeverlust abringt. Wie sie auf ihren Pumps schreitet, wie in ihrem Gang noch keine sittliche Damenhaftigkeit erkennbar war, ihre Mimik ohne Scheu, aber nicht frech oder aufmüpfig: Sie will nicht verkaufen und weiß doch nicht, wie das immer zu vermeiden sein könnte." Und ja, diesen Film - einen der schönsten deutschen Filme der sechziger Jahre - muss man unbedingt gesehen haben. Ein paar Eindrücke aus dem Trailer:
Für den Rest des Feuilletons bleibt sie vor allem "die Unberührbare" aus Oskar Roehlers gleichnamigem Film aus dem Jahr 2000, in dem sie zwar unter anderem Rollennamen, aber leicht erkennbar Roehlers Mutter, die Schriftstellerin Gisela Elsner, spielt. "Wie sie den Verfall, den Weg in die Dunkelheit spielte, mit welcher Würde, die starre schwarze Perücke wie einen Helm tragend, der sie vor der Welt schützen soll, das war einfach großartig", schwärmt Peter Körte in der FAZ. Auf einmal "setzte sich tatsächlich langsam die Erkenntnis durch, dass sie eine der Großen war im deutschen Schauspielgeschäft", schreibt Tobias Kniebe in der SZ. "Endlich konnte sie auf der Leinwand rauchen und durch die Bars ziehen und Dior tragen", schreibt Hanns-Georg Rodek in der Welt. Dieser Film "war die Belohnung für 40 Jahre Durchhalten im deutschen Kino, endlich ein Film, in dem Hannelore Elsner all das zeigen durfte, was sie schon lange hätte zeigen können, würde man sie gelassen haben."
Weitere Nachrufe in Berliner Zeitung, NZZ und im Standard. Im Gespräch mit Dlf Kultur erinnert sich Doris Dörrie an Hannelore Elsner. Der Tagesspiegel sammelt Stimmen von Kollegen. Und in diesem viertelstündigen Video spricht Elsner über ihre Karriere:
Weitere Artikel: Im SZ-Interview stellt Efe Çakarel seinen Streamingdienst Mubi vor, der sich mit Arthaus und Autorenfilm gezielt als Alternative zum Netflix-Mainstream positioniert und allmählich auch eigene Inhalte produzieren will. Besprochen werden Julian Schnabels Van-Gogh-Biopic (Presse, mehr dazu hier), Sergej Dworzewojs "Ayka" (Welt, mehr dazu hier) und mal wieder ein Superhelden-"Avengers"-Film aus dem Hause Marvel (Standard, Tagesspiegel, Presse, Welt).
Kunst

Die Tate Britain zeigt in einer temporären Präsentation ausschließlich Werke von Künstlerinnen aus der eigenen Sammlung. Guardian-Kritiker Adrian Searle freut sich zwar über viele großartige Arbeiten, von Gillian Wearing, Mary Martin, Bridget Riley oder Rose Wylie. Trotzdem ist er von der Schau enttäuscht: "Das Problem mit den meisten Bestandsausstellungen ist eben, dass sie von den Beständen abhängen, und diese wiederum von den Launen des Geschmacks, vom Budget eines Museums und wonach es sucht. Es zeigt sich zur großen Überraschung, dass Susan Hillers raumgroße Installation 'Belshazzar's Feast, The Writing on Your Wall" von 1984, zu der auch das Video eines brennenden Feuers gehört, überhaupt die erste Videoarbeit war, die die Tate gekauft hat. Das ist nicht bezeichnend, das ist deprimierend. Der Tate zufolge ist diese Präsentation Teil ihres Engagements, die Repräsentation von Frauen in der gesamten Galerie zu erhöhen. Aber es gibt hier keine Tiefe, keinen Fokus, keine echte Hinterfragung des Kanons. Man möchte, dass sie aufrüttelt, aber sie tut es nicht. Anders als als die Ausstellung elle@centrepompidou vor zehn Jahren ist es kein ernsthafter Blick auf eine Museumskollektion von einer weiblicher Perspektive, vielleicht auch weil die Bestände der Tate historisch nicht konsistent und kraftvoll genug waren."
Weiteres: NZZ-Kritiker Philipp Meier kennt in Europa noch Museen, in denen man seine Ruhe hat: "Von Konsumzwängen ist man in einem Museum völlig frei. Und verhandeln muss man mit niemandem, geschweige denn überhaupt kommunizieren. In einem Museum ist es wohltuend still, gesprochen wird nur in leisem Ton." Dresden war auch einmal ein Ort der Avantgarde, versichert Anne Katrin Fessler im Standard und empfiehlt nachdrücklich die Ausstellung "Zukunftsräume" im Albertinum, die nicht nur ein Licht auf die Protagonisten des abstrakten Konstruktivismus wirft, sondern auch auf das Ausstellungsmachen selbst, auf Ereignis und Raumgefühl. FAZ-Autorin Melanie Mühl lernt in der Hamburger Schau "Generation Wealth" der Fotografin Lauren Greenfield, dass das Leben einer Prinzessin "knallharte Arbeit" ist.
Besprochen werden die Ausstellung "Bauhaus und die Fotografie" im Museum für Fotografie in Berlin (taz), eine große Ausstellung über den flämischen Maler Bernard van Orley im Bozar-Museum in Brüssel (FAZ) und eine Ausstellung der Künstlerin Alexandra Bircken in der Galerie der Stadt Schwaz (Standard).
Literatur
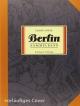 Im taz-Gespräch erklärt der US-Comiczeichner Jason Lutes was ihn zu seinem nach vielen Jahren endlich abgeschlossenen "Berlin"-Epos über die unmittelbare Vorgeschichte des "Dritten Reichs" und des Zweiten Weltkriegs inspiriert hat: Die Initialzündung bildete ein Buch über Bertolt Brechts Berlin der 20er Jahre, auf das er zufällig gestoßen ist. "Die Stadt Seattle, in der ich damals lebte, war durch ihre blühende Musikszene ein Zentrum für Künstler und hatte ein ähnliches Flair wie das Berlin der 20er. ...Auf jeden Fall war Alfred Döblins Roman 'Berlin Alexanderplatz' wichtig. Rückblickend erkenne ich viele Parallelen zwischen seinem Werk und meinem Comic: in der Struktur, in der Parallelerzählung mehrerer Figuren, aber auch ästhetisch. Ich hatte Schwierigkeiten, Fotos zu finden. Von manchen historischen Orten, vor allem von Innenräumen: Wie sah es in den verschiedenen Milieus zu Hause aus, oder wie auf einem Polizeirevier? Da musste ich manches Mal auch spekulieren."
Im taz-Gespräch erklärt der US-Comiczeichner Jason Lutes was ihn zu seinem nach vielen Jahren endlich abgeschlossenen "Berlin"-Epos über die unmittelbare Vorgeschichte des "Dritten Reichs" und des Zweiten Weltkriegs inspiriert hat: Die Initialzündung bildete ein Buch über Bertolt Brechts Berlin der 20er Jahre, auf das er zufällig gestoßen ist. "Die Stadt Seattle, in der ich damals lebte, war durch ihre blühende Musikszene ein Zentrum für Künstler und hatte ein ähnliches Flair wie das Berlin der 20er. ...Auf jeden Fall war Alfred Döblins Roman 'Berlin Alexanderplatz' wichtig. Rückblickend erkenne ich viele Parallelen zwischen seinem Werk und meinem Comic: in der Struktur, in der Parallelerzählung mehrerer Figuren, aber auch ästhetisch. Ich hatte Schwierigkeiten, Fotos zu finden. Von manchen historischen Orten, vor allem von Innenräumen: Wie sah es in den verschiedenen Milieus zu Hause aus, oder wie auf einem Polizeirevier? Da musste ich manches Mal auch spekulieren."Weitere Artikel: Gregor Dotzauer (Tagesspiegel) und Tilman Spreckelsen (FAZ) schreiben Nachrufe auf den Schriftsteller Dieter Forte. Besprochen werden unter anderem Kamel Daouds "Zabor oder Die Psalmen" (NZZ), Gary Shteyngarts "Willkommen in Lake Success" (SZ), Pierre Lemaitres "Die Farben des Feuers" (NZZ) und Alexander Pechmanns "Die Nebelkrähe" (FAZ).
Mehr auf unserem literarischen Meta-Blog Lit21 und ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau.
Bühne
Besprochen werden das neue Stück "Chinchilla Arschloch, waswas" von Rimini Protokoll, das in Frankfurt Tourette-Menschen auf die Bühne bringt (SZ), Barrie Koskys Berliner Inszenierung von Oscar Straus' Operette "Eine Frau, die weiß, was sie will" als Gastspiel in Zürich (NZZ), Hannah Schassners "Kopfgeburten" nach Max Frisch in den Frankfurter Landungsbrücken (FR), Tilmann Köhlers Inszenierung von Shakespeares "Coriolan" in Düsseldorf (FAZ) und Richard Strauss' "Salome" an der Wiener Staatsoper (Standard).
Musik
Mit großem Aufwand wird derzeit eine Wilhelm-Furtwängler-Mega-Edition lanciert, die insbesondere damit für sich wirbt, die alten Aufnahmen digital aufgemotzt und bereinigt zu haben. Insbesondere wegen der beiliegenden schriftlichen Dokumentation ist diese Veröffentlichung eine Kostbarkeit, schreibt Martin Elste in der FAZ, der sich gegenüber dem werbeträchtig eingesetzten "akustischen Face-Lifting" allerdings durchaus skeptisch zeigt: Furtwängler würde schließlich auch aus einem Küchenradio überwältigen und "wie authentisch ist ein Konzertmitschnitt, der Publikumsgeräusche, welche die damaligen Mikrofone stärker mit aufnahmen, als das heute der Fall ist, dank moderner Digitaltechnik so herausfiltert, dass sie nicht mehr hörbar sind?"
Weiteres: NZZ-Autor Hanspeter Künzler beobachtet ein Punk- und Hardcore-Revival in Großbritannien und den USA. Besprochen werden das Tics-Album "Agnostic Funk" (taz), der Soundtrack einer Doku über das Indielabel Wax Trax (Pitchfork) und neue Popveröffentlichungen, darunter das neue Album "Happy Now" der einstigen Postpunk-Pioniere Gang of Four, das SZ-Popkolumnist Jens-Christian Rabe immerhin sehr passabel findet. Ein Video daraus:








