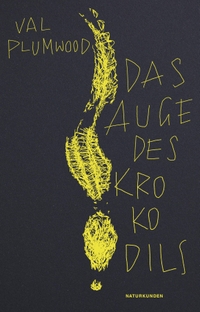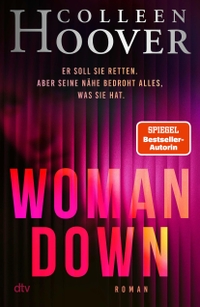Efeu - Die Kulturrundschau
Keine unbequemen Fragen
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
12.08.2021. Die taz erlebte ein absolutes Opern-Highlight mit Francesco Cavallis Barockoper "Ormindo" auf dem Bürgerplatz in Berlin-Schöneberg. Die Zeit fragt: Warum erklären Kuratoren nicht offen, wo für sie die Grenze zwischen High und Low liegt? Franziska Stünkels Film "Nahschuss" über einen Stasispitzel sagt mehr über die Wessis aus als über die Stasi, meint der Tagesspiegel. Der SZ gefallen die Braun-, Grau- und Sepia-Töne des düster glimmenden Films. Schmeißt die Leggings in die Ecke, Powerdressing ist wieder angesagt, versichert die NZZ den arbeitenden Frauen.
9punkt - Die Debattenrundschau
vom
12.08.2021
finden Sie hier
Film

Franziska Stünkel hat ihren Film "Nahschuss" an das Schicksal von Werner Teske angelehnt, dem letzten, der 1981 noch der Todesstrafe in der DDR zum Opfer fiel - zuvor war er selbst Stasi-Spion gewesen. Tagesspiegel-Kritiker Matthias Dell sah einen nicht voll durchdachten Film mit "ungelenkem Drehbuch". Es gehe um "Schlüsselreize", wenn etwa Hauptdarsteller Lars Eidinger seiner Figur "eine Palette Unwohlsein aufs Gesicht tanzt. Dieses einfache Entsetzen erzählt aber eher etwas über die (westdeutsche) Perspektive auf Geheimdienstpraktiken eines repressiven Regimes als über die Dramen im MfS." In der taz geht Wilfried Hippen hingegen auf die Knie vor Eidingers Schauspiel.
Stünkel konzentrierte sich in ihrem Film so sehr auf den Verfall ihrer Hauptfigur, "dass wesentliche Dimensionen seines Schicksals eher vorausgesetzt als erzählt werden", schreibt Bert Rebhandl in seiner online nachgereichten FAZ-Kritik. So gerät die Figur zur "Attrappe, an der die DDR als Unrechtsstaat kenntlich gemacht wird. Das Wesen dieses Unrechts aber bleibt äußerlich. Damit wird "Nahschuss" zu einem weiteren Beispiel für die Folklorisierung der DDR. ... Der sozialistische deutsche Staat interessiert dabei vor allem in Form seines Designs, seiner betont anderen Lebenswelt, wobei es unfreiwillig zu ironischen Momenten kommt." Annett Scheffel dankt der Regisseurin derweil in der SZ, dass sie keinen Spionagethriller aus dem Stoff gemacht hat. "Der Fall hätte das hergegeben. Aber Stünkel geht es in ihrem hervorragend ausgestatteten und in Braun-, Grau- und Sepia-Tönen düster glimmenden Film um das Psychogramm eines Mannes, der sich in einem erbarmungslosen System verstrickt - und in seiner eigenen Schuld."
Die SZ macht einen Schwerpunkt zu 9/11 in den Künsten. Im Zuge erzählt auch Klaus Lemke, wie es ihm gelungen ist, in seiner ZDF-Komödie "Sylvie" (hier in voller Länge) 1973 atemberaubend tolle Szenen auf dem Dach des World Trade Centers zu drehen: Der US-Modefotograf Ben Wett hatte sich in Lemkes Hauptdarstellerin Sylvie Winter verknallt und wollte ein Shooting. "Wir wollten aufs Dach des World Trade Center." Aber "die Eröffnung war erst ein paar Wochen später, und die Aktion war natürlich nicht offiziell genehmigt. Wenn das Ding schon offen gewesen wäre, hätte nicht mal der irre Ben Wett uns da hochgebracht. Aber um Sylvie zu beeindrucken, organisierte er einen Hubschrauber, der am Hudson River auf uns wartete und dann mit uns aufs World Trade Center flog. Da sieht man mal, was Liebe alles bewirken kann. ... Ich hatte eine Heidenangst. Ich war noch nie in einem Hubschrauber geflogen, und dann diese Landung auf dem Dach. Als wir gelandet sind, war mir so schwindlig, dass ich mich erst mal auf den Boden legen musste." Für diese Szene - inklusive 9/11-Irritationsmoment gleich zu Beginn, wenn ein Flugzeug durchs Bild rauscht - hat es sich mehr als gelohnt:
Weitere Artikel: Beim Filmfestival Locarno zählt Sabrina Sarabis "Niemand ist bei den Kälbern" mit Saskia Rosendahl zu den großen Highlights von Artechock-Kritiker Rüdiger Suchsland. In der NZZ berichtet Urs Bühler vom Festival. David Steinitz untersucht für die SZ, wie sich 9/11 im Kino niedergeschlagen hat. Marion Löhndorf berichtet in der NZZ von den Auseinandersetzungen rund um die Golden Globes, die nicht divers genug aufgestellt seien. Susan Vahabzadeh schreibt in der SZ einen Nachruf auf die Schauspielerin Patricia Hitchcock. Josef Schnelle schreibt im Filmdienst einen Nachruf auf den Filmverleiher und -produzenten Hanns Eckelkamp.
Besprochen werden Michel Francos mexikanischer Thriller "New Order" (taz, Artechock, ZeitOnline, Standard), Emerald Fennells antisexistisches Drama "Promising Young Woman" (taz), Anne Zohra Berracheds "Die Welt wird eine andere sein" (Artechock), Everardo Valerio Gouts antirassistischer Horrorfilm "The Forever Purge" (FR), Sabine Herpichs Dokumentarfilm "Kunst kommt aus dem Schnabel wie er gewachsen ist" (Artechock, Tagesspiegel), Viggo Mortensens Regiedebüt "Falling" (SZ), Shawn Levys Komödie "Free Guy" mit Ryan Reynolds (FR, Tagesspiegel), Christoph Eders Dokumentarfilm "Wem gehört mein Dorf?" (taz) und der neue Animationsfilm mit Tom & Jerry (ZeitOnline, Welt).
Kunst

"Warum kaufen Menschen keine Kunst?", fragte sich der Berliner Galerist Johann König. Zu kompliziert, vielleicht, und zu undurchsichtig? Also gründete König die "Messe in St. Agnes", eine Kunstmesse, die teils in Galerien, teils im Internet stattfindet, berichtet Stefan Kobel bei monopol. "Der große Clou der aktuellen Ausgabe ist die Einbindung von Limna, der Preisfindungs-App von Artfacts.net. Aus der eigenen Ausstellungs-Datenbank und der Art Price Database von Artnet generiert sie eine Orientierungshilfe für Kaufinteressenten, die unter anderem oder vor allem eine Preisschätzung beinhaltet. Und die liegt oft genug nicht nur nahe am, sondern bisweilen sogar unter dem verlangten Betrag. König sieht das vor allem als Herausforderung und vertrauensbildende Maßnahme. Er wolle, dass seine Kunden sich ernstgenommen fühlen."
Weitere Artikel: Sebastian Moll stellt in der SZ den Künstler Otis Houston Jr. vor, der jahrzehnte lang am New Yorker FDR Drive seine besprühten Handtücher und Readymade-Installationen aus Sperrmüll anbot und jetzt auf der Frieze Art Fair gefeiert wurde und in einer großen New Yorker Galerie ausstellt: "Wie seine berühmt gewordenen Vorgänger [Basquiat und Haring], vielleicht gar ein wenig mehr noch, besitzt Houston die auf dem Kunstmarkt so rare und kostbare Qualität der Unverfälschtheit. Eine strategische Positionierung, eine bewusste Bezugnahme auf Zeitgenossen und Wegbereiter wäre Houston fremd."
Besprochen werden die Aausstellung "Hund und Katz - Wolf und Spatz: Tiere in der Rechtsgeschichte" im Mittelalterlichen Kriminalmuseum in Rothenburg ob der Tauber (taz) und die von Peter Fischli kuratierte Ausstellung "Stop Painting" in der Fondazione Prada in Venedig (Zeit).
Bühne
Der Berliner Galerist Pascual Jordan hatte sich für eins seiner Kiezkonzerte (die Reihe wurde entwickelt, um Dealer vom nahegelegenen Spielplatz zu vertreiben) ganz schön was vorgenommen, erzählt Niklaus Hablützel in der taz: Die Barockoper "Ormindo" von Francesco Cavalli, 1644 in Venedig uraufgeführt und danach nie wieder gespielt - bis zu dieser zweiten Uraufführung am Dienstag auf dem Bürgerplatz in Berlin-Schöneberg, die "von den ersten Takten bis zum Ende ein absolutes Meisterwerk" zu Gehör brachte, schwärmt Hablützel. "Ganz große Oper am Anfang ihrer Gattungsgeschichte. Monteverdi hatte Cavalli einst als Sänger an seinen Domchor in Venedig geholt. Was der danach selber schrieb, geht oft weit über das Vorbild seines Lehrers hinaus. Monteverdis 'Cantar parlando' ist bei Cavalli dynamischer geworden und schreckt auch vor harten Schnitten und extremen Affekten nicht zurück, unterstützt von den sparsam instrumentierten Harmonien des minimal besetzten Orchesters. ... Die Malerin Ingeborg zu Schleswig-Holstein hat dafür die Kostüme entworfen, weite Gewänder, mal strenggläubig, mal verführerisch für beide Geschlechter. Die Frauen rauchen und spielen Tennis, die Männer sind nur mit ihrer Macht beschäftigt. Alle zusammen aber singen sie mit großer selbstbewusster Kunst".
Bayreuth hatte in diesem Jahr eine große Saison, lobt Judith von Sternburg in der FR. Starke Inszenierungen, kreatives konzeptionelles Denken und der Mut von Katharina Wagner, Neues zu probieren, "ohne das Alte zu verraten" trugen alle dazu bei, meint sie. Und das krönende i-Tüpfelchen lieferte dann Christian Thielemann, der einen konzertant aufgeführten "Parsifal" dirigierte: "Er machte dabei das wie bei szenischen Aufführungen im Graben platzierte Bayreuther Festspielorchester sofort - also vom ersten Ton an, aber gewiss nach harter Arbeit - zu einem makellosen Klangkörper. Den Musikrausch vermittelte es zutiefst geschmackvoll, jedoch auch in der angemessenen Übergröße, die Instrumentengruppen auch im Einzelnen in Hochform. Mit den Klangverhältnissen im Saal findet sich Thielemann natürlich ausgezeichnet zurecht, lediglich der ausgelagerte Chor wirkte zum Teil zu massiert und derb."
Weiteres: Im Standard porträtiert Margarete Affenzeller die Schauspielerin Bibiana Beglau. In der FAZ stellt Boris Motzki die irische Dramatikerin Deirdre Kinahan vor. Und Wolfram Goertz besucht für die Zeit Barbara Frey, die neue Intendantin der Ruhrtriennale. Besprochen werden Jossi Wielers Inszenierung von Hofmannsthals Drama "Das Bergwerk zu Falun" bei den Salzburger Festspielen ("leider eher eine ergebene, etwas hilflose Verrenkung", befindet Peter Kümmel in der Zeit)
Bayreuth hatte in diesem Jahr eine große Saison, lobt Judith von Sternburg in der FR. Starke Inszenierungen, kreatives konzeptionelles Denken und der Mut von Katharina Wagner, Neues zu probieren, "ohne das Alte zu verraten" trugen alle dazu bei, meint sie. Und das krönende i-Tüpfelchen lieferte dann Christian Thielemann, der einen konzertant aufgeführten "Parsifal" dirigierte: "Er machte dabei das wie bei szenischen Aufführungen im Graben platzierte Bayreuther Festspielorchester sofort - also vom ersten Ton an, aber gewiss nach harter Arbeit - zu einem makellosen Klangkörper. Den Musikrausch vermittelte es zutiefst geschmackvoll, jedoch auch in der angemessenen Übergröße, die Instrumentengruppen auch im Einzelnen in Hochform. Mit den Klangverhältnissen im Saal findet sich Thielemann natürlich ausgezeichnet zurecht, lediglich der ausgelagerte Chor wirkte zum Teil zu massiert und derb."
Weiteres: Im Standard porträtiert Margarete Affenzeller die Schauspielerin Bibiana Beglau. In der FAZ stellt Boris Motzki die irische Dramatikerin Deirdre Kinahan vor. Und Wolfram Goertz besucht für die Zeit Barbara Frey, die neue Intendantin der Ruhrtriennale. Besprochen werden Jossi Wielers Inszenierung von Hofmannsthals Drama "Das Bergwerk zu Falun" bei den Salzburger Festspielen ("leider eher eine ergebene, etwas hilflose Verrenkung", befindet Peter Kümmel in der Zeit)
Design
Die Kunsthistorikerin Gabrielle Boller wirft für die NZZ einen Blick in die Geschichte der Arbeitsmode für Frauen. Vom feminin Zierlichen bis zur Textil gewordenen Kampfansage ist alles dabei. Mitunter "wandelten sich die Insignien weiblicher Garderobe vom Adretten zum Stählernen. ... Dass Damenhaftes durchaus furchteinflößend sein kann, zeigte beispielhaft Margaret Thatcher: Ihre Kostüme waren Festungen, ihre scharfkantigen Handtaschen gemahnten an Schlagwaffen, die sie auf bedrohliche Art vor sich hertrug - ganz in der Tradition der Queen, die in ihren schockfarbenen Outfits von giftigem Grün bis galligem Gelb keineswegs liebliche Weiblichkeit verbreitete."
 Sehr dankbar ist SZ-Kritikerin Tanja Rest der Ethnologin Giulia Mensitieri für deren Buch "Das schönste Gewerbe der Welt" zur Lage der Modebranche. Hinter dem Schleier von Glitz und Glamour gähnt der Abgrund des Prekären: Schneiderinnen, die tagelang an einem 30.000-Euro-Kleid nähen, und magere 800 Euro dafür erhalten, Models, die ihre überschaubaren Honorare bei der Agentur abgeben müssen, die sie vermittelt haben. Den Raubbau am eigenen Dasein betreiben die so Ausgebeuteten vor allem wegen eines Traums, schreibt Rest: Dieser "steht auf vier Säulen: Schönheit. Status. Macht. Kreativität. Das, was alle wollen, in der Logik des Systems aber nicht erreichen können, allem Kaufen und Buckeln zum Trotz. Erschaffen und am Leben erhalten wird der Traum durch die Produktion von Bildern, an denen die Modearbeiter genauso wie die Konsumenten hängen wie Komapatienten am Tropf. Es sind Bilder, die niemals objektiv sein dürfen, weil alle ja sonst schlagartig aufwachen müssten. Darum bekommen nur jene Magazine die kostbaren Kleider fürs Shooting, die sie auch glanzvoll inszenieren. Darum bekommen nur jene Journalisten Interviews und einen guten Platz am Laufsteg, die keine unbequemen Fragen stellen."
Sehr dankbar ist SZ-Kritikerin Tanja Rest der Ethnologin Giulia Mensitieri für deren Buch "Das schönste Gewerbe der Welt" zur Lage der Modebranche. Hinter dem Schleier von Glitz und Glamour gähnt der Abgrund des Prekären: Schneiderinnen, die tagelang an einem 30.000-Euro-Kleid nähen, und magere 800 Euro dafür erhalten, Models, die ihre überschaubaren Honorare bei der Agentur abgeben müssen, die sie vermittelt haben. Den Raubbau am eigenen Dasein betreiben die so Ausgebeuteten vor allem wegen eines Traums, schreibt Rest: Dieser "steht auf vier Säulen: Schönheit. Status. Macht. Kreativität. Das, was alle wollen, in der Logik des Systems aber nicht erreichen können, allem Kaufen und Buckeln zum Trotz. Erschaffen und am Leben erhalten wird der Traum durch die Produktion von Bildern, an denen die Modearbeiter genauso wie die Konsumenten hängen wie Komapatienten am Tropf. Es sind Bilder, die niemals objektiv sein dürfen, weil alle ja sonst schlagartig aufwachen müssten. Darum bekommen nur jene Magazine die kostbaren Kleider fürs Shooting, die sie auch glanzvoll inszenieren. Darum bekommen nur jene Journalisten Interviews und einen guten Platz am Laufsteg, die keine unbequemen Fragen stellen."
 Sehr dankbar ist SZ-Kritikerin Tanja Rest der Ethnologin Giulia Mensitieri für deren Buch "Das schönste Gewerbe der Welt" zur Lage der Modebranche. Hinter dem Schleier von Glitz und Glamour gähnt der Abgrund des Prekären: Schneiderinnen, die tagelang an einem 30.000-Euro-Kleid nähen, und magere 800 Euro dafür erhalten, Models, die ihre überschaubaren Honorare bei der Agentur abgeben müssen, die sie vermittelt haben. Den Raubbau am eigenen Dasein betreiben die so Ausgebeuteten vor allem wegen eines Traums, schreibt Rest: Dieser "steht auf vier Säulen: Schönheit. Status. Macht. Kreativität. Das, was alle wollen, in der Logik des Systems aber nicht erreichen können, allem Kaufen und Buckeln zum Trotz. Erschaffen und am Leben erhalten wird der Traum durch die Produktion von Bildern, an denen die Modearbeiter genauso wie die Konsumenten hängen wie Komapatienten am Tropf. Es sind Bilder, die niemals objektiv sein dürfen, weil alle ja sonst schlagartig aufwachen müssten. Darum bekommen nur jene Magazine die kostbaren Kleider fürs Shooting, die sie auch glanzvoll inszenieren. Darum bekommen nur jene Journalisten Interviews und einen guten Platz am Laufsteg, die keine unbequemen Fragen stellen."
Sehr dankbar ist SZ-Kritikerin Tanja Rest der Ethnologin Giulia Mensitieri für deren Buch "Das schönste Gewerbe der Welt" zur Lage der Modebranche. Hinter dem Schleier von Glitz und Glamour gähnt der Abgrund des Prekären: Schneiderinnen, die tagelang an einem 30.000-Euro-Kleid nähen, und magere 800 Euro dafür erhalten, Models, die ihre überschaubaren Honorare bei der Agentur abgeben müssen, die sie vermittelt haben. Den Raubbau am eigenen Dasein betreiben die so Ausgebeuteten vor allem wegen eines Traums, schreibt Rest: Dieser "steht auf vier Säulen: Schönheit. Status. Macht. Kreativität. Das, was alle wollen, in der Logik des Systems aber nicht erreichen können, allem Kaufen und Buckeln zum Trotz. Erschaffen und am Leben erhalten wird der Traum durch die Produktion von Bildern, an denen die Modearbeiter genauso wie die Konsumenten hängen wie Komapatienten am Tropf. Es sind Bilder, die niemals objektiv sein dürfen, weil alle ja sonst schlagartig aufwachen müssten. Darum bekommen nur jene Magazine die kostbaren Kleider fürs Shooting, die sie auch glanzvoll inszenieren. Darum bekommen nur jene Journalisten Interviews und einen guten Platz am Laufsteg, die keine unbequemen Fragen stellen."Literatur
Nicht etwa Didier Eribon kommt das Verdienst zu, unsere Gegenwart so genau beschrieben zu haben wie einst Dickens oder Dostojewski die ihre, sondern Michel Houellebecq, ist der Ideenhistoriker Christian Marty in der NZZ überzeugt. Im Werk des Schriftstellers wimmle es nur so von soziologischen Abhandlungen zur Gegenwart und Überlegungen zur Freiheit. Politischen Lagern jeglicher Coleur bleibe er dabei fern: "Mit dieser Distanz gegenüber dem Einsatz für politische Veränderungen, die man vielleicht als 'stoisch' bezeichnen könnte, reiht sich Houellebecq in eine lange europäische Tradition ein: Statt den spirituellen Auszug aus der entzauberten Welt anzutreten, verharrt man in metaphysischer Obdachlosigkeit. Denn diese Obdachlosigkeit ist auch für Houellebecq, als Soziologe und als Künstler, die unabdingbare Grundvoraussetzung, um sich die intellektuelle Redlichkeit zu bewahren."
Weitere Artikel: Nicolas Freund befasst sich in der SZ damit, wie die Literatur auf 9/11 reagiert hat. In der Dante-Reihe der FAZ fragt sich Berit Miriam Glanz, warum die Hölle in der "Commedia" eigentlich immer kälter wird, je tiefer man in sie vordringt.
Besprochen werden unter anderem David Peace' Krimi "Tokio, neue Stadt" (Tagesspiegel), Ferdinand Schmalz' "Mein Lieblingstier heißt Winter" (Tagesspiegel), Stephen Kings "Billy Summers" (SZ, Tagesspiegel), Antje Rávik Strubels "Blaue Frau" (SZ), Oswald Eggers "Entweder ich habe die Fahrt am Mississippi nur geträumt, oder ich träume jetzt" (NZZ), Anja Hirschs "Was von Dora blieb" (online nachgereicht von der FAZ) und Louise Erdrichs "Der Nachtwächter" (FAZ).
Weitere Artikel: Nicolas Freund befasst sich in der SZ damit, wie die Literatur auf 9/11 reagiert hat. In der Dante-Reihe der FAZ fragt sich Berit Miriam Glanz, warum die Hölle in der "Commedia" eigentlich immer kälter wird, je tiefer man in sie vordringt.
Besprochen werden unter anderem David Peace' Krimi "Tokio, neue Stadt" (Tagesspiegel), Ferdinand Schmalz' "Mein Lieblingstier heißt Winter" (Tagesspiegel), Stephen Kings "Billy Summers" (SZ, Tagesspiegel), Antje Rávik Strubels "Blaue Frau" (SZ), Oswald Eggers "Entweder ich habe die Fahrt am Mississippi nur geträumt, oder ich träume jetzt" (NZZ), Anja Hirschs "Was von Dora blieb" (online nachgereicht von der FAZ) und Louise Erdrichs "Der Nachtwächter" (FAZ).
Musik
Andrian Kreye hält für die SZ Rückschau darauf, wie der Pop auf 9/11 reagiert hat: Vor allem Bruce Springsteen und der Hip-Hop brachten hier die "Überzeugung, dass nichts und niemand New York in die Knie zwingen wird" auf den Punkt. Im FR-Gespräch schwärmt Theo Plath vom Fagott. Peter Maffay schreibt in der SZ einen Nachruf auf seinen Manager Roland "Balou" Temme. Max Nyffeler schwärmt in der FAZ von einem Youtube-Projekt der in Sachen Alte Musik hervorragend ausgebildeten Sängerin Hanna Marti, die gemeinsam mit der ebenfalls entsprechend ausgebildeten Musikerin Stef Conner englische Rätseltexte aus dem Mittelalter einsingt.
Besprochen werden die Neueinspielung von Eric Claptons Album "Layla" durch die Tedeschi Trucks Band mit Trey Anastasio (FAZ) und das neue Album der Liars (Standard).
Besprochen werden die Neueinspielung von Eric Claptons Album "Layla" durch die Tedeschi Trucks Band mit Trey Anastasio (FAZ) und das neue Album der Liars (Standard).
Kommentieren