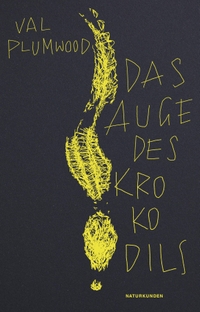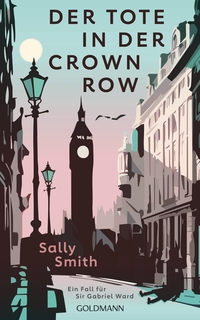Efeu - Die Kulturrundschau
Szenische Urzeit
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
23.04.2016. 400 Jahre Shakespeare und Cervantes: Die Feuilletons würdigen mit großem Aufwand die verstorbenen Größen. Kann, soll, muss man sie heute noch lesen? Die eigene Begabung wird nicht größer, wenn man sie nicht liest, ermuntert Autor Javier Marias seine Kollegen. Man lernt eine Menge, sekundiert Antonia S. Byatt. Katharsis erlebt man aber nur beim Shakespearelesen daheim, warnt Botho Strauß. Außerdem: In der NZZ denkt Architekturtheoretiker André Bideau über postmodernen Inselurbanismus nach. Der Freitag wippt mit zugehaltenen Ohren zum Trümmer-Pop.
9punkt - Die Debattenrundschau
vom
23.04.2016
finden Sie hier
Literatur
400 Jahre Shakespeare, 400 Jahre Cervantes - kann, soll, muss man das noch lesen? Größen wie diese können heute noch inspirieren, versichert Javier Marias in der NZZ. Schade, dass es so wenige Künstler zulassen: "Jeder heutige Künstler ist gezwungen, die Bewunderung für seine lebenden Kollegen zu unterdrücken - oder wenigstens Stillschweigen darüber zu breiten -, vor allem, wenn es Landsleute sind oder sie sich, im Fall der schreibenden Zunft, in der gleichen Sprache wie er ausdrücken. Doch um uns über Wasser zu halten, gehen wir bereits so weit, die Toten in Misskredit zu bringen - sie sind uns lästig, stellen uns in den Schatten, heben unsere Unzulänglichkeiten und unser Mittelmaß hervor -, oder wir weichen ihnen aus, indem wir sie schlichtweg ignorieren. Literaten, die behaupten, sie hätten kaum etwas gelesen und würden sich allein auf Kino, Fernsehen, Comics und Videogames beziehen, sind heute keine Seltenheit. Die eventuelle eigene Begabung fühlt sich nicht bedroht, solange ausgeklammert wird, was andere mit der ihren zustande brachten."
Berührungsprobleme dieser Art hat Antonia S. Byatt in der NZZ nicht. Sie liebt ihren Don Quijote wie vor ihr Dickens, Dostojewski oder Balzac: "'Don Quijote' zählt zu den Büchern, in denen der Leser auf gewisse Weise auch als Autor fungiert. Der Ritter von der traurigen Gestalt erzählt eine Geschichte, die manchmal parallel zur 'Wahrheit' des Romans verläuft und manchmal auf katastrophale - und dabei ebenso lustige wie erschreckende - Art von dieser abweicht. Der Verfasser gestaltet die Geschehnisse gewissermassen en passant, scheint sie im Gehen erst zu entdecken. Der Leser begleitet den Erzähler, weil der eine Welt erfindet, die sich als interessanter, komplizierter, aufregender erweist, als man es zu Beginn der Geschichte erwartet. Dem Entstehen dieser neuen Realität beizuwohnen, ist ein intensives Vergnügen - für begierige Leser ebenso wie für jemanden, der selber lernen will, wie man Welten erfindet und Bücher schreibt."
In der taz zeichnet Eberhard Geisler den spanischen Nationaldichters als melancholischen Zeugen eines Epochenwandels: "Cervantes - und das wurde vielleicht erst viel später deutlich - zeigt auf, dass der alte Glaube, die alte Metaphysik einen Riss erhalten hat. Er registriert die neue, säkular gewordene Zeit, setzt ihr gleichwohl doch auch Wehmut entgegen. Es schmerzt, dass die nüchterne Wirklichkeit dabei ist, die Ideen des Guten und Wahren zu verdrängen." Im Standard schreibt Erich Hackl.
Außerdem: Die taz bringt Dirk Knipphals' dritten Teil seiner fortlaufenden Lektürenotizen zu Maxim Billers "Biografie": Am Ende des ersten Drittels dämmert es ihm, "wie durchgeknallt das ist." In seinem zum Antritt als Mainzer Stadtschreiber verfassten, von der FAZ dokumentierten Text schreibt Clemens Meyer assoziativ über die Geheimnisse der Bahnhöfe von Leipzig und Mainz, dem verfallenden alten Westen und nicht zuletzt über Karl May.
Besprochen werden u.a. Bernd Caillouxs "Surabaya Gold - Haschischgeschichten" (taz), Sascha Hommers Comic "In China" (taz), eine Reihe von Romanen, die Shakespeare-Stoffe aufgreifen (FAZ), Elsemarie Maletzkes Biografie der irischen Revolutionärin Maud Gonne (Welt) und Katharina Winklers "Blauschmuck" (FAZ).
Berührungsprobleme dieser Art hat Antonia S. Byatt in der NZZ nicht. Sie liebt ihren Don Quijote wie vor ihr Dickens, Dostojewski oder Balzac: "'Don Quijote' zählt zu den Büchern, in denen der Leser auf gewisse Weise auch als Autor fungiert. Der Ritter von der traurigen Gestalt erzählt eine Geschichte, die manchmal parallel zur 'Wahrheit' des Romans verläuft und manchmal auf katastrophale - und dabei ebenso lustige wie erschreckende - Art von dieser abweicht. Der Verfasser gestaltet die Geschehnisse gewissermassen en passant, scheint sie im Gehen erst zu entdecken. Der Leser begleitet den Erzähler, weil der eine Welt erfindet, die sich als interessanter, komplizierter, aufregender erweist, als man es zu Beginn der Geschichte erwartet. Dem Entstehen dieser neuen Realität beizuwohnen, ist ein intensives Vergnügen - für begierige Leser ebenso wie für jemanden, der selber lernen will, wie man Welten erfindet und Bücher schreibt."
In der taz zeichnet Eberhard Geisler den spanischen Nationaldichters als melancholischen Zeugen eines Epochenwandels: "Cervantes - und das wurde vielleicht erst viel später deutlich - zeigt auf, dass der alte Glaube, die alte Metaphysik einen Riss erhalten hat. Er registriert die neue, säkular gewordene Zeit, setzt ihr gleichwohl doch auch Wehmut entgegen. Es schmerzt, dass die nüchterne Wirklichkeit dabei ist, die Ideen des Guten und Wahren zu verdrängen." Im Standard schreibt Erich Hackl.
Außerdem: Die taz bringt Dirk Knipphals' dritten Teil seiner fortlaufenden Lektürenotizen zu Maxim Billers "Biografie": Am Ende des ersten Drittels dämmert es ihm, "wie durchgeknallt das ist." In seinem zum Antritt als Mainzer Stadtschreiber verfassten, von der FAZ dokumentierten Text schreibt Clemens Meyer assoziativ über die Geheimnisse der Bahnhöfe von Leipzig und Mainz, dem verfallenden alten Westen und nicht zuletzt über Karl May.
Besprochen werden u.a. Bernd Caillouxs "Surabaya Gold - Haschischgeschichten" (taz), Sascha Hommers Comic "In China" (taz), eine Reihe von Romanen, die Shakespeare-Stoffe aufgreifen (FAZ), Elsemarie Maletzkes Biografie der irischen Revolutionärin Maud Gonne (Welt) und Katharina Winklers "Blauschmuck" (FAZ).
Bühne
Im Theater sollte man Shakespeare gar nicht erst aufsuchen, donnert Botho Strauß in der FAZ, denn "dort unten toben die Wichtel, die zu sich hinab verkleinern, wohin sie nicht aufschauen können. Auch wenn es blasphemisch klingt, doch einzig im Werk Shakespeares ist man einer Religion des Menschlichen nahe, vor der man zu knien hat, statt zu strampeln. Von Rechts wegen müsste auf dem Theater immer szenische Urzeit herrschen, niemals Fortschrittszeit und Gegenwart. Für das Erlebnis der Überwältigung wird ein théâtre imaginaire, wird nur noch die inszenierende Lektüre gut sein. Katharsis daheim." Außerdem: Zum 400. Todestag Shakespeares hat die SZ zahlreiche Kulturschaffende über ihr Verhältnis zu dem britischen Dramatiker befragt.
Alexander von Zemlinskys rare Oper "Der Traumgörge" wird in Hannover von Johannes von Matuschka gelungen auf die Bühne gebracht, findet Volker Hagedorn in der Zeit: Der Regisseur "und sein Team realisieren das dreiaktige Märchenwerk nämlich so freudianisch, wie es von Zemlinsky und seinem Librettisten angelegt wurde. Aber nicht, indem sie das Personal rund um Sigmunds berühmte Couch in der Berggasse platzieren oder per Video Kastrationsängste im Publikum schüren (wie das zuletzt im heiß umstrittenen hannoverschen Freischütz geschah). Sie nehmen vielmehr einen Text beim Wort, der so jugendstilig verstiegen wie anspielungsreich ist und in jeder Zusammenfassung zwangsläufig idiotisch wirken muss."
Weiteres: Auf ZeitOnline verurteilt die Schriftstellerin Julya Rabinowich den rechtsextremen Überfall auf eine Aufführung von Elfriede Jelineks "Die Schutzbefohlenen" in Wien.
Besprochen werden Akram Khans Choreografie "Until the Lions" in Wolfsburg ("Khan lädt jede Geste, jede Berührung auf in feinziselierter Gespanntheit", staunt Sylvia Staude in der FR) und Romeo Castelluccis musikdramatische Ausstellung der "Matthäuspassion" in den Hamburger Deichtorhallen ("ein vergleichsweise zahmes dreistündiges Paradoxon", meint Elmar Krekeler in der Welt, "ein Abend zwischen Lächerlichkeit und Langeweile", urteilt Jan Brachmann in der FAZ).
Alexander von Zemlinskys rare Oper "Der Traumgörge" wird in Hannover von Johannes von Matuschka gelungen auf die Bühne gebracht, findet Volker Hagedorn in der Zeit: Der Regisseur "und sein Team realisieren das dreiaktige Märchenwerk nämlich so freudianisch, wie es von Zemlinsky und seinem Librettisten angelegt wurde. Aber nicht, indem sie das Personal rund um Sigmunds berühmte Couch in der Berggasse platzieren oder per Video Kastrationsängste im Publikum schüren (wie das zuletzt im heiß umstrittenen hannoverschen Freischütz geschah). Sie nehmen vielmehr einen Text beim Wort, der so jugendstilig verstiegen wie anspielungsreich ist und in jeder Zusammenfassung zwangsläufig idiotisch wirken muss."
Weiteres: Auf ZeitOnline verurteilt die Schriftstellerin Julya Rabinowich den rechtsextremen Überfall auf eine Aufführung von Elfriede Jelineks "Die Schutzbefohlenen" in Wien.
Besprochen werden Akram Khans Choreografie "Until the Lions" in Wolfsburg ("Khan lädt jede Geste, jede Berührung auf in feinziselierter Gespanntheit", staunt Sylvia Staude in der FR) und Romeo Castelluccis musikdramatische Ausstellung der "Matthäuspassion" in den Hamburger Deichtorhallen ("ein vergleichsweise zahmes dreistündiges Paradoxon", meint Elmar Krekeler in der Welt, "ein Abend zwischen Lächerlichkeit und Langeweile", urteilt Jan Brachmann in der FAZ).
Musik
Ihr Debüt brachte der Band "Trümmer" das Etikett "Diskurspunk" ein, nun ist das zweite Album "Interzone" da, bei dem Konstantin Nowotny vom Freitag allerdings zwar gerne mitwippt, doch lieber weghört bei "Zeilen wie: 'Wir sind Dandys im Nebel, keiner weiß was wir tun, wir sind Dandys im Nebel, wir haben den Swag im Blut.' Die Hamburger Schule, mit der 'Trümmer' oft in Verbindung gebracht werden, hatte oft diese Auswüchse voller popkultureller Selbstironie, voller Zitate der Einfachheit, hinter denen sich eine kritische Metaebene verbarg. Genau diese Ebene vermisst der Hörer auf Interzone schmerzlich. Es drängt sich der schaurige Gedanke auf, dass Textzeilen wie diese einfach ernst gemeint sind."
Immer noch große Trauer um Prince (mehr im gestrigen Efeu): Pophistoriker Simon Reynolds erkundet für Pitchfork, wie Prince unser Denken über Musik und Gender geändert hat. Simon Price führt auf The Quietus durch das Schaffen des Künstlers. Im New York Magazine würdigt Lily Burana den Verstorbenen als Säulenheiligen der Stripper und Poledancer, während Ashley Weatherford dem politischen Gehalt von Prince' Haar nachgeht.
"Transgressiver konnte Pop einfach nicht sein", stellt Maurice Summen von der taz fest. "Seine Musik [ist] immer noch unabgegolten, unerreichbar deponiert in höheren Pop-Schubladen als die allermeiste andere, die wir so hören", schwärmt Edo Reents in der FAZ. In der SZ erinnert sich Jens-Christian Rabe wehmütig an die MTV-90er, als ihm Prince erstmals begegnete.
Lemmy, Bowie, Prince - "erleben wir gerade eine Heldendämmerung des Pop", fragt ein beklommener Julian Dörr in der SZ. Auch Kai Müller vom Tagesspiegel wird angesichts dieser zumindest gefühlten Ballung sehr grundsätzlich in seinem Nachruf: "Warum denkt man bei der Nachricht seines Todes oder der von Bowies Tod, dass es einen wie ihn nicht wieder geben kann? Weil in der Popularität, die sie verkörperten, Kunst, Glanz und Reichtum zusammenkamen. Sie agierten im Bann von Traditionslinien, die sie zum Wohl der Popkultur insgesamt aufbrachen und modernisierten. Das ist Musikern heute nicht mehr möglich. ... Die Popmusik ist in Puzzlestücke zerfallen, die zwar immer wieder neu und aufregend zusammengesetzt werden, aber durch wen, ist eigentlich egal, weil jeder auf alles zugreifen kann."
Besprochen werden eine große Yehudi-Menuhin-Ausgabe (Zeit, mehr im gestrigen Efeu), Xiu Xius Neueinspielung des Twin-Peaks-Soundtrack (The Quietus, hier einige Eindrücke vom Berliner Konzert vor einer Woche), eine Kollaboration zwischen Konono No.1 und Batida (Pitchfork), das Abschlusskonzert des Intonation-Festivals in Berlin mit Daniel Barenboim und Martha Argerich (Tagesspiegel), ein Konzert der Berliner Philharmoniker unter Tugan Sokhiev (Tagesspiegel) und ein Konzert des deutschen Filmmusikkomponisten Hans Zimmer (Tagesspiegel).
Immer noch große Trauer um Prince (mehr im gestrigen Efeu): Pophistoriker Simon Reynolds erkundet für Pitchfork, wie Prince unser Denken über Musik und Gender geändert hat. Simon Price führt auf The Quietus durch das Schaffen des Künstlers. Im New York Magazine würdigt Lily Burana den Verstorbenen als Säulenheiligen der Stripper und Poledancer, während Ashley Weatherford dem politischen Gehalt von Prince' Haar nachgeht.
"Transgressiver konnte Pop einfach nicht sein", stellt Maurice Summen von der taz fest. "Seine Musik [ist] immer noch unabgegolten, unerreichbar deponiert in höheren Pop-Schubladen als die allermeiste andere, die wir so hören", schwärmt Edo Reents in der FAZ. In der SZ erinnert sich Jens-Christian Rabe wehmütig an die MTV-90er, als ihm Prince erstmals begegnete.
Lemmy, Bowie, Prince - "erleben wir gerade eine Heldendämmerung des Pop", fragt ein beklommener Julian Dörr in der SZ. Auch Kai Müller vom Tagesspiegel wird angesichts dieser zumindest gefühlten Ballung sehr grundsätzlich in seinem Nachruf: "Warum denkt man bei der Nachricht seines Todes oder der von Bowies Tod, dass es einen wie ihn nicht wieder geben kann? Weil in der Popularität, die sie verkörperten, Kunst, Glanz und Reichtum zusammenkamen. Sie agierten im Bann von Traditionslinien, die sie zum Wohl der Popkultur insgesamt aufbrachen und modernisierten. Das ist Musikern heute nicht mehr möglich. ... Die Popmusik ist in Puzzlestücke zerfallen, die zwar immer wieder neu und aufregend zusammengesetzt werden, aber durch wen, ist eigentlich egal, weil jeder auf alles zugreifen kann."
Besprochen werden eine große Yehudi-Menuhin-Ausgabe (Zeit, mehr im gestrigen Efeu), Xiu Xius Neueinspielung des Twin-Peaks-Soundtrack (The Quietus, hier einige Eindrücke vom Berliner Konzert vor einer Woche), eine Kollaboration zwischen Konono No.1 und Batida (Pitchfork), das Abschlusskonzert des Intonation-Festivals in Berlin mit Daniel Barenboim und Martha Argerich (Tagesspiegel), ein Konzert der Berliner Philharmoniker unter Tugan Sokhiev (Tagesspiegel) und ein Konzert des deutschen Filmmusikkomponisten Hans Zimmer (Tagesspiegel).
Film
Auch Georg Seeßlen ist in der Zeit hin und weg von Athina Rachel Tsangaris Groteske "Chevalier", in der Männer auf einer Jacht im Wettbewerb den Besten unter sich ermitteln: "Einer der komischsten Effekte von Chevalier besteht darin, dass die Beteiligten ihr Spiel mit einer unerschütterlichen Buster-Keaton-Ernsthaftigkeit durchziehen. Das sind Männer, die niemals lachen, schon gar nicht über sich selbst. Eine ähnliche Haltung mutet die Regisseurin allerdings auch uns Zuschauerinnen und Zuschauern zu. Das alles ist wirklich ungeheuer komisch. Aber ein 'befreiendes Lachen' gibt es so wenig wie einen Menschen, dem wir das heile Davonkommen wünschen könnten." Unsere Kritik hier.
Daniel Kothenschulte schreibt in der FR zum Tod des Bond-Regisseurs Guy Hamilton.
Daniel Kothenschulte schreibt in der FR zum Tod des Bond-Regisseurs Guy Hamilton.
Architektur
Kann man Urbanität inszenieren? Architekten des Neuen Bauenes versuchten es in der Weimarer Republik mit Wohnsiedlungen wie Stuttgart-Weißenhof, Architekten unter Thatcher mit Canary Wharf, Berlusconi mit der abgeschotteten Wohnsiedlung Milano Due. Der postmoderne Inselurbanismus, angetrieben von der zunehmenden Privatisierung der Stadtentwicklung, ist kaum aufzuhalten, meint der französische Architekturtheoretiker André Bideau in der NZZ. Als jüngstes Beispiel beschreibt er Vittorio Magnago Lampugnanis Basler Novartis-Campus, auf dem die internationalen Mitarbeiter ein "Zuhause auf Zeit" finden sollen: "Lampugnani und der damalige CEO Daniel Vasella orchestrierten eine Leistungsschau mit handverlesenen Architekten, von denen ein Bekenntnis zur 'europäischen Stadt' verlangt wurde: Arkaden, einheitliche Baufluchten und Traufhöhen urbanisieren das Werkgelände, freilich ohne dieses für die Öffentlichkeit begehbar zu machen. Die Realität der umliegenden Stadt ist aus diesem Binnenraum vollkommen ausgeblendet, was außer mit betrieblichen und sicherheitstechnischen Aspekten mit dem Wunsch nach einer unverwechselbaren Identität zusammenhängt. Die kontrollierte Urbanität ist so synthetisch wie die auf dem Gelände entwickelten Pharmaprodukte."
Besprochen wird eine Monografie der Architekturhistorikerin Elain Harwood über den englischen Brutalismus (NZZ).
Besprochen wird eine Monografie der Architekturhistorikerin Elain Harwood über den englischen Brutalismus (NZZ).
Kommentieren