
31.03.2022 Die FAZ staunt, wie kenntnisreich Marente de Moor die Lebensgewohnheiten in der russischen Provinz vor dem Hintergrund der zerfallenden Sowjetunion schildert. Mitreißen lässt sie sich auch von Wucht und Drastik in Oskar Loerkes "Oger". Die SZ birgt einen Schatz der postkolonialen Literatur mit Jacques Stephan Alexis' Romanfragment "Der Stern Wermut". Die Zeit behauptet sich mit den Oxforder Philosophinnen Elizabeth Anscombe, Iris Murdoch, Philippa Foot und Mary Midgley in der von Männern dominierten akademischen Welt der Fünfziger. Dlf lässt sich von Gerbrand Bakker im "Niemandsland" der Depression trösten.
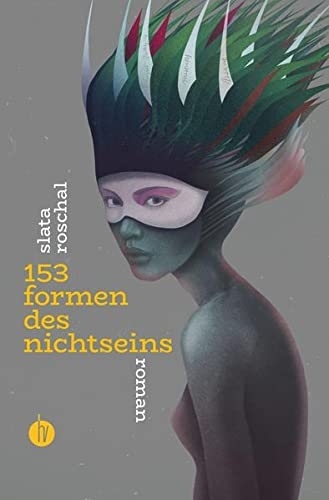
30.03.2022 Die FAZ blickt mit Slata Roschal auf "153 Formen des Nichtseins" im Leben einer jüdischen Russlanddeutschen und entdeckt den Dostojewski der Gegenwart. Von Fatma Aydemirs grandiosem Roman "Dschinns" lässt sie sich gern mit Judith Butler traktieren. Die FR empfiehlt die Neufassung der Litten-Biografie von Knut Bergbauer, Sabine Fröhlich und Stefanie Schüler-Springorum. Dlf Kultur amüsiert sich prächtig mit Fran Lebowitz' Kolumnen über Rauchen, Reisen, Fitness und Friseurbesuche. Und der Dlf sieht staunend zu, wenn Tanguy Viel in der bretonischen Provinz "emotionale Sprengsätze" zündet.

29.03.2022 Die FAZ feiert Monica Alis Roman "Liebesheirat", der sie mit Witz, Empathie und Weltkenntnis besticht. Von György Dalos lernt sie das System Orbán zu durchschauen, und auch Eberhard Seidels türkisch-deutsche Kulturgeschichte des "Döner" weiß sie zu goutieren. Die taz lässt sich von Gregor Ritschel zu weniger Arbeit animieren. Der Dlf huldigt mit Norbert Hummelts "1922" der literarischen Moderne. Und der DlfKultur empfiehlt nachdrücklich Lucy Delaps globale Geschichte des Feminismus.

28.03.2022 Die FAZ erhascht mit Beatrice Alemagna den "kleinen großen Augenblick", in dem sich das flüchtige Glück zeigt. Mit Kenji Miyazawa reist sie intergalaktisch für eine Nacht in der Milchstraßenbahn. Die FR folgt den Sehnsuchtslinien von Judith Zanders plattdeutscher Minnelyrik "im ländchen sommer im winter zur see". Die SZ wappnet sich mti aktuellen Neuerscheinungen für Zeitenbruch, Future War und die neue Weltordnung.

26.03.2022 Hellauf begeistert ist die FAZ von Alain Damasios dystopischen Aktivistenroman "Die Flüchtigen". Empfehlen kann sie auch Olivette Oteles Geschichte "Afrikanische Europäer". Die FR lässts ich mitreißen von der Wucht, mit der Nino Haratischwili vom postsowjetischen Kriegsgrauen in Georgien erzählt. Sehr prägnant findet die taz Shulamit Volkovs Buch "Deutschland aus jüdischer Sicht", dem höchstens ein Kapitel über die DDR fehlt. Unanständig gute Laune macht ihr außerdem Mareike Fallwickls Roman "Die Wut, die bleibt" über weibliche Selbstaufopferung.

25.03.2022 Die FAZ betrachtet mit dem Kunsthistoriker Peter Geimer die „Farben der Vergangenheit“ und lernt, dass das bessere Bild nicht unbedingt bessere Sicht und Verständnis bedeutet. Die FR kann sich dem Sog nicht entziehen, wenn Laszlo Krasznahorkai in der Provinz Köpfe rollen lässt. Der Dlf ficht mit Martin Walser im Traum manchen Kampf aus. Dlf Kultur schwingt sich mit Hannah Ross aufs Rad und reist durch die Geschichte weiblicher Selbstermächtigung. Und die SZ empfiehlt Sachbücher für Kinder und Jugendliche: Unter anderem erfährt sie, wie viel Regenwald in Nuss-Nougat-Creme steckt.

24.03.2022 Die FAZ empfiehlt die Erzählungen Ljudmila Ulitzkajas, die auf unnachahmliche Weise vermitteln, inwieweit Literatur die Angst vor dem Sterben nehmen kann. Die SZ begibt sich mit Stewart O'Nan in ein Kaff in Connecticut und wird Zeuge einer tödlich endenden Dreiecksgeschichte. Außerdem erhält sie mit Viktor Schlowskis "Briefe nicht über Liebe" ungeahnte Einblicke ins Berlin der zwanziger Jahre. Dlf Kultur begibt sich mit Lucy Frickes "Diplomatin" an den Rand der Legalität.

23.03.2022 Die FAZ erlebt mit Ulinka Rublack "Die Geburt der Mode" in der Renaissance, und sie schärft ihr Gespür für die Grenze zwischen Fakt und Fiktion mit Clemens J. Setz' "Gedankenspielen über die Wahrheit". Die FR sucht mit Riku Onda die Wahrheit hinter den "Aosawa-Morden". Die NZZ lernt von Jan Friedrich Kallmorgen und Katrin Suder "Das geopolitische Risiko" besser einzuschätzen.

22.03.2022 Hellauf begeistert ist die taz von Adam Greens wilden Comic "Krieg und Paradies", bei dem es aller Fülle zum Trotz einfach nichts zu lernen gibt. Ziemlich umgehauen ist die FAZ von Witz, Energie und Verzweiflung in Gine Cornelia Pedersens Roman "Null". Von Bernd Kasparek lernt sie, wie Europa seine Außengrenze zu einem Ort des Wissens und der Kontrolle machte. Der Dlf folgt fasziniert dem Insektenforscher Dave Goulson in die Welt der Asseln, Ameisen und Wespen..

21.03.2022 Die SZ feit sich mit Claus Leggewie und Ireneusz Paweł Karolewski gegen eine Unterschätzung der Visegrad-Staaten - im Guten wie im Schlechten. Die NZZ verabschiedet sich mit Siegfried Kohlhammers "Piraten" vom Seeräuber als Sozialrebellen. Der DlfKultur lernt von Theodor Herzl, Fehler in Größe zuverwandeln. Außerdem vertieft er sich in die Geschichte der Oxforder Philosophinnen. Die FAZ empfiehlt Hörbücher, darunter die Lesungen von E.T.A. Hoffmanns Erzählwerken und den Live-Mitschnitt des Lyrikabends "Vom Zauber einer verwehenden Sprache"
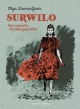
19.03.2022 Die FAZ blättert durch zwei Bücher über Alpenkulinarik - wie gebackenen Dorsch, Nockerln und Krapfen - und Alpenhonig - wie Bastardindigo-, Esparsetten-, Feldthymian- oder Baumheidehonig. Die FR lässt sich von Tove Ditlevsens "Gesichter" langsam in den Wahnsinn führen. Die SZ stärkt mit Emmanuel Levinas' "Ethik als Erste Philosophie" ihren Glauben an das Zwischenmenschliche. Die taz liest drei Comicbände zum stalinistischen Terror in Russland und der Ukraine.

18.03.2022 Die FAZ erhält von dem Alttestamentler Reinhard G. Kratz neue Erkenntnisse über die Schriftrollen von Qumran und Jesus. Dem Historiker Daniel Siemens verdankt sie ein differenziertes Bild von Hermann Budzislawski. Die FR erfährt von Nora Bossong, wie geschmeidige Vierzigjährige künftig die Welt regieren. Mit Yannic Han Biao Federer begibt sie sich auf Identitätssuche nach Hongkong. Und Dlf Kultur lernt von Dave Goulson, weshalb es höchste Zeit ist, die Insekten zu retten.

17.03.2022 Dlf Kultur sehnt sich mit Paul Bowles' Stück "Der Garten" nach einem untergegangenen Marokko. Die NZZ schaudert es mit Seweryna Szmaglewska angesichts der zersetzenden Normalität des Alltags, die den Nürnberger Prozess 1946 begleitet. Großes Lob gibt es für Katerina Poladjans Roman "Zukunftsmusik" aus einer Zeit, als Russland noch Zukunft zu haben schien. Die FAZ verneigt sich vor der großen kommentierten Frankfurter Ausgabe des Werks von Thomas Mann bei Fischer. Die SZ feiert Abdulrazak Gurnahs Roman "Ferne Gestade": Weltliteratur, ruft Sigrid Löffler.

16.03.2022 Die FAZ blickt mit der israelischen Historikerin Shulamit Volkov auf Leerstellen deutsch-jüdischer Geschichte und macht es sich mit Jan Herres im Berliner Zimmer bequem. Meisterhaft findet die SZ Reinhard Kaiser-Mühleckers neuen Roman "Wilderer" über den Niedergang eines Bauernhofs. Mit Albert Ostermaiers dunklen Gedichten schöpft sie trotzdem Hoffnung. Und Dlf Kultur staunt, wie subtil und einfühlsam Ron Segal in Katzenmusik das Leben in Israel nach dem Sechstagekrieg schildert.

15.03.2022 Die SZ verbringt eine Nacht mit Leila Slimani im venezianischen Punta della Dogana und denkt über Rauchverbot und Frauenrechte nach. Die FAZ lässt sich mitreißen, wenn Heike Geißler das Bewusstsein einer Frau die vierzig wie einen Quecksilbertropfen zerspringen lässt. Von dem Rechtswissenschaftler Markus Scheiber erfährt sie, unter welchen Bedingungen Fake News strafbar sein sollten. Die taz räumt mit Dietmar Dath betrunken zwischen Lady Gaga, Jeff Bezos und Frank Schirrmacher auf. Und Dlf Kultur staunt nach der Lektüre von Sascha Machts „Spyderling“, dass ihn ein Roman um Brettspiele und ihre Anhänger gefangen nimmt.

14.03.2022 Die SZ blickt mit der Moskau-Kennerin Catherine Belton noch einmal in die Verflechtung westlicher Politik und Geschäftemacher mit dem System Putin. taz und Dlf Kultur sind sich nicht einig über Heike Geißlers Roman „Die Woche“: Ein mit der Gegenwart abrechnendes Manifest liest die taz, eine wenig originelle Performance erlebt Dlf Kultur. Die FR zieht sich mit einem Kongressband und einigen Aussteigern auf den Monte Veritá zurück. Und die Welt trifft sich mit Eberhard Geisler auf einen Döner und verortet sich selbst in einem „Stück türkisch-deutscher Geschichte“.

12.03.2022 FAZ, SZ und taz annoncieren zum Hundertsten von Jack Kerouac zwei glänzende Neuübersetzungen: In „Die Dharmajäger“ streben sie in meditative Höhen, mit dem „Engel der Trübsal“ kommen sie nicht ganz nüchtern wieder unten an. Außerdem versucht die taz mit Stanislaw Assejews Texten aus dem Donbass Russlands Angriff auf die Ukraine zu verstehen. Die FAS spürt den Schock, wenn ihr Lea Ypi vom Zusammenbruch des Ostblocks und dem Ende der Diktatur in Albanien erzählt. Mit Wolfgang Ullrich blickt sie auf die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie.

11.03.2022 Die FAZ lässt sich von der Anglistin Michele K. Troy die spannende Geschichte des Albatross Verlags schildern, der englischsprachige Literatur an der Zensur der Nazis vorbeischleuste. Die SZ empfiehlt gleich zwei gänzlich unterschiedliche Biografien über Wolfgang Rihm: Von Frieder Reininghaus lässt sie sich den Komponisten gesellschaftspolitisch einordnen, mit Eleonore Büning öffnet sie eine Schatztruhe an Erinnerungen. Außerdem liest sie Jugendbücher und bewundert, wie Sara Barnard von Mobbing erzählt. Und der Dlf empfiehlt doppelbödige Sofalektüre mit Louise de Vilmorins „Belles Amours“.

10.03.2022 Die FAZ ist hin und weg von Tania Blixens "Babettes Gastmahl" in der ersten vollständigen deutschen Übersetzung von Ulrich Sonneberg. Zwischen Schockstarre und Bewunderung liest sie, wie Tatiana Salem Levy von einer Mutter erzählt, die ihren Kindern von ihrer Vergewaltigung berichtet. Die Zeit folgt den "leuchtenden Gedanken" von Lea Ypi, die sich in "Frei" an das Aufwachsen unter Enver Hoxha erinnert. Die FR staunt, wie prophetisch Amanda Cross schon 1971 über Feminismus, Umweltverschmutzung und Verschwörungstheoretiker schrieb. Und die NZZ dringt mit dem Philologen Jonas Grethlein in die Tiefenschichten der Ilias vor.

09.03.2022 Die SZ flaniert mit dem Promifotografen Roger Fritz über den "Boulevard der Eitelkeiten" und trifft Dolly Dollar am Strand von Rio. Die FR stürzt sich derweil mit Hektor Haarkötter in die kreativen Schatzkammern da Vincis, Lichtenbergs, Luhmanns und Wittgensteins. Die FAZ lässt sich dank Ursula Krechels quecksilbriger Wahrnehmung auf das Abenteuer des Erkennens ein. Und Dlf Kultur blickt mit Laurie Penny voller "Gerechtigkeitsliebe" in die feministische Zukunft.

08.03.2022 Die FR bekommt Appetit, wenn die japanische Autorin Asako Yuzuki in ihrem eigensinnigen Roman eine Serienmörderin von Butter schwärmen lässt. Die FAZ begibt sich mit Miklos Meszöly auf „Spurensicherung“ und entdeckt eine sehr eigene Erkenntnisform. Die SZ ergötzt sich an den Scherzgedichten der Johanna Charlotte Unzer aus dem 18. Jahrhundert. Und Dlf Kultur liest berührt, wie sich Scholastique Mukasonga an ihre Mutter erinnert, die dem Völkermord an den Tutsi zum Opfer fiel.

07.03.2022 Dlf Kultur lässt sich von den Reimen Judith Zanders in dämmernde Wälder, Märchen und DDR-Geschichte verschleppen. Wärmer als Sally Rooney findet er Imogen Crimp, die in ihrem Debütroman von der Liebe einer jungen Gesangsstudentin erzählt. Die SZ empfiehlt nachdrücklich Rita Süssmuths Plädoyer für mehr Gleichberechtigung. Die FR lacht und weint bei der Lektüre von Orhan Pamuks Roman „Die Nächte der Pest“. Und die FAZ staunt über Mathijs Deens Wattwanderer-Wissen im neuen Krimi „Der Holländer“.

05.03.2022 FAZ und taz lauschen Katerina Poladjans "Zukunftsmusik", einem Roman über eine Kommunalka des Jahres 1985, als die Perestroika noch anderes versprach als Krieg. Bei Joga soll man nichts wollen, doch Emmanuel Carrère will in "Yoga" sehr viel, freuen sich SZ und Welt. Der Deutschlandfunk ist tief beeindruckt von Tatiana Salem Levys "Vista Chinesa", dem Protokoll einer Vergewaltigung. FAZ und taz befassen sich außerdem mit der extremen Rechten in den zwanziger Jahren.

04.03.2022 Dlf und Dlf Kultur folgen Emmanuel Carrère gern vom Yoga-Retreat in die rauhe Wirklichkeit: Carrere ist wie Houellebecq, nur frischer und berührender, meint der Dlf Kultur. Die FR verdankt Laetita Colombani bewegende Einblicke in die Lage der Frauen in indischen Provinzen. Die NZZ annonciert mit "Future War" das derzeit aktuellste Buch zur Sicherheitsarchitektur Europas. Dlf Kultur stellt derweil schaudernd fest, wie aktuell auch Christiane Hoffmanns Buch über die Flucht ihres Vaters aus der Ukraine ist.

03.03.2022 DIe FAZ bewundert den Mut, den Kim Hye-jin mit ihrem Roman "Die Tochter" über zwei Generationen von Frauen im heutigen Südkorea beweist. Die SZ entdeckt in Doron Rabinovicis Roman "Die Einstellung" eine grundsätzliche Erzählung über die Macht der Bilder. Von Stine Pilgaard lässt sie sich in den Mikrokosmos einer dänischen Volkshochschule entführen. Die FR verdankt Vladimir Sorokin ein erhellend dunkles Bild Russlands und seiner „ideologischen Leere“. Und der Dlf Kultur reist mit Gideon Defoe durch 48 ausgestorbene Staaten.

02.03.2022 Die FAZ träumt mit Christoph Podewils von einer emissionsfreien Zukunft und verbringt mit Gisela von Wysocki einen funkelnden Sommertag in Berlin. Die NZZ lässt sich von Gianfranco Calligarich derweil in die felliniesken Behausungen der römischen Boheme versetzen. Die Zeit hängt an den Lippen des Galeristen Franz Dahlem, wenn er von Schweinsbraten und Kunst im bleiernen Nachkriegsdeutschland erzählt. Die SZ vermutet, dass Kira Jarmyschs Roman "Dafuq" in Russland bald auf dem Index steht. Und Dlf Kultur erinnert sich mit Nino Haratischwilis prallem neuen Roman an das Georgien der Achtziger und Neunziger.

01.03.2022 Die FAZ amüsiert sich prächtig mit Tomer Gardis Antimärchen über die "Heimatsuche von Künstlernaturen". Die FR trifft in Judith Kuckarts "Café der Unsichtbaren" auf Mischfiguren aus allen gesellschaftlichen Schichten. Die taz folgt mit Matthias Lohre dem Ingenieur Herman Sörgel vom kühnen Plan zum manischen Höhepunkt. Und der Dlf lernt in Katja Diehls "Autokorrektur", welche Bevölkerungsgruppen bei der Verkehrsplanung marginalisiert werden.
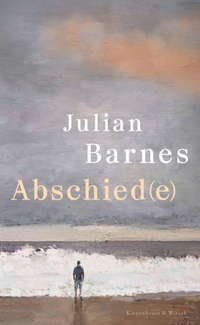 Julian Barnes: Abschied(e)
Julian Barnes: Abschied(e)