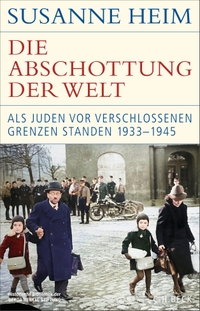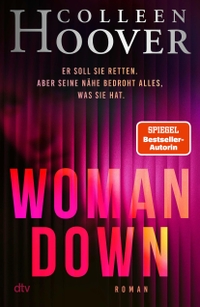Mord und Ratschlag
In bester Therapeutenmanier
Die Krimikolumne. Von Thekla Dannenberg
27.08.2015. In "Der namenlose Tag" setzt Friedrich Anis neuer Kommissar Jakob Franck im Kampf gegen Trauer und Tod auf die Strategie der Umarmung. Der israelische Autor Dror Mishani stiftet mit seinem Roman "Die Möglichkeit eines Verbrechens" Unruhe in den Zonen der persönlichen Sicherheit und Unbesorgtheit. Obwohl Kriminalhauptkommissar Jakob Franck nicht unmittelbar mit dem Fall zu tun hatte, übernahm er die Aufgabe, die Eltern der siebzehnjährigen Esther Winther zu benachrichtigen, dass ihre Tochter erhängt im Aubinger Park aufgefunden worden sei. Der Vater ist auf einer Geschäftsreise in Salzburg, er trifft die Mutter an, die ihn nur stumm anblicken kann und sich dann, in ihrem Schmerz und Schock, an ihn klammert. Für sieben Stunden. Sieben nächtliche Stunden, in denen der Polizist nichts sagt und nichts fragt und in denen die fassungslose Frau nur hin und wieder wimmert: "Sagen Sie, dass das nicht wahr ist."
Obwohl Kriminalhauptkommissar Jakob Franck nicht unmittelbar mit dem Fall zu tun hatte, übernahm er die Aufgabe, die Eltern der siebzehnjährigen Esther Winther zu benachrichtigen, dass ihre Tochter erhängt im Aubinger Park aufgefunden worden sei. Der Vater ist auf einer Geschäftsreise in Salzburg, er trifft die Mutter an, die ihn nur stumm anblicken kann und sich dann, in ihrem Schmerz und Schock, an ihn klammert. Für sieben Stunden. Sieben nächtliche Stunden, in denen der Polizist nichts sagt und nichts fragt und in denen die fassungslose Frau nur hin und wieder wimmert: "Sagen Sie, dass das nicht wahr ist."Der Tod des Mädchens ist zwanzig Jahre her, Franck mittlerweile im Ruhestand. Die Mutter hatte sich ein Jahr später das Leben genommen, der Vater Ludwig Winther ist schrecklich abgestürzt, voller Scham und Schuld, arbeitslos geworden und dem Alkohol verfallen. Er war beschuldigt worden, seine Tochter missbraucht und sie damit in den Tod getrieben zu haben. Jetzt bittet er Franck, noch einmal den Tod seiner Tochter zu untersuchen. Nein, er fleht ihn an, und Franck lässt sich darauf ein, mit den ihm eigenen Methoden: Er umarmt die Menschen und hält ihre Hände, ganz fest. Zu Frauen entwickelt er natürlich eine spontanere Nähe, aber wenn er erst einmal sein Misstrauen überwunden hat, findet er auch einen Draht zu Männern: "Sprechen Sie mir nach", fordert er den trauernden Vater in bester Therapeutenmanier auf, "ich lasse Dich los, Esther, in Dankbarkeit und Liebe".
Man könnte schreien. Oder fragen, ob Polizisten - gerade in den ersten Stunden nach einem Todesfall - nicht lieber zügig ermitteln sollten, anstatt sich in Gefühlsarbeit zu ergehen. Aber eigentlich sollte man Friedrich Anis Romane nicht als schmonzettige Krimikost betrachten, sondern als Übungen in Geduld und Toleranz und über die etwas penetrante Emotionalität hinwegsehen: Jeder Jeck ermittelt anders, wie die Kölner Kollegen sagen.
Denn wie auch in seinen anderen Romanen erzählt Ani in "Der namenlose Tag" von Menschen, deren Lebenswelten in der aktuellen Literatur kaum noch Platz findet: Ani erzählt nicht nur von den potenten Mittelschichtsakademikern aus den urbanen Zentren von BerlinMünchenHamburg - die gibt es bei ihm auch, meist jedoch in der Variante der zickig-unsympathischen Journalistin. Ani erzählt von viel interessanteren Menschen: Zuallererst von seiner neuen Hauptfigur Jakob Franck, dem Trauerarbeiter und Kommissar im unbequemen Ruhestand. Aber eben auch von Küchenhilfen, Hosenschneidern oder Getränkelieferanten in Aubing und Berg am Laim. Oder von dem Malermeister, der im Suff seine Frau erschlug.
Vor allem aber ist bei Ani ein Todesfall nicht Anlass für eine Ermittlung ist, sondern eine große Tragödie. Mit ungeheurer Zärtlichkeit erzählt Ani von diesem Ludwig Winther, der seine Familie verlor und zwanzig Jahre später noch so hilflos und verzweifelt darum kämpft, ein neues Leben zu finden. Mag Ani ein Frauenversteher und Witwentröster sein - seine Romane sind einfach bewegend.
Friedrich Ani: Der namenlose Tag. Ein Fall für Jakob Franck. Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin 2015, 299 Seiten, 19,95 Euro
***
 Auch Inspektor Avi Avraham von der Polizei in Cholon, südlich von Tel Aviv, setzt bei seinen Ermittlungen nicht auf schnelle Verhaftungen, harte Verhöre oder andere Methoden des strategischen Druckaufbaus. Die Instrumente seiner Arbeit sind Reflexion und Empathie. Wenn hier jemand die Schärfe der Polizeiarbeit zu spüren bekommt, dann er selbst. In seinem vorherigen Fall hatte er sich so viele Fehler geleistet, dass gegen ihn ein Verfahren eingeleitet wurde. Der abschließende Bericht der Untersuchung konstatiert sein Versagen in aller Ausführlichkeit, billigt ihm jedoch auch zu, über seine eigenen Umwege, Verzögerungen und Fehleinschätzungen doch zum richtigen Ergebnis gekommen zu sein. Auch in seinem neuen Fall wird er wieder beschämende Fehler machen, die ihn jedoch - zum Glück - auf eine völlig falsche Spur führen werden.
Auch Inspektor Avi Avraham von der Polizei in Cholon, südlich von Tel Aviv, setzt bei seinen Ermittlungen nicht auf schnelle Verhaftungen, harte Verhöre oder andere Methoden des strategischen Druckaufbaus. Die Instrumente seiner Arbeit sind Reflexion und Empathie. Wenn hier jemand die Schärfe der Polizeiarbeit zu spüren bekommt, dann er selbst. In seinem vorherigen Fall hatte er sich so viele Fehler geleistet, dass gegen ihn ein Verfahren eingeleitet wurde. Der abschließende Bericht der Untersuchung konstatiert sein Versagen in aller Ausführlichkeit, billigt ihm jedoch auch zu, über seine eigenen Umwege, Verzögerungen und Fehleinschätzungen doch zum richtigen Ergebnis gekommen zu sein. Auch in seinem neuen Fall wird er wieder beschämende Fehler machen, die ihn jedoch - zum Glück - auf eine völlig falsche Spur führen werden.In den frühen Morgenstunden eines Herbsttages wird im Gebüsch vor einem Kindergarten ein Koffer mit einer bedrohlichen Bombenattrappe entdeckt. Festgenommen wird noch vor Ort Amos Usen, ein arbeitsloser Kleinkrimineller mit aufsässigem Naturell, der sich unter den Schaulustigen herumdrückte und seine Papiere nicht vorzeigen wollte, als ihn eine Polizistin danach fragte. Avraham lässt ihn laufen. Er interessiert sich viel mehr für die Leiterin des Kindergartens Chava Cohen, die aggressiv den ganzen Vorfall herunterspielt, offenbar um ihre Einrichtung nicht in Misskredit bringen zu lassen. Und für Chaim Sara, einen nicht mehr ganz jungen Vater zweier Söhne, von denen der jüngere noch in den Kindergarten geht. Es könnte gut sein, dass der Kleine von Chava Cohen nicht nur geschlagen, sondern regelrecht misshandelt wurde. Aber beide Jungen scheinen verstört, ihre Mutter ist verschwunden. Wenige Tage darauf, wird die Kindergärtnerin in einem Abflusskanal von Tel Aviv halbtot geschlagen gefunden.
Avi Avraham macht Fehler, zögert, vertraut den falschen Leuten, man verfolgt das passagenweise mit einer gewissen Ungeduld, doch er bleibt nie in alten Denkmustern verhaftet. Er stellt jede Überzeugung zur Disposition und probiert neue Wege aus. Wie in dem ersten Roman um Inspektor Avraham, "Vermisst", siedelt Mishani seinen Fall auch in "Die Möglichkeit eines Verbrechen" in einer ganz normalen Familie an, im Herzen Israels also. Doch lässt er seinen Inspektor nicht dem größten aller Irrtümer aufsitzen, dem Glauben nämlich, dass man Kriminalität und Verbrechen auslagern könne, hinter Zäune sperren, aus den Zonen des Komforts heraushalten. Dieser gewaltige Irrtum ist dem neuen Polizeichef mit politischen Avancen vorbehalten, für den Kriminalität höchstens eine Sache der illegalen Einwanderer im Süden Tel Avivs ist und der deshalb in seiner Antrittsrede seine Mission verkündet: "Mein Ziel ist es, im Ayalon-Distrikt möglichst viele Zonen zu schaffen, die frei von potenzieller Gewalt sind. Zonen der persönlichen Sicherheit und Unbesorgtheit."
Mit seinen aufreizend alltäglichen Fällen bürstet der Tel Aviver Lektor und Literaturdozent Mishani nicht nur die Lesegewohnheiten hartgesottener Genre-Liebhaber gegen den Strich, sondern auch die israelischer Leser, für die Helden in der Regel bei Armee oder Geheimdienst arbeiten, europäische Wurzeln haben und das Land gegen Terror verteidigen. Ein orientalischer Jude wie Avi Avraham, der sich nicht nur - ganz buchstäblich - mit Kinderkram beschäftigt, und das auch noch so ineffizient und ohne die Errungenschaften von Israels Silicon Wadi, muss als reinste Provokation gelten.
Dror Mishani: Die Möglichkeit eines Verbrechens. Avi Avraham ermittelt. Roman. Aus dem Hebräischen von Markus Lemke. Zsolnay Verlag, Wien 2015, 332 Seiten, 19,90 Euro
Mehr über Dror Mishani hier.
Kommentieren