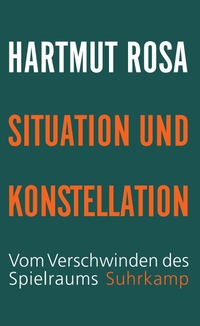BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)
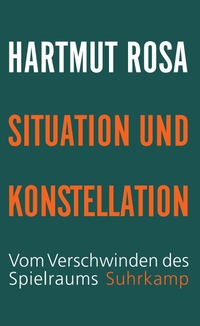
Hartmut Rosa: Situation und Konstellation
Die Lehrerin, die Noten nicht zur Ermutigung vergeben kann, die Ärztin, die Bildschirme statt Patienten behandelt, der Schiri, dessen Augenmaß vom VAR verdrängt wird: Unmerklich…

Natascha Strobl: Kulturkampfkunst
Ein "Zuschauer*innen" in den Nachrichten, und das Internet kocht. Ein Verlag zieht zwei Winnetou-Bücher zurück, und die Angelegenheit weitet sich fast zu einer Staatsaffäre…

Maurice Crul, Frans Leslie: Gesellschaft der Minderheiten
Aus dem Niederländischen von Annette Wunschel. Integration im Zeitalter superdiverser Gesellschaften Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit haben so viele Leute aus…

Daniel Bax: Die neue Lust auf links
Die freundliche Revolution "Wir sind die Brandmauer!", schleuderte Heidi Reichinnek Friedrich Merz im Bundestag entgegen, als dieser im Januar 2025 mit den Stimmen der AfD…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier
 Mord und Ratschlag 12.02.2018 Marcie Rendon erzählt in ihrem poetischen Krimi "Am roten Fluss" von Untaten gegen die indianischen Amerikaner in Nord Dakota. Tom Franklin lehrt mit seiner Südstaaten-Groteske "Smonk" das Fürchten vor der Tollwut des religiösen Fanatikers. Von Thekla Dannenberg
Mord und Ratschlag 12.02.2018 Marcie Rendon erzählt in ihrem poetischen Krimi "Am roten Fluss" von Untaten gegen die indianischen Amerikaner in Nord Dakota. Tom Franklin lehrt mit seiner Südstaaten-Groteske "Smonk" das Fürchten vor der Tollwut des religiösen Fanatikers. Von Thekla Dannenberg