BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Daniel Gerlach: Die Kunst des Friedens
In den Nachrichten erscheint der Nahe Osten oft als ewiger Krisenherd, wo Konflikte mit unerbittlicher Gewalt ausgetragen werden und niemand Kompromisse machen will. In einer…
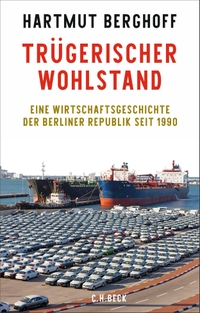
Hartmut Berghoff: Trügerischer Wohlstand
Vom Musterknaben zum Patienten? Die deutsche Wirtschaft seit der Wiedervereinigung Die Bundesrepublik befindet sich mitten in einer "Zeitenwende" und steht vor tiefgreifenden…
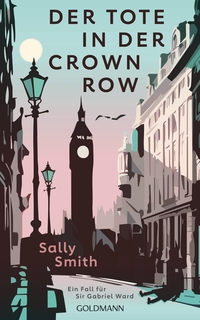
Sally Smith: Der Tote in der Crown Row
Aus dem Englischen von Sibylle Schmidt. London 1901: Der Temple-Bezirk mit seinen alten Gebäuden und verwinkelten Straßen liegt im Herzen Londons und bildet das Zentrum der…
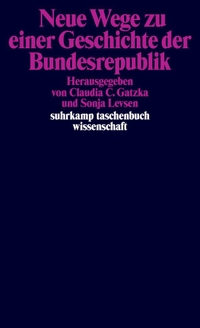
Claudia Gatzka (Hg.), Sonja Levsen (Hg.): Neue Wege zu einer Geschichte der Bundesrepublik
Lange erzählten Historiker der Bundesrepublik Geschichten von wachsendem Wohlstand, Modernisierung, erlernter Liberalität und stabiler Demokratie. Deutschland schien "im…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier