BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)
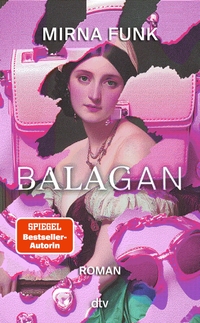
Mirna Funk: Balagan
Eine Frau kämpft um ihr Erbe - und um das ihrer jüdischen Familie. Altes Zeug, im besten Fall ein Erinnerungsstück - mehr erwartet Amira nicht, als sie die Tür zum Lagerraum…

Gabriel Zucman: Reichensteuer
Aus dem Französischen von Ulrike Bischoff. Gabriel Zucman gehört zu den bekanntesten und renommiertesten Ökonomen weltweit. Seit Jahren forscht er zu Steuergerechtigkeit…

Maximilian Oehl: Brand New Bundestag
Die politischen Systeme in unserem Land wirken festgefahren und verstaubt. Sie scheinen kaum in der Lage, auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren. Es ist höchste…
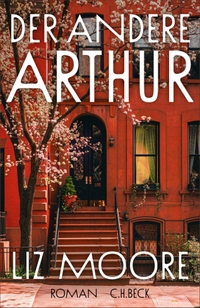
Liz Moore: Der andere Arthur
Aus dem Amerikanischen von Cornelius Hartz. Wie in der Fürsorge für andere die eigene Rettung liegen kann Arthur Opp, ehemaliger Literaturprofessor, wiegt 250 Kilo und hat…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier