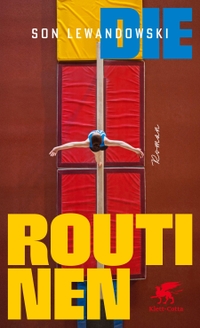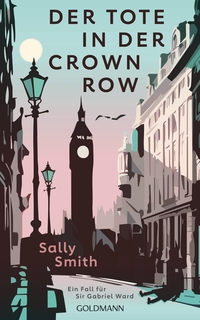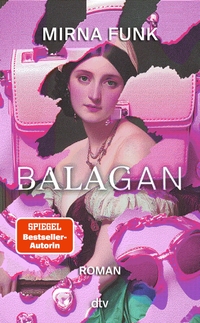BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)
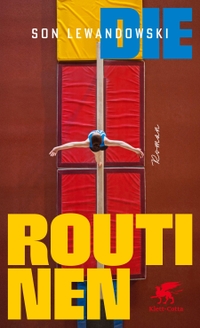
Son Lewandowski: Die Routinen
Ein Gummibärchen essen, heute den Arm, morgen ein Bein. Was sich anhört wie ein Witz, ist Alltag für die Leistungsturnerin Amik. Für sie zählt jedes Gramm, jeder Wettkampf,…
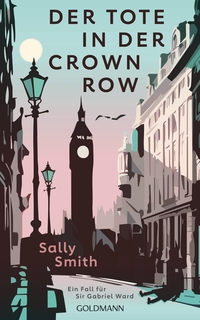
Sally Smith: Der Tote in der Crown Row
Aus dem Englischen von Sibylle Schmidt. London 1901: Der Temple-Bezirk mit seinen alten Gebäuden und verwinkelten Straßen liegt im Herzen Londons und bildet das Zentrum der…
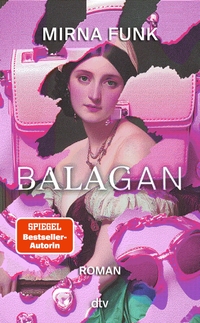
Mirna Funk: Balagan
Eine Frau kämpft um ihr Erbe - und um das ihrer jüdischen Familie. Altes Zeug, im besten Fall ein Erinnerungsstück - mehr erwartet Amira nicht, als sie die Tür zum Lagerraum…

Ben Shattuck: Eine Geschichte der Sehnsucht
Nantucket im Jahre 1796. Die verwitwete Laurel bekommt überraschend Besuch von ihrer Jugendliebe Will in Begleitung seiner jungen Braut. Sie sind auf dem Weg nach Barbados…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier
 Mord und Ratschlag 05.10.2015 An der Grenze zu den USA wird niemand scheitern, der es durch Mexiko geschafft hat: In seinem Roman "Die Verbrannten" erzählt Antonio Ortuño, wie mexikanische Banden und Behörden die Flüchtlinge aus Mittelamerika zum Raub- und Handelsgut machen. Celil Oker besingt in "Lass mich leben, Istanbul" verruchte Schönheit und die Ineffizienz des Lebens. Von Thekla Dannenberg
Mord und Ratschlag 05.10.2015 An der Grenze zu den USA wird niemand scheitern, der es durch Mexiko geschafft hat: In seinem Roman "Die Verbrannten" erzählt Antonio Ortuño, wie mexikanische Banden und Behörden die Flüchtlinge aus Mittelamerika zum Raub- und Handelsgut machen. Celil Oker besingt in "Lass mich leben, Istanbul" verruchte Schönheit und die Ineffizienz des Lebens. Von Thekla Dannenberg