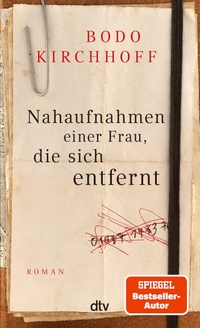Mord und Ratschlag
Vom Wert der Recherche
Die Krimikolumne. Von Michael Schweizer
01.08.2002. Die Krimikolumne. Heute: Petra Hammesfahrs Serienmörder-Roman "Das letzte Opfer" ist schlecht geschrieben, fesselt aber mit beunruhigender Seelenkenntnis. Das Unwichtigste an einem Roman ist sein Thema. Egal worüber: Gut Geschriebenes interessiert, schlecht Geschriebenes langweilt. Das gilt auch für Krimis, Thriller und andere Verbrechensromane, die man schließlich als Kunstanstrengung ernst nehmen sollte. Stiehlt jemand zehn Euro aus der Kasse des Briefmarkensammlervereins, so bildet ein guter Autor daraus eine aufregende Geschichte; Stümpern, auch bestimmter Bestseller-Schulen, nützt es nichts, wenn sie in ihre Bücher alles hineinstopfen, was das Leben dramatisch macht. Sie bleiben öde.
Es gibt aber Ausnahmen. Petra Hammesfahr hat mit "Das letzte Opfer" einen Roman geschrieben, gegen den sich künstlerisch einiges einwenden lässt, der aber fesselt. Man liest diagonal, weil man möglichst schnell erfahren will, wie es weitergeht, dann möchte man auf keine Einzelheit verzichten und blättert zurück. Wie hat die 1951 geborene Autorin das geschafft?
Das letzte Opfer ist Karen Stichler. Als der Roman im Frühjahr 2000 in Köln einsetzt, ist sie 28 Jahre alt und hat viel erlitten. Sie war das begabte Kind einer quengelnden Friseuse und eines herzlichen, zugewandten Monteurs, wollte eine begeisternde Schauspielerin werden und brillierte schon auf der Schulbühne. Aber dann wird sie nach einem Discobesuch vergewaltigt, ohne den Täter zu erkennen, und bringt mit 16 Jahren ihr erstes Kind zur Welt, Jasmin. Zwei Jahre später, am 14. September 1990, überfährt sie einen alten Radfahrer, der daran stirbt. Was vorher geschehen, warum sie so panisch gerast ist, hat sie verdrängt.
Weitere vier Jahre später heiratet sie den Fotografen Marko Stichler, richtet sich kleinbürgerlich leidlich ein, bekommt Kevin, ihr zweites Kind. Auch für Marko wiegt der 14. September schwer: 1979 ist an diesem Tag seine Halbschwester Rabea im Rhein ertrunken. Und Thomas Scheib, Profiler beim Bundeskriminalamt, stößt auf noch eine Bedeutung des Datums: Seit 1982 verschwindet alle zwei Jahre an diesem Tag eine junge Frau. Manche werden tot gefunden, andere gar nicht. Karens Bruder Norbert fährt jeden zweiten September alleine in Urlaub. Er oder Marko, einer von diesen Männern, die so wichtig für sie sind, ist ein Serienmörder.
In vielem ist die Geschichte überladen und unplausibel. Petra Hammesfahr flicht einen Mord ein, der mit den Serientaten nichts zu tun hat: Ein enttäuschter junger Liebhaber aus der Münchner Gegend tötet die Frau, die ihn verlassen will. Statt die Leiche in einem bayerischen Wald zu verstecken, transportiert er sie in ihr Haus nach Köln. Der Bruder der Toten lässt sich, man weiß nicht, warum, vom Serienmörder zu einem Anschlag auf Karen bewegen. Polizisten fragen nicht nach dem Namen eines wichtigen Zeugen. Eine andere, in den Fall nicht verstrickte Zeugin erzählt immer gerade die Lügen, die die Ermittlung aufhalten. Hammesfahr hat bemerkt, dass das alles viel zu viel ist, und reicht für gröbere Ungereimtheiten Erklärungen nach, von denen aber nichts besser wird.
Um den Roman spannend zu machen, offenbart, tarnt und verschweigt der allwissende Erzähler seine Kenntnisse in einer Weise, die man autoritär nennen kann. Oft demonstriert er, dass er ex post berichtet und das Geschehen komplett überblickt ("Aber bis dahin waren es noch zwei Jahre"). Er rückt jedoch immer nur mit dem heraus, was ihm hilft, im Wechsel Marko und Norbert als Täter erscheinen zu lassen. Das ist im Krimi und im Thriller völlig in Ordnung, wenn es nicht nur dem Nervenkitzel des Lesers dient, sondern auch den beschriebenen Charakteren gerecht wird. Der traumatisierten Karen aber, die verständlicherweise vieles verdrängt hat, fällt alles Häppchen für Häppchen genau in dem Rhythmus wieder ein, den Hammesfahr für ihre Spannungsbögen benötigt.
Dass die Romanpersonen manchmal als erzähltechnische Manövriermasse missbraucht werden, zeigt auch der Stil. Drei Perspektiven wechseln sich ab und gehen ineinander über: die Sicht Karens, die des Ermittlers und die des allwissenden Erzählers Scheib. Der Ton ist aber immer derselbe: Er klingt nach Sachbearbeitung ("die Kosten der gemeinsamen Lebensführung") mit Ausschlägen ins Klischeehafte ("eine wahre Flut von Tränen") und Therapeutische ("Sie lernte zu diskutieren, ihren Standpunkt zu vertreten und sich kritisch mit der Realität auseinander zu setzen"). Das ist keine Rollenprosa, sondern die Autorin selbst, die es versäumt, ihren Figuren eine je eigene Sprache zu geben.
Warum fesselt "Das letzte Opfer" trotz alledem? Gegen die Regel eben doch: wegen des Themas, der Fakten, der mehr journalistisch-wissenschaftlichen als künstlerischen Recherche. Der Kern von allem, die Seele des Serienmörders, stimmt. Man versteht den Mann und ist beunruhigt und fasziniert, dass das so gut geht. Denn wer wäre nicht in einer schwierigen Familie aufgewachsen: schwacher oder abwesender Vater, anstrengende Mutterfigur, der Aufmerksamkeitskampf gegen die Geschwister - solche oder vergleichbare Gewichte trägt doch jeder. Die Grenze zum gewalttätigen Psychopathen ist für die meisten Menschen sicher. Aber sie ist auch schmal.
Petra Hammesfahr: "Das letzte Opfer". Roman. Wunderlich Verlag, Hamburg 2002, 395 Seiten, gebunden, 19,90 Euro
Es gibt aber Ausnahmen. Petra Hammesfahr hat mit "Das letzte Opfer" einen Roman geschrieben, gegen den sich künstlerisch einiges einwenden lässt, der aber fesselt. Man liest diagonal, weil man möglichst schnell erfahren will, wie es weitergeht, dann möchte man auf keine Einzelheit verzichten und blättert zurück. Wie hat die 1951 geborene Autorin das geschafft?
Das letzte Opfer ist Karen Stichler. Als der Roman im Frühjahr 2000 in Köln einsetzt, ist sie 28 Jahre alt und hat viel erlitten. Sie war das begabte Kind einer quengelnden Friseuse und eines herzlichen, zugewandten Monteurs, wollte eine begeisternde Schauspielerin werden und brillierte schon auf der Schulbühne. Aber dann wird sie nach einem Discobesuch vergewaltigt, ohne den Täter zu erkennen, und bringt mit 16 Jahren ihr erstes Kind zur Welt, Jasmin. Zwei Jahre später, am 14. September 1990, überfährt sie einen alten Radfahrer, der daran stirbt. Was vorher geschehen, warum sie so panisch gerast ist, hat sie verdrängt.
Weitere vier Jahre später heiratet sie den Fotografen Marko Stichler, richtet sich kleinbürgerlich leidlich ein, bekommt Kevin, ihr zweites Kind. Auch für Marko wiegt der 14. September schwer: 1979 ist an diesem Tag seine Halbschwester Rabea im Rhein ertrunken. Und Thomas Scheib, Profiler beim Bundeskriminalamt, stößt auf noch eine Bedeutung des Datums: Seit 1982 verschwindet alle zwei Jahre an diesem Tag eine junge Frau. Manche werden tot gefunden, andere gar nicht. Karens Bruder Norbert fährt jeden zweiten September alleine in Urlaub. Er oder Marko, einer von diesen Männern, die so wichtig für sie sind, ist ein Serienmörder.
In vielem ist die Geschichte überladen und unplausibel. Petra Hammesfahr flicht einen Mord ein, der mit den Serientaten nichts zu tun hat: Ein enttäuschter junger Liebhaber aus der Münchner Gegend tötet die Frau, die ihn verlassen will. Statt die Leiche in einem bayerischen Wald zu verstecken, transportiert er sie in ihr Haus nach Köln. Der Bruder der Toten lässt sich, man weiß nicht, warum, vom Serienmörder zu einem Anschlag auf Karen bewegen. Polizisten fragen nicht nach dem Namen eines wichtigen Zeugen. Eine andere, in den Fall nicht verstrickte Zeugin erzählt immer gerade die Lügen, die die Ermittlung aufhalten. Hammesfahr hat bemerkt, dass das alles viel zu viel ist, und reicht für gröbere Ungereimtheiten Erklärungen nach, von denen aber nichts besser wird.
Um den Roman spannend zu machen, offenbart, tarnt und verschweigt der allwissende Erzähler seine Kenntnisse in einer Weise, die man autoritär nennen kann. Oft demonstriert er, dass er ex post berichtet und das Geschehen komplett überblickt ("Aber bis dahin waren es noch zwei Jahre"). Er rückt jedoch immer nur mit dem heraus, was ihm hilft, im Wechsel Marko und Norbert als Täter erscheinen zu lassen. Das ist im Krimi und im Thriller völlig in Ordnung, wenn es nicht nur dem Nervenkitzel des Lesers dient, sondern auch den beschriebenen Charakteren gerecht wird. Der traumatisierten Karen aber, die verständlicherweise vieles verdrängt hat, fällt alles Häppchen für Häppchen genau in dem Rhythmus wieder ein, den Hammesfahr für ihre Spannungsbögen benötigt.
Dass die Romanpersonen manchmal als erzähltechnische Manövriermasse missbraucht werden, zeigt auch der Stil. Drei Perspektiven wechseln sich ab und gehen ineinander über: die Sicht Karens, die des Ermittlers und die des allwissenden Erzählers Scheib. Der Ton ist aber immer derselbe: Er klingt nach Sachbearbeitung ("die Kosten der gemeinsamen Lebensführung") mit Ausschlägen ins Klischeehafte ("eine wahre Flut von Tränen") und Therapeutische ("Sie lernte zu diskutieren, ihren Standpunkt zu vertreten und sich kritisch mit der Realität auseinander zu setzen"). Das ist keine Rollenprosa, sondern die Autorin selbst, die es versäumt, ihren Figuren eine je eigene Sprache zu geben.
Warum fesselt "Das letzte Opfer" trotz alledem? Gegen die Regel eben doch: wegen des Themas, der Fakten, der mehr journalistisch-wissenschaftlichen als künstlerischen Recherche. Der Kern von allem, die Seele des Serienmörders, stimmt. Man versteht den Mann und ist beunruhigt und fasziniert, dass das so gut geht. Denn wer wäre nicht in einer schwierigen Familie aufgewachsen: schwacher oder abwesender Vater, anstrengende Mutterfigur, der Aufmerksamkeitskampf gegen die Geschwister - solche oder vergleichbare Gewichte trägt doch jeder. Die Grenze zum gewalttätigen Psychopathen ist für die meisten Menschen sicher. Aber sie ist auch schmal.
Petra Hammesfahr: "Das letzte Opfer". Roman. Wunderlich Verlag, Hamburg 2002, 395 Seiten, gebunden, 19,90 Euro