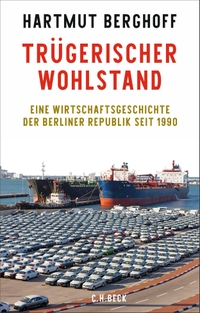Im Kino
Silhouettenspiele
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Thomas Groh
30.01.2013. In "Zero Dark Thirty" fächert Kathryn Bigelow das Bilderregime der letzten zehn Jahre auf. Steven Spielberg spürt Abraham Lincoln unterdessen mit den Methoden eines schummrigen Piktorialismus nach. Vorenthaltene Bilder: Der gekürzte Schwarzenegger-Film wird nicht besprochen.
Das erste Bild: Kein Bild, aber ein Datum. 11. September 2001. Die Leinwand bleibt schwarz, die Ikone der qualmenden, schließlich kollabierenden Twin Towers bleibt ausgespart. Stattdessen hört man Aufnahmen von Telefonanrufen aus dem Innern des Gebäudes. Menschen in Lebensangst. In der Überpräsenz der buchstäblich monolithischen Panorama-Nachrichtenbilder vom 11. September verschwindet das Schicksal des Einzelnen - Regisseurin Kathryn Bigelow bricht dieses Bilderregime für einen Moment lang auf. Von vornherein ist klar: "Zero Dark Thirty" versteht sich als bildpolitische Intervention.
Eine, die schon in der nächsten Sequenz an die Grenzen des Erträglichen rührt: Gezeigt wird ein Folterverhör im Zuge der Post-9/11-Ermittlungen im Jahr 2003, ohne Scheu vor Waterboarding und Fäkalien. "Zero Dark Thirty" liefert an drastischen, bewegten Bildern nach, was auch im Zuge der allgemeinen Diskussionen in den 00er Jahren um Guantanamo, Foltermethoden und Abu Ghraib abstrakt oder auf wenige Amateurfotografien beschränkt blieb. Die ursprüngliche Foltersituation - mit ihren räumlichen Bedingungen, handelnden Subjekten und leidenden Menschen - wandelt sich zu einem Schlagwort auf dem Feld politischer Debatten, an das ganz unterschiedliche Interessenscluster geknüpft werden. Muss man Folter gesehen haben, um zu wissen, dass Folter schrecklich ist? Mitnichten - aber einem abstrakten, der Tendenz nach instrumentalisierten Diskurs stellen solche Bilder, die ins Konkrete zurückholen, was zuvor ins rein verbale Öffentlichkeitsgeschäft abgedrängt und damit dem Erfahrungsraum größtenteils entzogen wurde, ein emphatisches Memento entgegen.
Für die CIA-Ermittlerin Maya (Jessica Chastain), die dem Geschehen am Rande beiwohnt, eine ebenso mulmige Erfahrung wie für den Zuschauer - und doch wird sich Mayas Jagd auf Osama Bin Laden im Laufe des Films zur manischen Raserei entwickeln. "Zero Dark Thirty" verfolgt diese Entwicklung schlaglichtartig, über eine vom 11. September und der Ermordung Osama Bin Ladens im Mai 2011 gerahmte Dekade hinweg: Schon deshalb lässt sich schwerlich, wie in einigen Kontroversen behauptet, von einer Legitimation der Folter sprechen, die der Film angeblich im Sinn habe: "Zero Dark Thirty" fehlt es, und das ist seine Stärke, an der narrativen Stringenz der Komposition seiner herausmodellierten Episoden, in denen Folterer wenig später als ganz normale Thirty-Somethings vor betont zivilisiert-klimatisierter Kulisse darüber reden, demnächst einen Karrierewechsel in Angriff nehmen zu wollen, als ginge es um einen ganz normalen Branchenwechsel im Zuge individueller Lebenslauf-Optimierung. Was fehlt, ist die triumphale Geste, die Zuspitzung und dramaturgische Zurichtung des Gezeigten im Sinne einer politischen Vereinnahmung. Drastisch gesagt: Im Umgang mit jüngerer amerikanischer Geschichte (die hier ohnehin nicht zu einer Grand National Story amalgamisiert, sondern aus der Ameisensperspektive eines zähen, geradezu entropisch eingedickten Ermittlungsalltags geradezu zerfasert wird) ist "Zero Dark Thirty" weder Michael Moore noch Michael Bay.

Auch deshalb treffen die ihrerseits an einer politischen Vereinnahmung oder Abgrenzung interessierten Diskussionen den Film nicht: Was sie an ideologischen Aussagesystemen jenem unterschieben zu versuchen, findet schon in dessen Form keinen Halt. Wenn sich eine solche politische Stellungnahme dem Film überhaupt entnehmen lässt, so handelt es sich am ehesten um eine Positionierung, die auf Distanz zur offiziellen Ikonografie mit den daran geknüpften Machtinteressen geht. So folgt auch das letzte Viertel - das einzige Segment, das auf den langfristig geradlinigen Nachvollzug einer Aktionshandlung angelegt ist - einem Gestus der Bildauffächerung: Wenn hier, im wider alle Auflagen des Actionkinos zum Exzess hochkonzentriert inszenierten Zugriff auf Osama Bin Ladens letztes Versteck am 2. Mai 2011, im quasi-dokumentarischen Modus jedes konkrete Detail in die Aufmerksamkeit gerückt wird, fokussiert Bigelow darin gerade das, was im ikonischsten Bild aus dieser Nacht - Barack Obama, Hillary Clinton samt weiteren Mitarbeitern des Sicherheitsteams im Situation Room - als Aufmerksamkeitspunktum gerade in dessen Off gerückt ist.
Es sind zehn düstere Jahre, die Bigelow mit "Zero Dark Thirty" schon im Titel entsprechend kennzeichnet. Am Ende dieser langen, dunklen Jahre steht eine für Maya ernüchternde Erkenntnis: Osama Bin Ladens toter Leib - hier in einer Perspektive gezeigt, die zum einen neuerlich den toten Körper im Bild nachliefert, ohne aber finale Gewissheit zuzulassen - ist als Fetisch nicht weiter von Belang. Dem Triumph des Todesschützen sind, als Zuspitzung einer zehn Jahre währenden Entwicklung, nur wenige Sekunden gegönnt. Die Soldaten bringen gänzlich andere reiche Beute mit: Computer, Festplatten, Videokassetten und andere Datenträger stehen im eigentlichen Interesse militärischer Begehrlichkeiten.
Wohl auch deshalb vergießt die zur Löwin gewordene Maya am Ende des Films bereits vielkommentierte Tränen. Vielleicht ja wirklich, weil sie nach zehn Jahren Jagd auf Osama Bin Laden in die Leere einer ausgehöhlten Biografie zurückkehrt, womöglich aber auch, weil der asymmetrische Krieg des 21. Jahrhunderts keinen Helden mehr kennt, sondern als Fortsetzung von Daten- und Informationsakquise mit militärischen Mitteln besteht und damit potenziell nie ein Ende findet. Andererseits handelt der Film auch von einer Frau, die sich in einer Männerdomäne against all odds durchbeißt und eine Kohorte von Männern im körperlichen Einsatz bis zum Triumph dirigiert. Man mag darin auch ein verstecktes autobiografisches Statement jener Regisseurin nach ihrer Oscarprämierung entdecken, die seit jeher auf "die Frau, die Actionfilme dreht" reduziert wird.
Thomas Groh
---
Intermission: An dieser Stelle war für diese Woche eine Besprechung von "The Last Stand", Arnold Schwarzeneggers Rückkehr auf die Leinwand nach zehnjähriger Tätigkeit als Politiker, geplant. Nicht, dass der Film unserem Kritiker nicht gefallen hätte - ganz im Gegenteil. Doch trübt die Entscheidung des Filmverleihs, den Film aus Marktkalkül trotz einer anstandslosen FSK-Freigabe ab 18 nur in einer gekürzten, dann aber ab 16 Jahre freigegebenen Version ins Kino zu bringen, die Freude an dieser Rückkehr empfindlich. Um ein Novum handelt es sich freilich nicht - Filmkürzungen zur Vergrößerung des Marktpotenzials sind eine übliche Strategie, in der sich auch zeigt, wie wenig sich die Branche noch um ein erwachsenes Publikum schert. Aber auch im Lichte aktueller Feuilletondebatten zeigt sich eine Geringschätzung wenn schon nicht der Kunst des Films, so doch des Mediums Film. Während viele Kommentatoren sich energisch darum bemühen, insbesondere auch Kinderliteratur vom Stempel der Gebrauchsliteratur zu befreien und mit philologischem Furor "Zensur" rufen, wenn in älteren Büchern Begriffe wie "Neger" durch neutralere ersetzt werden, rufen Filmkürzungen nicht den Hauch eines Skandals hervor, geschweige denn, dass Leser darüber informiert würden. Weil wir dem höchst zweifelhaften Manöver solcher Filmkürzungen nicht zuarbeiten wollen, haben wir uns deshalb dazu entschlossen, auf "The Last Stand", wenn auch schweren Herzens, zu verzichten.
---

In einer schönen Szene zu Beginn hält Abraham Lincoln (Daniel Day-Lewis) auf demokratische Weise Hof: Bei einem Besuch an der Front tritt er den Truppen auf Augenhöhe entgegen, befragt erst zwei junge schwarze, dann zwei junge weiße Soldaten nach ihren Befindlichkeiten und findet dabei genau das richtige Verhältnis von ehrlichem Interesse und jener Distanz, die vor anmaßender Kumpelei schützt. Die Kinofigur Lincoln (kanonisch geworden spätestens durch John Fords "Young Mr. Lincoln") ist ein Meister der Kommunikation, weil sie, eigentlich schon in ihrer leicht grotesken Statur und linkischen Gestik, zwar volkstümlich ist, aber nicht auf eine urwüchsige, sondern auf eine reflexive, oft explizit ironische, erkennbar: gemachte Art.
In Steven Spielbergs Biopic funktoniert Lincoln als Joker, den die Geschichte zieht, wenn es ansonsten nicht mehr weiter, nicht mehr vorwärts geht. Er sitzt oft etwas abseits, für die Kamera versteckt, und hört mit an, wie um ihn herum die Akteure sich ineinander und in ihre jeweiligen Interessen verkeilen und erst, wenn die Situation kurz vor der endgütligen Eskalation steht, greift er ein. Schon auch einmal mit einem kräftigen Faustschlag auf den Tisch, lieber jedoch mit einer leise, aber bestimmt vorgetragenen Wortmeldung, die aus den kleinteiligen Verfahrensfragen aussteigt und das Register wechselt, sich mal ins Grundsätzliche der politischen Moral vorwagt, mal ins Anekdotische ausweicht und jedenfalls immer das letzte Wort behält.
Diese Kommunikationskunst ist das, was den Film an Lincoln mit ziemlicher Ausschließlichkeit interessiert. Der Bürgerkrieg dringt nur zweimal kurz, eben einmal am Anfang und dann noch einmal kurz vor Schluss, direkt in den Film ein, die biografische Vorgeschichte bleibt ganz außen vor, beziehungsweise bei John Ford. "Lincoln" konzentriert sich auf einige wenige Wochen im Januar 1865, dreht sich um Lincolns Anstrengungen, den 13. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, der die Sklaverei abschaffte, vom Repräsentantenhaus absegnen zu lassen. Die Tricks, die anzuwenden der Präsident sich dabei nicht zu schade ist, sind dem Ideal der Demokratie auch dann verpflichtet, wenn sie deren Verfahrensregeln ad absurdum zu führen scheinen.
"Lincoln" ist, mehr noch als die meisten früheren, stärker dem Melodramatischen verpflichteten und deshalb, bei allen Problemen, die so etwas mit sich bringt, wagemutigeren Historienfilme Spielbergs, klassisches, inhaltlich wie stilistisch risikoarmes middlebrow-Qualitätskino: Beliebte Schauspieler, anerkannte Meister ihres Fachs (Daniel Day-Lewis macht seine Sache gut, er wird sich seinen dritten Oscar redlich verdient haben), agieren in schicken Kostümen vor detailfreudig ausgestalteter Kulisse tendenziell erregungsarme Dramen aus, in denen die nationale Identität der Vereinigten Staaten auf konsens- und popkulturell anschlussfähige Weise Ausdruck findet, und aus denen sich vielleicht auch noch die eine oder andere Lektion für die Gegenwart extrahieren lässt, zum Beispiel hinsichtlich der Notwendigkeit, gelegentlich auch über Parteigrenzen hinweg zu einer Verständigung zu gelangen.

Wie zuletzt zum Beispiel auch Clint Eastwoods historisches Biopic "J. Edgar" ist "Lincoln" ein Film, der sich, schon was die visuelle Gestaltung betrifft, lieber in der atmosphärischen Dämmerung der populären Mythologie umtut, als Licht ins Dunkel zu bringen (und dabei, anders als Eastwoods doch deutlich interessanterer, weil zutiefst bilderskeptischer Film, den Mythos voll und ganz beim Wort nimmt). Gerade die Szenen in Lincolns eigenen vier Wänden, in seinen privaten Rückzugsräumen, sind sparsam illuminierte Schattenkompositionen, Silhouettenspiele hinter halbdurchsichtigen Vorhängen. Schön anzusehen ist das durchaus (Kamera wieder einmal: Janusz Kaminski), es ist allerdings kaum von der Hand zu weisen, dass ein derartig schummriger Piktorialismus dazu beitragen kann, dass gewisse Aspekte des historischen Materials unterbelichtet bleiben, aus dem Bildraum entweichen zugunsten einer idealisiterten Ursprungserzählung.
Diejenigen, um deren Befreiung es gehen soll, bleiben in "Lincoln" jedenfalls bloße Stichwortgeber - und zumindest der wiederholte rückversichernde Seitenblick liberaler, wohlmeinender Redner auf die vereinzelten schwarzen, stummen Gesichter auf der Ballustrade des Parlaments hat etwas Obszönes. Das verbindet "Lincoln" mit "Django Unchained", dem anderen großformatigen amerikanischen Historienfilm im aktuellen Kinoprogramm. Spielbergs und Tarantinos Geschichtstransformationen mögen ansonsten noch so unterschiedlich funktionieren, zueinander finden sie in poetischen Konstruktionen, in denen die Befreiung der schwarzen Amerikaner aus der Sklaverei vor allem Sache einer Handvoll weißer Edelakteure ist.
Es geht offensichtlich nicht um eine radikale Revision der Überlieferung, sondern um kleine, eher kosmetische als chirurgische Eingriffe in die Symbolpolitik: zum Beispiel hinsichtlich der längst überfälligen kinematografischen Rehabilitierung des von D.W. Griffiths "Birth of a Nation" nachhaltig diffamierten radikalen Sklavereigegners Thaddeus Stevens. Derart gezügelten Ambitionen zum Trotz: Qualitätskino ist nicht gleich Qualitätskino. Um das zu erkennen genügt ein Abgleich mit dem, was hierzulande angeboten wird, wenn gesellschaftliche Selbstverständigung via Blick in die Vergangenheit auf dem Programm steht. Das deutsche Qualitätsskino bindet seinen Großschauspielern Hakenkreuztücher an den Arm und lässt sie denselben anschließend zum Hitlergruß heben; das amerikanische klebt ihnen Bärte an, legt ihnen kluge Sätze über republikanische Ideale in den Mund und macht sie zu Gründungsvätern. Wenn man sich diese Differenz vor Augen führt, sieht man, was die Amerikaner noch immer an Spielberg und der Filmindustrie, für die er wie kein zweiter steht, haben, an einer Industrie, der es immerhin gelingt, aus einem zweieinhalbstündigen, äußerst dialoglastigen politischen procedural ein gut geöltes und alles in allem sehr integres Stück demokratiefreundliches Unterhaltungskino zu machen - und, wenn man sich das Einspielergebnis in den USA anschaut, sogar einen mittleren Blockbuster.
Lukas Foerster
Zero Dark Thirty - Regie: Kathryn Bigelow - Darsteller: Jessica Chastain, Jason Clarke, Kyle Chandler, Jennifer Ehle, Edgar Ramirez,Reda Kateb, Harold Perrineau Jr., Fares Fares, Scott Adkins, Mark Strong, Fredric Lehne, Mark Duplass, James Gandolfini - Laufzeit: 157 min.
Lincoln - USA 2012 - Regie: Steven Spielberg - Darsteller: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-Levitt, Tommy Lee Jones, Jackie Earle Haley, James Spader, Walt Goggins, Jared Harris, Sally Field, John Hawkes, Lee Pace, David Strathairn, Michael Stuhlbarg - Laufzeit: 150 min.
Kommentieren