Magazinrundschau
Mehr Rot! Mehr Blau!
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
16.01.2018. Der New Yorker erkundet mit Alessandra Cerreti die wirksamste Waffe gegen die kalabrische Mafia. In HVG denk Agnes Heller über 1968 in Ungarn und dem Rest der Welt nach. In Clarin beobachtet der französische Philosoph François Soulages das Schauspiel der Demokratisierung der Fotografie. Der American Cinematographer gruselt sich mit den Farben des Kameramanns Luciano Tovoli. In Elet es Irodalom sucht Bela Tarr nach einer neuen Filmsprache der digitalen Cinematographie. Novinky begutachtet das Konzept des geplanten Sudetendeutschen Museums in München. Im Globe and Mail outet sich Margaret Atwood als Schlechte Feministin. Im Guardian ist Elif Shafak schockiert von der Frauenfeindlichkeit der Türkei unter Erdogan.
New Yorker (USA), 22.01.2018
 Für die aktuelle Ausgabe des New Yorker berichtet Alex Perry über die Arbeit der italienischen Staatsanwältin Alessandra Cerreti, die die kalabrische Mafia das Fürchten lehrt, indem sie die unterdrückten Frauen der Clans zu Kronzeuginnen macht: "Clan-Frauen haben der Familienehre zu dienen, als Teenager werden sie verheiratet, um Clan-Allianzen zu festigen. Frauen, die nicht gehorchen, werden geschlagen oder getötet, oft von den nächsten männlichen Angehörigen, ihre Körper werden verbrannt oder in Säure aufgelöst, damit die Schande verschwindet. Das tragische Leben der Ndrangheta-Frauen war lange bekannt, Staatsanwälte sahen aber ihren Nutzen nicht … Cerruti und ihr Team waren die Ausnahme. Sie glaubten daran, dass Frauen in einer kriminellen Organisation, die auf der Familie aufbaute, eine wichtige Rolle spielen. Ihre Aufgabe war es, die nächste Generation mit dem Glauben an das Schweigegebot und den Clan heranzuziehen. Ohne sie keine Ndrangheta … Als die Behörden endlich die Größe und die Macht der Ndrangheta erkannten, wurden Frauen zu Informantinnen … Doch der Staat versagte darin, ihre Aussagen auszuwerten, und statt sein eigenes Versagen zuzugeben, bewertete er die Aussagen als wertlos. Frauen wurden aus dem Zeugenschutzprogramm genommen. Sie wurden umgebracht. Cerreti aber blieb überzeugt von der Unzufriedenheit und der Bedeutung der Clan-Frauen."
Für die aktuelle Ausgabe des New Yorker berichtet Alex Perry über die Arbeit der italienischen Staatsanwältin Alessandra Cerreti, die die kalabrische Mafia das Fürchten lehrt, indem sie die unterdrückten Frauen der Clans zu Kronzeuginnen macht: "Clan-Frauen haben der Familienehre zu dienen, als Teenager werden sie verheiratet, um Clan-Allianzen zu festigen. Frauen, die nicht gehorchen, werden geschlagen oder getötet, oft von den nächsten männlichen Angehörigen, ihre Körper werden verbrannt oder in Säure aufgelöst, damit die Schande verschwindet. Das tragische Leben der Ndrangheta-Frauen war lange bekannt, Staatsanwälte sahen aber ihren Nutzen nicht … Cerruti und ihr Team waren die Ausnahme. Sie glaubten daran, dass Frauen in einer kriminellen Organisation, die auf der Familie aufbaute, eine wichtige Rolle spielen. Ihre Aufgabe war es, die nächste Generation mit dem Glauben an das Schweigegebot und den Clan heranzuziehen. Ohne sie keine Ndrangheta … Als die Behörden endlich die Größe und die Macht der Ndrangheta erkannten, wurden Frauen zu Informantinnen … Doch der Staat versagte darin, ihre Aussagen auszuwerten, und statt sein eigenes Versagen zuzugeben, bewertete er die Aussagen als wertlos. Frauen wurden aus dem Zeugenschutzprogramm genommen. Sie wurden umgebracht. Cerreti aber blieb überzeugt von der Unzufriedenheit und der Bedeutung der Clan-Frauen."Außerdem: Nicolas Niarchos fragt, was die USA noch immer im Jemen verloren haben. Adrian Chen berichtet, wie eine Satiresendung in Nigeria die Demokratie zu stärken versucht. Jill Lepore schickt einen Essay über Urheberrechte, Barbie und Feminismus. Dan Chiasson schreibt über die mit 24 Jahren gestorbene Dichterin Joan Murray. Lesen dürfen wir außerdem John Edgar Widemans Story "Writing Teacher".
Clarin (Argentinien), 13.01.2018
 Der französische Philosoph und Fotografietheoretiker François Soulages denkt im Interview mit Victoria Verlichak über die Beziehung von Fotografie und Schrift in einer mit Bildern gesättigten Welt nach: "Einem Bild gegenüber kann man innerlich nicht stumm bleiben. Auf dieser Unmöglichkeit, angesichts eines Bildes zu schweigen, beruht die Beziehung zwischen der Fotografie und, zunächst, dem Wort, dann dem Schreiben." Die neuen Technologien tragen seiner Ansicht nach nicht zu einer Demokratisierung der Fotografie bei: "Demokratisierung hat damit nichts zu tun, Demokratisierung bezieht sich auf die Demokratie. Was wir erleben, ist in jedem Fall bloß das Schauspiel einer Demokratie, das eine Ideologie für die aus dem System Ausgeschiedenen produziert. Diese Ideologie bringt sie dazu, etwas für Demokratisierung zu halten, was bloße Vermassung und Kommerzialisierung ist. Die Ästhetik der Fotografie muss zuallererst derlei naive Ideologien ausschalten, die einen daran hindern, darüber nachzudenken, was ein fotografisches Werk ist. Ein Werk ist in jedem Fall alles andere als eine Antwort auf eine Frage."
Der französische Philosoph und Fotografietheoretiker François Soulages denkt im Interview mit Victoria Verlichak über die Beziehung von Fotografie und Schrift in einer mit Bildern gesättigten Welt nach: "Einem Bild gegenüber kann man innerlich nicht stumm bleiben. Auf dieser Unmöglichkeit, angesichts eines Bildes zu schweigen, beruht die Beziehung zwischen der Fotografie und, zunächst, dem Wort, dann dem Schreiben." Die neuen Technologien tragen seiner Ansicht nach nicht zu einer Demokratisierung der Fotografie bei: "Demokratisierung hat damit nichts zu tun, Demokratisierung bezieht sich auf die Demokratie. Was wir erleben, ist in jedem Fall bloß das Schauspiel einer Demokratie, das eine Ideologie für die aus dem System Ausgeschiedenen produziert. Diese Ideologie bringt sie dazu, etwas für Demokratisierung zu halten, was bloße Vermassung und Kommerzialisierung ist. Die Ästhetik der Fotografie muss zuallererst derlei naive Ideologien ausschalten, die einen daran hindern, darüber nachzudenken, was ein fotografisches Werk ist. Ein Werk ist in jedem Fall alles andere als eine Antwort auf eine Frage." American Cinematographer (USA), 10.01.2018
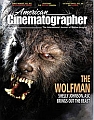 Nicht zuletzt aufgrund eines Verbots hierzulande war Dario Argentos 1977 veröffentlichter Horrorfilm "Suspiria" lange Zeit ein verfemter Film. Mittlerweile hat der Film seinen Weg in die Respektabilität gefunden und gilt vor allem auch wegen seiner stark gesättigten Primärfarben als Meisterwerk des spät-expressionistischen Films, der im harten Kontrast zum Realismus des Kinos der siebziger Jahre steht. Zu verdanken ist diese besondere Visualität auch dem Kameramann Luciano Tovoli, der zuvor für Antonioni gearbeitet hatte. Anlässlich einer aufwändigen Restauration des Films hat der American Cinematographer ein ausführliches, ursprünglich 2010 entstandenes Interview mit dem Regisseur aus dem Print-Archiv online gestellt: "Bei 'Beruf Reporter' ging es mir darum, starkes natürliches Licht zu erzwingen. Oft überbelichtete ich das Material, oft bis an die Grenze des sensometrischen Bereichs, was einige Details schluckt. In gewisser Hinsicht ging ich bei 'Suspiria' genauso vor, wobei ich das Material auf einem deutlich höheren Level überbelichtete, aber mittels der Intensität einer bestimmten Farbe in einer bestimmten Kameraeinstellung, während ich das Eastman5254-Negativ vorsichtig in der Mitte des sensometrischen Bereichs belichtete. Diese Technik nutzte ich in jeder Einstellung des Films. Ich sagte dem Produktionsdesigner und Setgestalter immer 'Mehr Rot! Mehr Blau!' Dasselbe riet ich meinem geduldigen Oberbeleuchter Alberto und, ganz der gute Freund, der er ist, fragte er zurück: 'Bist Du sicher? Da ist wirklich schon viel Grün im Bild. Langsam wird's verstörend.' Und als ich meine zuversichtliche Miene kein bisschen verzog, fragte er mich: 'Geht es Dir darum, gefeuert zu werden?'"
Nicht zuletzt aufgrund eines Verbots hierzulande war Dario Argentos 1977 veröffentlichter Horrorfilm "Suspiria" lange Zeit ein verfemter Film. Mittlerweile hat der Film seinen Weg in die Respektabilität gefunden und gilt vor allem auch wegen seiner stark gesättigten Primärfarben als Meisterwerk des spät-expressionistischen Films, der im harten Kontrast zum Realismus des Kinos der siebziger Jahre steht. Zu verdanken ist diese besondere Visualität auch dem Kameramann Luciano Tovoli, der zuvor für Antonioni gearbeitet hatte. Anlässlich einer aufwändigen Restauration des Films hat der American Cinematographer ein ausführliches, ursprünglich 2010 entstandenes Interview mit dem Regisseur aus dem Print-Archiv online gestellt: "Bei 'Beruf Reporter' ging es mir darum, starkes natürliches Licht zu erzwingen. Oft überbelichtete ich das Material, oft bis an die Grenze des sensometrischen Bereichs, was einige Details schluckt. In gewisser Hinsicht ging ich bei 'Suspiria' genauso vor, wobei ich das Material auf einem deutlich höheren Level überbelichtete, aber mittels der Intensität einer bestimmten Farbe in einer bestimmten Kameraeinstellung, während ich das Eastman5254-Negativ vorsichtig in der Mitte des sensometrischen Bereichs belichtete. Diese Technik nutzte ich in jeder Einstellung des Films. Ich sagte dem Produktionsdesigner und Setgestalter immer 'Mehr Rot! Mehr Blau!' Dasselbe riet ich meinem geduldigen Oberbeleuchter Alberto und, ganz der gute Freund, der er ist, fragte er zurück: 'Bist Du sicher? Da ist wirklich schon viel Grün im Bild. Langsam wird's verstörend.' Und als ich meine zuversichtliche Miene kein bisschen verzog, fragte er mich: 'Geht es Dir darum, gefeuert zu werden?'"Und hier die fantastischen ersten, von der Band Goblin unterlegten zwölf Minuten des Films, mitunter gedreht am Münchner Flughafen:
Elet es Irodalom (Ungarn), 12.01.2018
 Der Filmregisseur Béla Tarr ist seit seinem Rückzug vom Filmemachen (2012) als Hochschullehrer (für visuelle Künste) und als Jury-Mitglied bei diversen Filmfestivals viel unterwegs. Im Interview mit Eszter Rádai denkt er über die Bedeutung der digitalen Technologie für die visuellen Künste nach: "Leider wird nicht erkannt, dass die digitale Technologie auch eine neue Sprache ist. Sie wird verwendet wie eine Filmkamera, sie ist aber keine. Drei Jahre lang saß ich in Amsterdam in der Jury des Eye Film Instituts, (...) doch in diesen drei Jahren sah ich niemanden, der wirklich darüber nachgedacht hätte, was er in der Hand hält. Die visuellen Künste - das ist mein Eindruck - sind zutiefst verunsichert... Als wäre seit den sechziger Jahren oder eigentlich seit dem Fluxus in diesem Bereich nichts passiert. Sie benutzen den selben Pfad, drehen sich um dieselbe Achse, suhlen sich in demselben Pfuhl und erkennen nicht, dass sie ein neues Werkzeug mit fantastischen neuen Möglichkeiten in der Hand halten."
Der Filmregisseur Béla Tarr ist seit seinem Rückzug vom Filmemachen (2012) als Hochschullehrer (für visuelle Künste) und als Jury-Mitglied bei diversen Filmfestivals viel unterwegs. Im Interview mit Eszter Rádai denkt er über die Bedeutung der digitalen Technologie für die visuellen Künste nach: "Leider wird nicht erkannt, dass die digitale Technologie auch eine neue Sprache ist. Sie wird verwendet wie eine Filmkamera, sie ist aber keine. Drei Jahre lang saß ich in Amsterdam in der Jury des Eye Film Instituts, (...) doch in diesen drei Jahren sah ich niemanden, der wirklich darüber nachgedacht hätte, was er in der Hand hält. Die visuellen Künste - das ist mein Eindruck - sind zutiefst verunsichert... Als wäre seit den sechziger Jahren oder eigentlich seit dem Fluxus in diesem Bereich nichts passiert. Sie benutzen den selben Pfad, drehen sich um dieselbe Achse, suhlen sich in demselben Pfuhl und erkennen nicht, dass sie ein neues Werkzeug mit fantastischen neuen Möglichkeiten in der Hand halten."New Statesman (UK), 14.01.2018
 Regierungen sind frustriert, die Internet-Konzerne desinteressiert, und Peter Pomerantsev muss feststellen, dass es auch mit langwierigsten Recherchen unmöglich ist, den Hackern, Trollen und Botnets beizukommen, die mit ihren Kampagnen für Rechtspopulisten, den Kreml oder den IS die Öffentlichkeit vergiften und Stimmung gegen die westlichen Demokratien machen. Noch unbehaglicher wird ihm mit David Patrikarakos' Buch "War in 140 Characters": "Er macht uns mit den Leuten an der Front der digitalen Kämpfe bekannt, den Menschen hinter den Internet-Konten: russische Trolle mit Schuldgefühlen, vom IS online angeworbene junge Frauen, Facebook-Detektive, die Putins Lügen aus den Schlafzimmern ihrer englischen Vororte entlarven. Das sind allerdings nicht bloße Touristen im Informationskrieg. Patrikarakos hat eine provokante These: Er glaubt, dass Soziale Medien sowohl den Nationalstaat als auch den Krieg transformieren. Wir können nicht mehr davon sprechen, dass eine Nation eine andere durch Propaganda bekämpft: Auf dem Feld wimmelt es von einzelnen Akteuren, jeder ein kleiner Propagandastaat für sich. In dieser postnationalen Landschaft ist auch die Idee des Kriegs verändert. Es gibt keine klare Trennung mehr zwischen Krieg und Frieden, diese Vorstellung gehört zu einer Logik internationaler Beziehungen, nach der allein Nationen über die Autorität verfügen, einen Krieg zu erklären und Frieden zu schließen. Stattdessen gibt es ein Knäuel von Spannungen, unentwirrbar und voller Ungewissheiten."
Regierungen sind frustriert, die Internet-Konzerne desinteressiert, und Peter Pomerantsev muss feststellen, dass es auch mit langwierigsten Recherchen unmöglich ist, den Hackern, Trollen und Botnets beizukommen, die mit ihren Kampagnen für Rechtspopulisten, den Kreml oder den IS die Öffentlichkeit vergiften und Stimmung gegen die westlichen Demokratien machen. Noch unbehaglicher wird ihm mit David Patrikarakos' Buch "War in 140 Characters": "Er macht uns mit den Leuten an der Front der digitalen Kämpfe bekannt, den Menschen hinter den Internet-Konten: russische Trolle mit Schuldgefühlen, vom IS online angeworbene junge Frauen, Facebook-Detektive, die Putins Lügen aus den Schlafzimmern ihrer englischen Vororte entlarven. Das sind allerdings nicht bloße Touristen im Informationskrieg. Patrikarakos hat eine provokante These: Er glaubt, dass Soziale Medien sowohl den Nationalstaat als auch den Krieg transformieren. Wir können nicht mehr davon sprechen, dass eine Nation eine andere durch Propaganda bekämpft: Auf dem Feld wimmelt es von einzelnen Akteuren, jeder ein kleiner Propagandastaat für sich. In dieser postnationalen Landschaft ist auch die Idee des Kriegs verändert. Es gibt keine klare Trennung mehr zwischen Krieg und Frieden, diese Vorstellung gehört zu einer Logik internationaler Beziehungen, nach der allein Nationen über die Autorität verfügen, einen Krieg zu erklären und Frieden zu schließen. Stattdessen gibt es ein Knäuel von Spannungen, unentwirrbar und voller Ungewissheiten." Novinky.cz (Tschechien), 15.01.2018

Der Entwurf von pmp Architekten für das Sudetendeutsche Museum. Bild: pmp
Jan Šícha hat sich über das Entstehen und die zukünftigen Ausstellungen des Sudetendeutschen Museums in München informiert, das im September seine Pforten öffnen wird, und berichtet darüber aus tschechischer Sicht: "Zu verschiedenen Zeiten wurde je nach Sprachgruppe eine etwas oder komplett andere Geschichte über die gleiche Heimat erzählt. Im 21. Jahrhundert und in der Europäischen Union lässt sich von den Unterschieden im tschechischen und deutschen Erzählen profitieren. Was früher konfliktreich war, ist heute lehrreich. (…) Wäre das Sudetendeutsche Museum vor zwanzig Jahren entstanden, würde sein Hauptthema sicher die Vertreibung sein. Auch hätte man wohl auf einer symbolischen und moralischen Ebene über die Tschechen zu siegen versucht. Doch die Zeiten haben sich geändert. Die Sudetendeutschen haben ihr historisches Erzählen modernisiert. Sie möchten als besonders kreative Gemeinschaft mit einer eigenen Kultur wahrgenommen werden und vor allem die deutsche Gesellschaft ansprechen, die sie aufgenommen hat. Heute, nachdem die meisten, für die die Vertreibung ein lebenslanges Trauma war, nicht mehr da sind, entsteht hier ein Museum, das im deutschen Kontext als Ort fungieren wird, in dem die Kultur einer von vielen Gruppen vorgestellt wird, deren Wurzeln außerhalb des gegenwärtigen Deutschlands liegen."
New York Review of Books (USA), 18.01.2018
 Es lohnt sich immer, Daniel Ellsberg zu lesen. Der Mann hat in seiner Zeit bei der Rand Corporation ungeheuer viel mitbekommen und ist einfach verdammt intelligent. Was Ellsberg in seinem Buch "The Doomsday Machine" über Geheimhaltungsstufen, verrückte Generäle und die atomaren Strategien von Pentagon und Weißem Haus berichtet, hat Thomas Powers schier umgehauen. Besonders gruselig findet er die Kubakrise, bei der das Exekutivkomitee des Nationalen Sicherheitsrats auf Konfrontation setzte, obwohl ein Krieg nicht in Chruschtschows Sinn liegen konnte: "Das Exekutivkomitee hatte eine Politik betrieben, die seiner eigenen Einschätzung nach mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu zehn zu einem Atomkrieg führen konnte, mit Hunderten von Millionen von Toten. Das ist der entscheidende Punkt an 'Doomsday Machine' und das, was wir von Ellsberg lernen müssen: Anständige Menschen, mutig, intelligent und mit einem aufrichtigen Horror vor dem Krieg, waren bereit, sich bei einer Chance von eins zu zehn auf ein Spiel einzulassen, das Hunderte von Millionen Menschen das Leben kosten könnte. Wofür? 'Ich werde offen sein', sagte der Verteidigungsminister Robert McNamara bei einem frühen Treffen während der Krise zu Präsident Kennedy. 'Ich glaube nicht, dass wir ein militärisches Problem haben ... Wir haben ein innenpolitisches'. McNamara meinte damit, dass sowjetische Raketen in Kuba schlimm aussehen könnten, aber nicht wirklich das militärische Gleichgewicht veränderten. Vielmehr könnten sie so schlimm aussehen - wie er nicht zu sagen brauchte - dass Kennedy die nächsten Wahlen verlieren könnte. Dieser Punkt wurde in all den Jahrzehnten seit 1962 für Ellsberg immer bedeutender. Welche Hoffnung kann es langfristig geben, wenn Präsidenten oder andere Politiker willens sind, so viele Menschen zu töten, um die nächste Wahl zu gewinnen?"
Es lohnt sich immer, Daniel Ellsberg zu lesen. Der Mann hat in seiner Zeit bei der Rand Corporation ungeheuer viel mitbekommen und ist einfach verdammt intelligent. Was Ellsberg in seinem Buch "The Doomsday Machine" über Geheimhaltungsstufen, verrückte Generäle und die atomaren Strategien von Pentagon und Weißem Haus berichtet, hat Thomas Powers schier umgehauen. Besonders gruselig findet er die Kubakrise, bei der das Exekutivkomitee des Nationalen Sicherheitsrats auf Konfrontation setzte, obwohl ein Krieg nicht in Chruschtschows Sinn liegen konnte: "Das Exekutivkomitee hatte eine Politik betrieben, die seiner eigenen Einschätzung nach mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu zehn zu einem Atomkrieg führen konnte, mit Hunderten von Millionen von Toten. Das ist der entscheidende Punkt an 'Doomsday Machine' und das, was wir von Ellsberg lernen müssen: Anständige Menschen, mutig, intelligent und mit einem aufrichtigen Horror vor dem Krieg, waren bereit, sich bei einer Chance von eins zu zehn auf ein Spiel einzulassen, das Hunderte von Millionen Menschen das Leben kosten könnte. Wofür? 'Ich werde offen sein', sagte der Verteidigungsminister Robert McNamara bei einem frühen Treffen während der Krise zu Präsident Kennedy. 'Ich glaube nicht, dass wir ein militärisches Problem haben ... Wir haben ein innenpolitisches'. McNamara meinte damit, dass sowjetische Raketen in Kuba schlimm aussehen könnten, aber nicht wirklich das militärische Gleichgewicht veränderten. Vielmehr könnten sie so schlimm aussehen - wie er nicht zu sagen brauchte - dass Kennedy die nächsten Wahlen verlieren könnte. Dieser Punkt wurde in all den Jahrzehnten seit 1962 für Ellsberg immer bedeutender. Welche Hoffnung kann es langfristig geben, wenn Präsidenten oder andere Politiker willens sind, so viele Menschen zu töten, um die nächste Wahl zu gewinnen?" Linkiesta (Italien), 15.01.2018
 Fällt denn niemandem was auf, fragt Fulvio Scaglione in einem kleinen Essay: Da ist die Parallele zwischen den Protesten im Iran und den Protesten in Tunesien. Aber das eine Land ist eine finstere religiöse Diktatur und das andere eine Demokratie. Wo ist die Gemeinsamkeit? "Dreißig Prozent der Bevölkerung im Nahen und Mittleren Osten sind weniger als dreißig Jahre alt. Wir sprechen hier von 110 bis 120 Millionen Menschen. Nach Angaben der Weltbank ist das Arbeitskräftepotenzial, das sich aus Arbeitenden und Stellensuchenden zusammensetzt, in den nordafrikanischen Ländern und im Mittleren Osten um 40 Prozent gestiegen, und bei den Stellensuchenden haben die Qualifizierten eine große Mehrheit. Der Kern des Problems ist die Jugend, jenseits des Geredes über Kopftücher und Bärte. Der tunesische Fall sollte zu denken geben. Das heute am meisten fortgeschrittene Land im Mittleren Osten, das sich auf dem Weg der Demokratie und des Säkularismus befindet, ist auch das Land, das die größte Zahl ausländischer Kämpfer des Islamischen Staates an der syrischen Front stellt: mehr als 7.000 bei einer Bevölkerung von nur 11 Millionen Einwohnern."
Fällt denn niemandem was auf, fragt Fulvio Scaglione in einem kleinen Essay: Da ist die Parallele zwischen den Protesten im Iran und den Protesten in Tunesien. Aber das eine Land ist eine finstere religiöse Diktatur und das andere eine Demokratie. Wo ist die Gemeinsamkeit? "Dreißig Prozent der Bevölkerung im Nahen und Mittleren Osten sind weniger als dreißig Jahre alt. Wir sprechen hier von 110 bis 120 Millionen Menschen. Nach Angaben der Weltbank ist das Arbeitskräftepotenzial, das sich aus Arbeitenden und Stellensuchenden zusammensetzt, in den nordafrikanischen Ländern und im Mittleren Osten um 40 Prozent gestiegen, und bei den Stellensuchenden haben die Qualifizierten eine große Mehrheit. Der Kern des Problems ist die Jugend, jenseits des Geredes über Kopftücher und Bärte. Der tunesische Fall sollte zu denken geben. Das heute am meisten fortgeschrittene Land im Mittleren Osten, das sich auf dem Weg der Demokratie und des Säkularismus befindet, ist auch das Land, das die größte Zahl ausländischer Kämpfer des Islamischen Staates an der syrischen Front stellt: mehr als 7.000 bei einer Bevölkerung von nur 11 Millionen Einwohnern."HVG (Ungarn), 03.01.2018
 Der Historiker Krisztián Ungváry veröffentlichte vor kurzem ein Buch über Verbindungen zur Kommunistischen Partei und Agententätigkeiten der Abgeordneten des ersten freigewählten Parlaments von Ungarn in 1990. Die Akten sind bis heute nicht oder nur eingeschränkt zugänglich, weil - so die Argumentation von Ungváry in der Wochenzeitschrift HVG - die Führungsriegen der Parteien diese seit der Wende bis heute innerhalb und außerhalb der eigenen Reihen für Erpressungen verwendeten. Über ein mögliches Ende der jetzigen Regierung denkt der Historiker ähnlich wie György Konrád letzte Woche. "Noch ist es für Orban nicht nötig, Oppositionspolitiker zu verhaften, doch seine Grundsätze sind mit denen Putins verwandt: das Parlament ist eine Kulisse, der Parlamentarismus und die Demokratie nur ein Schauspiel. Die Abgeordneten der Regierungspartei werden von einer Person ausgewählt und sie stimmen so homogen ab, wie es in der jüngeren ungarischen Geschichte seit den fünfziger Jahren noch nie der Fall war. Dennoch würde ich Ungarn nicht als Mafia-Staat bezeichnen, der Staat funktioniert wohl - als geschlossene Aktiengesellschaft."
Der Historiker Krisztián Ungváry veröffentlichte vor kurzem ein Buch über Verbindungen zur Kommunistischen Partei und Agententätigkeiten der Abgeordneten des ersten freigewählten Parlaments von Ungarn in 1990. Die Akten sind bis heute nicht oder nur eingeschränkt zugänglich, weil - so die Argumentation von Ungváry in der Wochenzeitschrift HVG - die Führungsriegen der Parteien diese seit der Wende bis heute innerhalb und außerhalb der eigenen Reihen für Erpressungen verwendeten. Über ein mögliches Ende der jetzigen Regierung denkt der Historiker ähnlich wie György Konrád letzte Woche. "Noch ist es für Orban nicht nötig, Oppositionspolitiker zu verhaften, doch seine Grundsätze sind mit denen Putins verwandt: das Parlament ist eine Kulisse, der Parlamentarismus und die Demokratie nur ein Schauspiel. Die Abgeordneten der Regierungspartei werden von einer Person ausgewählt und sie stimmen so homogen ab, wie es in der jüngeren ungarischen Geschichte seit den fünfziger Jahren noch nie der Fall war. Dennoch würde ich Ungarn nicht als Mafia-Staat bezeichnen, der Staat funktioniert wohl - als geschlossene Aktiengesellschaft."2018 wird ein Erinnerungsjahr an die Ereignisse von 1968. Die Philosophin Ágnes Heller eröffnet mit einem Essay die Erinnerungsreihe. "Die neue Linke war vielleicht die erste globale Bewegung, von Frankreich bis Mexico, von Amerika bis Japan. Auf ihren Hauptstationen war sie stets mit grundsätzlichen politischen Zielen verbunden. (...) Bei uns in Ungarn fehlte der direkte politische Bezug, doch es gab andere Auswirkungen. Die alternativen Theater sind entstanden, die ersten Beatgruppen wurden populär und auch die Filme von Miklós Jancsó spiegelten die Idee der neuen Linken wider. Kurz: das junge ungarische intellektuelle Leben wurde im Zuge der neuen Linken 'westlich', zeitgemäß, europäisch. Letztendlich wurden die Teilnehmer der neulinken Revolution enttäuscht, aber anders als die Reformer des real existierenden Sozialismus. Letzterer hinterließ nur Katzenjammer und Unbehagen. Der Glaube daran wurde beschämend. Jene aber die sich von den neulinken Bewegungen von 1968 enttäuscht fühlen, können sich immer noch an ihren Glauben und ihre Grundsätze erinnern - ohne Scham und mit ein wenig Nostalgie."
Globe and Mail (Kanada), 13.01.2018
 In einem ziemlich gepfefferten Artikel antwortet die Schriftstellerin Margaret Atwood ihren Kritikerinnen, die sie zu einer Schlechten Feministin erklärt haben. Hintergrund des Streits unter Kanadas Frauen ist eine Petition, in der sich Atwood für die Rechte eines Mannes einsetzt, der vom Vorwurf sexueller Belästigung freigesprochen, aber trotzdem - nach einem extrem unfairen Verfahren - von seinem Arbeitgeber, der British Columbia University, entlassen wurde. Atwood fürchtet, dass diese extreme "schuldig bei Anklage"-Haltung die Frauenbewegung spalten wird: "Die #metoo-Bewegung ist Symptom für ein fehlerhaftes Justizsystem. Viel zu häufig wurden die, die sich über sexuellen Missbrauch beschwerten, in den Institutionen und Firmen nicht gehört. Also benutzen sie ein neues Instrument: das Internet. Sterne fielen vom Himmel. Das war sehr effektiv und wurde als massiver Weckruf gewertet. Aber was nun? Das Justizsystem kann repariert werden oder die Gesellschaft kann es aussetzen. Was tritt dann an seine Stelle? Nicht Schlechte Feministinnen wie ich. Wir sind weder für die Rechte noch für die Linke akzeptabel. In Zeiten des Extremismus gewinnen die Extremisten. Ihre Ideologie wird zur Religion, jeder der ihre Ansichten nicht teilt, wird als Apostat, Häretiker oder Verräter angesehen, die Moderaten in der Mitte werden ausgeschaltet. Schriftsteller sind besonders suspekt, weil sie über Menschen schreiben und Menschen sind moralisch zweideutig. Das Ziel der Ideologie ist es, Zweideutigkeit zu eliminieren."
In einem ziemlich gepfefferten Artikel antwortet die Schriftstellerin Margaret Atwood ihren Kritikerinnen, die sie zu einer Schlechten Feministin erklärt haben. Hintergrund des Streits unter Kanadas Frauen ist eine Petition, in der sich Atwood für die Rechte eines Mannes einsetzt, der vom Vorwurf sexueller Belästigung freigesprochen, aber trotzdem - nach einem extrem unfairen Verfahren - von seinem Arbeitgeber, der British Columbia University, entlassen wurde. Atwood fürchtet, dass diese extreme "schuldig bei Anklage"-Haltung die Frauenbewegung spalten wird: "Die #metoo-Bewegung ist Symptom für ein fehlerhaftes Justizsystem. Viel zu häufig wurden die, die sich über sexuellen Missbrauch beschwerten, in den Institutionen und Firmen nicht gehört. Also benutzen sie ein neues Instrument: das Internet. Sterne fielen vom Himmel. Das war sehr effektiv und wurde als massiver Weckruf gewertet. Aber was nun? Das Justizsystem kann repariert werden oder die Gesellschaft kann es aussetzen. Was tritt dann an seine Stelle? Nicht Schlechte Feministinnen wie ich. Wir sind weder für die Rechte noch für die Linke akzeptabel. In Zeiten des Extremismus gewinnen die Extremisten. Ihre Ideologie wird zur Religion, jeder der ihre Ansichten nicht teilt, wird als Apostat, Häretiker oder Verräter angesehen, die Moderaten in der Mitte werden ausgeschaltet. Schriftsteller sind besonders suspekt, weil sie über Menschen schreiben und Menschen sind moralisch zweideutig. Das Ziel der Ideologie ist es, Zweideutigkeit zu eliminieren."En attendant Nadeau (Frankreich), 09.01.2018
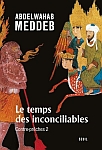 In Frankreich erscheint ein nachgelassener Band mit Essays und Interventionen von Abdelwahhab Meddeb. Marc Lebiez bewundert, wie differenziert sich bis heute Meddebs Ablehnung kulturalistischer Diskurse liest: "Im Grunde sagt er sinngemäß, dass die Islamisten vor allem unkultiviert sind. Sie ignorieren jegliche islamische Tradition, denn im ersten Jahrhundert der Hedschra beispielsweise sang und tanzte man in Medina: 'In mondänen, teils von Frauen betriebenen Salons, fanden Gesangs- und Tanzveranstaltungen statt, die Stimmen und Körper singender und tanzender Frauen verstießen vielleicht gegen die Regeln der 'awra, was jedoch bis zum Tod des Propheten toleriert wurde'. Sich auf Toleranz zu berufen ist daher keine Verwestlichung des Islam, sondern die Anknüpfung an einen Teil seiner Tradition, welche die Salafisten und Wahabisten ignorieren. Die zweite Form der Unkultiviertheit besteht darin …, diese noble Mystik vergessen zu machen, die sich nicht damit beschäftigt, anderen einen religiösen Zwang aufzuerlegen, sondern danach strebt, die Glaubensanhänger zu bereichern."
In Frankreich erscheint ein nachgelassener Band mit Essays und Interventionen von Abdelwahhab Meddeb. Marc Lebiez bewundert, wie differenziert sich bis heute Meddebs Ablehnung kulturalistischer Diskurse liest: "Im Grunde sagt er sinngemäß, dass die Islamisten vor allem unkultiviert sind. Sie ignorieren jegliche islamische Tradition, denn im ersten Jahrhundert der Hedschra beispielsweise sang und tanzte man in Medina: 'In mondänen, teils von Frauen betriebenen Salons, fanden Gesangs- und Tanzveranstaltungen statt, die Stimmen und Körper singender und tanzender Frauen verstießen vielleicht gegen die Regeln der 'awra, was jedoch bis zum Tod des Propheten toleriert wurde'. Sich auf Toleranz zu berufen ist daher keine Verwestlichung des Islam, sondern die Anknüpfung an einen Teil seiner Tradition, welche die Salafisten und Wahabisten ignorieren. Die zweite Form der Unkultiviertheit besteht darin …, diese noble Mystik vergessen zu machen, die sich nicht damit beschäftigt, anderen einen religiösen Zwang aufzuerlegen, sondern danach strebt, die Glaubensanhänger zu bereichern." Guardian (UK), 13.01.2018
 Nie ging es in der Türkei Journalisten, Schriftstellern, Akademikern und Frauen so schlecht wie heute, stellt die türkisch-britische Schriftstellerin Elif Shafak fest: Autoritarismus, Nationalismus, Isolationismus und Sexismus nehmen stetig zu und befeuern sich gegenseitig: "Häusliche Gewalt nimmt mit einem erschreckenden Tempo zu und die Regierung tut nichts, um betroffenen Frauen Unterkunft zu geben. Die Rhetorik der Regierung versteift sich auf die Heiligkeit von Ehe und Mutterschaft. Unter der AKP sind Frauenrechte dahingeschmolzen, während islamistische Zeitungen gegen Frauenhäuser wettern und einige Organisationen lancieren schon Petitionen, nach denen Frauen im Zug in eigenen Waggons reisen sollen. In einigen Städten gibt es schon pinkfarbene Busse nur für Frauen. Die Trennung der Geschlechter wird weder sexuelle Belästigung vermindern noch die Gewalt stoppen. 'Wenn Frauen zur Polizei oder Staatsanwaltschaft gehen, dann werden sie nach Hause zurückgeschickt, sollen sich versöhnen oder bekommen eine Schutzorder auf Papier', sagt Gulsum Kav von der Organisation We will Stop Femicide. Ebenso alarmierend sind die Veränderungen im Bildungssystem: Im neuen Curriculum wird der Darwinismus nicht mehr gelehrt."
Nie ging es in der Türkei Journalisten, Schriftstellern, Akademikern und Frauen so schlecht wie heute, stellt die türkisch-britische Schriftstellerin Elif Shafak fest: Autoritarismus, Nationalismus, Isolationismus und Sexismus nehmen stetig zu und befeuern sich gegenseitig: "Häusliche Gewalt nimmt mit einem erschreckenden Tempo zu und die Regierung tut nichts, um betroffenen Frauen Unterkunft zu geben. Die Rhetorik der Regierung versteift sich auf die Heiligkeit von Ehe und Mutterschaft. Unter der AKP sind Frauenrechte dahingeschmolzen, während islamistische Zeitungen gegen Frauenhäuser wettern und einige Organisationen lancieren schon Petitionen, nach denen Frauen im Zug in eigenen Waggons reisen sollen. In einigen Städten gibt es schon pinkfarbene Busse nur für Frauen. Die Trennung der Geschlechter wird weder sexuelle Belästigung vermindern noch die Gewalt stoppen. 'Wenn Frauen zur Polizei oder Staatsanwaltschaft gehen, dann werden sie nach Hause zurückgeschickt, sollen sich versöhnen oder bekommen eine Schutzorder auf Papier', sagt Gulsum Kav von der Organisation We will Stop Femicide. Ebenso alarmierend sind die Veränderungen im Bildungssystem: Im neuen Curriculum wird der Darwinismus nicht mehr gelehrt."Walrus Magazine (Kanada), 16.01.2018
 Die Meeresbiologin Laura McDonnel von der McGill University in Montreal hat beschlossen, keinen Fisch mehr zu essen. Grund dafür sind zum einen falsche Etikettierungen in der Fischindustrie, weshalb Fischsorten falsch gelagert und verwertet werden und folglich Unverträglichkeiten oder Vergiftungen beim Konsumenten verursachen können. Gravierender findet sie jedoch das Mikroplastik, das mit den Fischen auf unseren Tellern landet: "Der große pazifische Müllstrudel, eine Strömung, in der der größte Teil des im Pazifik entsorgten Mülls endet, ist auf Fotos meist als eine beständig vor sich hin treibende Müllinsel zu erkennen. Dabei ist ein Großteil der Plastikabfälle eigentlich eine Anhäufung winziger Partikel, die sich mit der Zeit von größeren Plastikteilen lösen und als Mikroplastik bekannt sind. Das den pazifischen Müllstrudel umgebende Wasser ist von Mikroplastikteilchen getrübt und größere, lose Plastikstücke treiben nahe der Insel oder sinken unter die Oberfläche, wo sie Unterwassermüllberge bilden. Im Unterschied zu der einen riesigen und erkennbaren Müllinsel ist Mikroplastik überall."
Die Meeresbiologin Laura McDonnel von der McGill University in Montreal hat beschlossen, keinen Fisch mehr zu essen. Grund dafür sind zum einen falsche Etikettierungen in der Fischindustrie, weshalb Fischsorten falsch gelagert und verwertet werden und folglich Unverträglichkeiten oder Vergiftungen beim Konsumenten verursachen können. Gravierender findet sie jedoch das Mikroplastik, das mit den Fischen auf unseren Tellern landet: "Der große pazifische Müllstrudel, eine Strömung, in der der größte Teil des im Pazifik entsorgten Mülls endet, ist auf Fotos meist als eine beständig vor sich hin treibende Müllinsel zu erkennen. Dabei ist ein Großteil der Plastikabfälle eigentlich eine Anhäufung winziger Partikel, die sich mit der Zeit von größeren Plastikteilen lösen und als Mikroplastik bekannt sind. Das den pazifischen Müllstrudel umgebende Wasser ist von Mikroplastikteilchen getrübt und größere, lose Plastikstücke treiben nahe der Insel oder sinken unter die Oberfläche, wo sie Unterwassermüllberge bilden. Im Unterschied zu der einen riesigen und erkennbaren Müllinsel ist Mikroplastik überall." Buzzfeed (USA), 27.12.2017
 Wie "rechts" die Rechten, die ja meist von den Linken so einsortiert werden, wirklich sind, ist immer so eine Frage. Alain de Benoist ist nicht nur Erfinder des Begriffs der "Neuen Rechten", sondern auch des Begriffs des Ethnopluralismus, der sich vom linken Multikulturalismus nur in dem einen Punkt unterscheidet, dass die Blasen räumlich getrennt sein sollen. Auch de Benoist will ein "Recht auf Differenz" und will starke Identitäten, zwischen denen keine Hierarchie besteht. "Heute sieht er sich eher als links, denn als rechts", schreiben J. Lester Feder und Pierre Buet in einem interessanten Porträt des Autors, auf den sich auch die amerikanischen Anführer der extremen Rechten wie Stephen Bannon und Richard Spencer beziehen. "Wenn er 2016 bei den US-Wahlen hätte wählen können, hätte er für Bernie Sanders gestimmt. Seine erste Wahl in der französischen Wahl war der dezidiert linke Jean-Luc Mélenchon. Er weist jede Verbindung zwischen der Neuen Rechten und der alt-right-Bewegung zurück, die Donald Trump unterstützte…" Die Autoren betonen auch, dass "es nicht die extreme Rechte war, die Benoists Texte in die Vereinigten Staaten brachte. Eine linke Zeitschrift namens Telos, die sich für Benoists Kritik der amerikanischen Außenpolitik interessierte, publizierte in den Neunzigern erste Texte von ihm. Telos übersetzte auch sein 'Manifest für eine europäische Renaissance', in dem er seine als Ethnopluralismus bekannt gewordene Philosophie begründete."
Wie "rechts" die Rechten, die ja meist von den Linken so einsortiert werden, wirklich sind, ist immer so eine Frage. Alain de Benoist ist nicht nur Erfinder des Begriffs der "Neuen Rechten", sondern auch des Begriffs des Ethnopluralismus, der sich vom linken Multikulturalismus nur in dem einen Punkt unterscheidet, dass die Blasen räumlich getrennt sein sollen. Auch de Benoist will ein "Recht auf Differenz" und will starke Identitäten, zwischen denen keine Hierarchie besteht. "Heute sieht er sich eher als links, denn als rechts", schreiben J. Lester Feder und Pierre Buet in einem interessanten Porträt des Autors, auf den sich auch die amerikanischen Anführer der extremen Rechten wie Stephen Bannon und Richard Spencer beziehen. "Wenn er 2016 bei den US-Wahlen hätte wählen können, hätte er für Bernie Sanders gestimmt. Seine erste Wahl in der französischen Wahl war der dezidiert linke Jean-Luc Mélenchon. Er weist jede Verbindung zwischen der Neuen Rechten und der alt-right-Bewegung zurück, die Donald Trump unterstützte…" Die Autoren betonen auch, dass "es nicht die extreme Rechte war, die Benoists Texte in die Vereinigten Staaten brachte. Eine linke Zeitschrift namens Telos, die sich für Benoists Kritik der amerikanischen Außenpolitik interessierte, publizierte in den Neunzigern erste Texte von ihm. Telos übersetzte auch sein 'Manifest für eine europäische Renaissance', in dem er seine als Ethnopluralismus bekannt gewordene Philosophie begründete."New York Times (USA), 10.01.2018

Margot Robbie als Tonya Harding in dem Film "I, Tonya"
In der Times versucht Taffy Brodesser-Akner das wahre Gesicht der ehemaligen amerikanischen Eiskunstläuferin Tonya Harding zu enthüllen, deren Leben gerade mit Margot Robbie in der Hauptrolle verfilmt wurde. Hardings Karriere endete 1994, als ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan im Auftrag von Hardings Ex-Mann, angeblich ohne Hardings Kenntnis mit einer Eisenstange am Knie verletzt wurde, so dass Harding die US-Meisterschaft gewann: "Sie glaubt, wenn die Medien sie damals nicht so niedergemacht hätten, stünde sie heute woanders. Wir würden staunen, was sie alles überstanden hätte. Der Film über sie hätte ein triumphales Ende wie 'Rocky'. Die internationalen Wettkampfrichter hatten sie immer geliebt, glaubt sie … Alles, was sie damals getan habe, sei doch nur eine Fortsetzung dessen gewesen, wofür man sie vorher immer belohnt hatte, ihre Rauheit, ihre Erfindungsgabe und Überlebenskunst. Hätte sie vielleicht nach den Regeln spielen und ihr Talent in ihrem außergewöhnlichen Körper einfach verrotten lassen sollen? Sie sagt, dass es Mädchen wie sie nirgendwohin führt, brav und fair zu sein. Hätte es geklappt, hätte sie als Inbegriff des Amerikanischen Traums gegolten … Vieles, was Harding mir erzählte, ist nicht wahr. Sie widersprach sich, aber sie erinnerte mich auch an so viele andere Traumatisierte, die ihre Geschichte wieder und wieder erzählen, um zu erklären, was ihnen widerfahren ist, aber auch, um es sich anzuverwandeln. Was sie sagte, war falsch, aber spirituell wahr, das heißt, es entsprach ihrer Vorstellung."
Kommentieren












