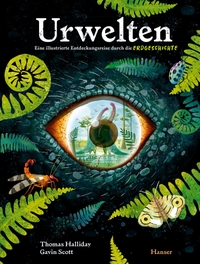Im Kino
Ganz kalter Krieg
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Elena Meilicke
01.02.2012. Regie führt Bennett Miller, die Hauptrolle übernimmt Brad Pitt, doch der eigentliche Star des postindividualistischen Sportfilms "Moneyball" ist der Drehbuchautor Aaron Sorkin. In Tomas Alfredson Le-Carre-Verfilmung "Dame, König, As, Spion" durchstreifen Agenten verwunschene alte Häuser mit knarrenden Dielen. Nie sahen die Siebziger mehr nach Fünfzigern aus.
Im Jahr 2002 gewannen die Oakland Athletics, ein seit langen Jahren erfolgloses, kleines Baseballteam aus Kalifornien, 20 Spiele in Folge und sorgten damit für eine Sensation: noch keinem Team war in 101 Jahren National League Baseball eine derartige Siegesserie geglückt. Um diese außergewöhnliche Leistung in einem hierzulande wenig bekannten Sport einordnen zu können, könnte man einen Fußballvergleich versuchen: Der Erfolg der Athletics entspräche ungefähr dem Durchmarsch eines unbekannten Provinzclubs, sagen wir der TSG 1899 Hoffenheim, von der Kreisklasse bis in die Spitzengruppe der Bundesliga. Nur, dass die Athletics ihren Siegeszug keinem milliardenschweren Gönner wie Dietmar Hopp zu verdanken hatten: Das Team gehörte auch in der Erfolgssaison zu den finanziell schwächeren der Liga.
"Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game" heißt das non-fiction-Buch von Michael Lewis über diese denkwürdige Saison und es beschreibt, wie den Athletics dank objektiver Marktwert- und statistischer Längsschnittanalysen etwas gelang, das selbst um ein vielfaches finanzstärkeren Teams unmöglich erschienen war. Drehbuchautor Aaron Sorkin, Produzent und Hauptdarsteller Brad Pitt sowie Regisseur Bennett Miller haben das Buch nun als Hollywoodfilm adaptiert.
Selbstverständlich muss ein Hollywoodfilm - und ein Sportfilm ganz besonders - eine derart abstrakte Erfolgsgeschichte personalisieren und das tut auch "Moneyball". Bis zu einem gewissen Grad, zumindest. Tatsächlich steht im Mittelpunk des Films Billy Bean (Pitt), der Manager der Athletics, der vor Beginn der Saison 2002, nachdem er gerade seine drei vermeintlich stärksten Spieler an die zahlungskräftigere Konkurrenz verloren hat, beschließt, mit den traditionellen Methoden des Scouting und des Baseball-Starsystems zu brechen. Er stellt als seinen Berater den jungen Ökonom Peter Brand (Jonah Hill) ein, mit dessen Hilfe er für wenig Geld und gegen den Widerstand seines Trainers (Philip Seymour Hoffman) und des gesamten Baseballestablishments ein Team zusammenkauft, das aus Lachnummern und Versagern zu bestehen scheint: Einer der Neuen hat Rückenprobleme und gilt schon fast als Sportinvalide, ein zweiter steht kurz vor der Pensionierung, ein dritter macht seit längerem nur noch mit Alkoholeskapaden auf sich aufmerksam. Aber, und das wissen zunächst nur Brand und Bean: Die Zahlen stimmen, das neue Team ist statistisch korrekt auf value for money optimiert.

Diese Konstellation unterscheidet den Film dann doch grundlegend von den unzähligen Mythen triumphierender Underdogs, die der amerikanische Sportfilm über die Jahrzehnte hervorgebracht hat und deren dramaturgischen Modellen auf den ersten Blick auch "Moneyball" zu gehorchen scheint. Aber dass der Erfolg der Athletics in seinem Kern nicht auf "Willensstärke", "Charakter" oder anderen im Individuum verankerten Kategorien basiert, sondern gerade auf einer Abstraktionsleistung von solchen Kategorien: Darüber täuscht der Film, bei allem Brimborium um Billy Beans Vergangenheit als erfolgloser Baseballprofi und seinen daraus resultierenden chronisch unbefriedigten Ehrgeiz, nicht hinweg.
Dennoch wird im (Miss-)Verhältnis zwischen Beans rührseliger Selbsttherapie und der eiskalten Kalkulation, mit deren Hilfe diese erst gelingt, eine entscheidende Bruchlinie in "Moneyball? sichtbar. Eine Bruchlinie, die auch die Autorenschaft des Films betrifft. Denn die Frage, wessen Film "Moneyball" ist, ist nicht so leicht zu beantworten. Der Film des Regisseurs Miller ist er zumindest schon einmal nicht. Bis auf das warme, braunlastige Farbschema hat "Moneyball" mit dessen Vorgängerwerk "Capote" glücklicherweise wenig gemein. Immerhin ist sein neuer Film etwas weniger trantütig inszeniert als jener erste Gehversuch. In den Baseballszenen versucht sich der Regisseur sogar an einigen außergewöhnlichen Kameraperspektiven. Viel wichtiger für die eigenartige Dynamik des Films scheinen aber zwei andere Mitglieder des Teams zu sein: Aaron Sorkin und Brad Pitt.
Sorkin, derzeit der vielleicht eigensinnigste Autor Hollywoods, war zuletzt mit dem Script des Facebook-Films "The Social Network" sein Meisterwerk (zumindest sein Meisterwerk fürs Kino - seine Politfernsehserie "The West Wing" bleibt nach wie vor unerreicht) gelungen. Für "Moneyball", einen weitaus weniger perfekten Film, stand ihm kein kongenialer Erfüllungsgehilfe wie der Regisseur David Fincher zur Seite - dafür aber der zu seinem eigenen Produzenten gewordene Hollywoodstar Pitt im Weg. Pitt versteht "Moneyball", das meint man zumindest an der stets allzu perfekt sitzenden Frisur seiner Figur, an einigen atmosphärischen, weichzeichnerverdächtigen Großaufnahmen und an seinem unmissverständlich auf den Oskar spekulierenden (nominiert ist er immerhin schon einmal) dezenten overacting ablesen zu können, als ein reines Starvehikel.

Das Drehbuch aber hat anderes im Sinn. Und mit Peter Brand hat Sorkin sich in gewissem Sinne einen Repräsentanten seiner Autorenposition ins Skript geschrieben. Der schüchterne Yale-Alumnus, der, ständig einen Kaffeebecher in der Hand, ein wenig Fehl am Platz wirkt, wo immer er auch steht, dezentriert den Film durch stures Beharren auf der Macht der rationalen, statistischen Analyse. Zwar ist die Brand-Figur durchaus auch ein Beleg für den nicht unproblemtaischen Elitismus, dem der Autor wieder und wieder das Wort redet (kein Sorkin-Skript ohne Ivy-League-Absolvent); doch wie schon der ihm bei all seiner Arroganz habituell nicht unähnliche, weil auf vergleichbare Weise sozial desintegriert (und: desintegrierend) wirkende Jesse Eisenberg als Mark Zuckerberg in "The Social Network", hat Brand im Film vor allem eine Funktion: Er etabliert ein System, das größer ist als er selbst - und als alle anderen Menschen, die es erschaffen und auf die es sich bezieht. Zuckerberg ist durchtrieben und rücksichtslos, aber lange nicht so durchtrieben und rücksichtslos wie Facebook. Und Brand mag ein Genie sein, so genial wie sein statistisches Modell, das den Profisport revolutioniert, ist er noch lange nicht. Zuckerberg und Brand sind in diesem Sinne postindividualistische Subjekte, die keinen Persönlichkeitskern mehr brauchen, sondern die sich Kraft ihrer Ratio in den systemischen Prozessen, die sie in Gang setzen, gewissermaßen selbst entäußern. Und neben Zuckerberg und Brand sehen die Brad Pitts dieser Welt auf die Dauer eben doch alt aus.
Lukas Foerster
---

1973 hat im Moment Konjunktur. Es gibt ganze Konferenzen und Sammelbände, die sich ausschließlich diesem einen Jahr widmen, das unter anderem Watergate und Ölschock, den Zusammenbruch von Bretton Woods und die Flexibilisierung der Wechselkurse gesehen hat. In den Fokus von Historikern rückt 1973 als ein Jahr, das die Welt mit zu dem gemacht hat, was sie heute ist - inklusive ihrer politischen, ökonomischen und sozialen Bruchlinien, ihrer Krisen und Aporien.
London 1973 ist auch der Schauplatz von "Dame, König, As, Spion" - aber die Frage, ob und was dieses 1973 mit der Gegenwart zu tun haben könnte, stellt der Film leider überhaupt nicht. Lieber erzählt Regisseur Tomas Alfredson nach der Romanvorlage John le Carres ein Märchen aus uralten Zeiten, eine Intrige aus einem ganz kalten Krieg. George Smiley (Gary Oldman), frühpensioniertes Mitglied des britischen Geheimdienstes MI 6, muss einen Verräter in den eigenen Reihen ausfindig machen, einen "mole" oder "Maulwurf", der dem Erzfeind Sowjetunion geheime Informationen zuspielt. Im Laufe seinen Ermittlungen sieht sich Smiley mit der Führungselite des MI 6 konfrontiert, einer kleinen Gruppe diabolischer Gentlemen, von denen jeder einzelne der gesuchte Doppelagent sein könnte. Die Visagen sind fies, die Blicke verstohlen und für die Schwerfälligeren unter den Zuschauern gibt's den Wink mit dem Paranoia-Zaunpfahl schon in der allerersten Dialogzeile: "You weren't followed? Trust no one."

"Dame, König, As, Spion" ist dabei perfektes Ausstattungskino mit größtem Stilwillen. Oft sieht man Smiley alte Häuser durchstreifen, mit knarrenden Dielen und verrümpelten Wohnzimmern, wo der Staub im fahlen Gegenlicht tänzelt. Das alles ist herrlich verwunschen und kommt in schmutzig-pastoser Farbpalette daher, mit viel gedecktem Grau, Grün und Braun. Komplettiert wird das visuelle Konzept des Films durch den exzessiven Einsatz langsam wabernder Zooms, die die Geheimdienst-Paranoia kameratechnisch ins Bild setzen. Doch während diese Bildgestaltung an vielen Stellen übereindeutig wirkt, bleibt das Drehbuch oft so vornehm zurückhaltend, dass man dem komplizierten Plot mit seinen Zeitsprüngen und der Unzahl an Protagonisten kaum folgen kann. Wer den Roman von John le Carre schon kennt, ist eindeutig im Vorteil, alle anderen sollten die Inhaltsangabe auf Wikipedia überfliegen. Ansonsten läuft man Gefahr, der schlussendlichen Enthüllung des Maulwurfs mit Indifferenz zu begegnen.
"Dame, König, As, Spion" schafft es nämlich nicht, seine Zuschauer wirklich für die Maulwurfsuche anno 1973 zu interessieren. Vielleicht ist es ein Anachronismus, der die Story vom britischen Verräter zu einer eher langwierig-belanglosen Affaire macht: "Dame, König, As, Spion" erzählt davon, wie sich britische Gentlemen angeblich in Kalter-Kriegs-Paranoia umschleichen, während doch zeitgleich jemand wie Horst Herold über Rasterfahnung und kybernetische Polizeiorganisation nachdenkt und während ebenfalls zeitgleich jemand wie Carlos als internationaler Terror-Söldner eine Revolution nach der anderen bedient (eine Geschichte, die Olivier Assayas vor kurzem im Kino erzählt hat). Horst Herold und Carlos sind zufällig gewählte Beispiele, markieren aber für die 70er eine politische Landschaft, die mit der granitenen Machtverteilung des Kalten Krieges nicht mehr viel zu tun hat und die folglich ganz andere Paranoia-Spielarten produzieren müsste, Paranoia-Spielarten, deren Arsenal eben nicht mehr in kommunistischen Verrätern und höhlenartigen Häusern mit knarrenden Dielen bestünde.
Vielleicht hätte Tomas Alfredson einfach mal einen Blick auf das Paranoia-Kino werfen sollen, das die 70er Jahre selbst hervorgebracht haben; etwa auf Alan Pakulas "All the President?s Men" von 1976, wo der Watergate-Wahnsinn in gleißend hellen Sets unter Neonlicht verhandelt wird. "Dame, König, As, Spion" jedenfalls lässt 1973 ziemlich alt aussehen.
Elena Meilicke
Die Kunst zu gewinnen - Moneyball - USA 2011 - Originaltitel: Moneyball - Regie:Bennett Miller - Darsteller: Brad Pitt, Jonah Hill, Ken Medlock, Philip Seymour Hoffman, Chris Pratt, Kerris Dorsey, Robin Wright, Stephen Bishop, Brent Jennings - Länge: 133 min.
Dame, König, As, Spion - Großbritannien 2011 - Originaltitel: Tinker, Tailor, Soldier, Spy - Regie: Tomas Alfredson - Darsteller: Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, Mark Strong, John Hurt, Toby Jones - Prädikat: besonders wertvoll - Länge: 127 min.
Kommentieren