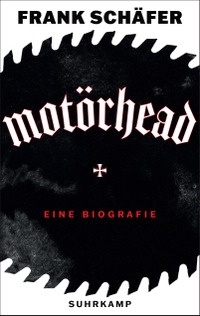Im Kino
Der richtige Gebrauch des Raums
Die Filmkolumne. Von Nikolaus Perneczky
19.08.2014. Lav Diaz reflektiert in "From What Is Before" die philippinische Gewaltgeschichte und nimmt sich dafür sehr viel Zeit. Auch die anderen in Locarno ausgezeichneten Filme haben sich als sehenswert erwiesen.Lav Diaz hat den Goldenen Leoparden für seinen Film "Mula sa kung ano ang noon / From What Is Before" zurecht bekommen. Die politischen Ereignisse der frühen 1970er Jahre, als der philippinische Präsident Ferdinand Marcos das gesamte Land unter Kriegsrecht stellte, werden darin aus der randständigen Perspektive eines entlegenen Inseldorfs eingeholt. Bis die Regierungstruppen das Dorf erreichen, werden mehrere der insgesamt fünfeinhalb Stunden Laufzeit vergangen sein. Von der kommunistischen Bedrohung, die zu Marcos" Militärregime den Vorwand lieferte, ist bis zuletzt nichts zu sehen. Wie schon Lino Brocka, in seinem thematisch verwandten Klassiker "Orapronobis" von 1989 (der nicht den Anfang, sondern das langwierige Ende der Diktatur behandelt), belässt auch Diaz die Guerilla der New People"s Army konsequent im Off, während die paramilitärischen Bürgerwehren, die Marcos für seine Sache rekrutierte, den Bildraum in ihre gleichermaßen beiläufige wie exzessive Gewalt bringen.

Lav Diaz: From What Is Before
"Orapronobis" war, als filmische Intervention in laufende Vorgänge, von einer fiebrigen Dringlichkeit. Der Geschichtsfilm "From What Is Before" hat seine intensiven Momente, dazwischen aber nimmt sich Diaz, wie es seine Art ist, viel Zeit: für Arbeitsvorgänge, religiöse Verrichtungen, Mahlzeiten, Leerlauf, vor allem aber für das gemessene Durchschreiten weiter Landschaften - für die ereignisleeren Passagen zwischen den prägnanten Augenblicken. Parallel zum erst unmerklichen, dann aber rasch eskalierenden Einbruch der Historie in die enthobene Zeitrechnung der Dorfgemeinschaft verschiebt sich auch die Erzählweise. Wo anfangs nur Andeutungen und Rätsel waren - wer hat die massakrierten Rinder auf dem Gewissen? - macht sich später das fast didaktische Idiom einer Geschichtsstunde breit.
Wie die größere Geschichte der Philippinen die vielen kleinen Dorfgeschichten mit sich reißt, das ist der große Bogen, den "From What Is Before" aufspannt. Stets aber wird dieser Bogen durchkreuzt von Diaz" Ästhetik der Dauer: Jede der minutenlangen Einstellungen lädt dazu ein, sich in ihr zu verlieren, sodass die konkrete Erfahrung von Dauer das imaginäre (nicht anschaulich gegebene) Ganze - des Films, der Nation, der Geschichte - beständig infrage stellt.
Die Auszeichnung für die beste Regie, auch sie eine gute Wahl, ging an Pedro Costa für "Cavalo Dinheiro". Ventura, eine wiederkehrende Zentralfigur im Werk des Regisseurs, findet sich in einem Krankenhaus wieder. Halbnackt streift er durch dunkle Korridore, während der Verputz von den Wänden blättert. Erst meint man, die Zeit stünde still in dieser Anstalt, tatsächlich ist sie aus den Fugen geraten: Die teils biografischen, teils zeitgeschichtlichen Bruchstücke, die sich in der Begegnung mit anderen Patienten - oder sind es Insassen? - aktualisieren, datieren zurück auf Venturas Jugend auf Kap Verde und die frühen Jahre in Lissabon, wo er, der andere Sorgen hat, kein rechtes Verhältnis findet zu entscheidenden Umwälzungen wie der Nelkenrevolution.
In einem Aufzug steckengeblieben, wird Ventura von einem portugiesischen Soldaten, einem Kämpfer gegen die Diktatur, heimgesucht, der ihn dazu drängt, sich zur guten Sache zu bekennen. Der Soldat, reglos und von einer bronzenen Tönung überzogen, sieht aus wie einer jener Straßenkünstler, denen man in europäischen Großstädten seit einigen Jahren überall begegnet. Bewegen kann er sich nur dann, wenn die Kamera nicht hinsieht; seine Rede, ein halb entkörperlichtes voice-over, tönt wie aus einer anderen Welt. Den Gegenpol zu dieser allegorischen Gestalt bildet eine namentlich genannte Frau, die ihren Mann betreffende Polizeiprotokolle verliest. Ihr weinendes Gesicht in Großaufnahme suggeriert eine persönliche Lesart von Geschichte. In engen Grenzen gefangen, entfaltet "Cavalo Dinheiro" einen großen Formen- und Erfindungsreichtum - wenn es nur gelingt, sich auf die karge Schönheit und voraussetzungsreiche Mythologie des Films einzulassen.
"Listen Up Philip", Alex Ross Perrys dritter, mit dem Spezialpreis der Jury prämierter Langfilm, widmet sich einem jungen Mann an der Schwelle zu literarischem Ruhm, der nicht zufällig Vorname und Konfession mit dem Great American Novelist Philip Roth teilt. Jason Schwartzman gegenüber, der diesem eigentlich unerträglichen Narzissten das irritierend gefällige Gesicht leiht, steht Jonathan Pryce als alternder Schriftsteller Ike Zimmermann, noch so ein Roth-Wiedergänger, dessen Romane aus der Blütezeit der 1970er und achtziger Jahre Titel wie "Madness & Women" oder "Ample Profanity" tragen. Davon abgesehen erfährt man wenig Bestimmtes über diese Bücher, aber ihre Coverdesigns, kleine Pastiche-Meisterwerke, strahlen einen sofort wiedererkennbaren vergangenen Glanz aus, den auch die alles umgebende halblaute Ironie nicht vollständig verdunkeln kann.

Alex Ross Perry: Listen Up, Philip
Etwas Nostalgisches hat "Listen Up Philip" durchwegs, dem beißenden Tonfall zuwider, mit dem Perry den endgültigen Rückzug seines Protagonisten in die Egomanie abwickelt. So ausgesucht wie die Buchumschläge ist hier alles: Philips Brillengläser, die Inneneinrichtung von Ikes neuenglischer Schreibklause, die Garderobe von Philips Freundin Ashley, die sich sehr erfolgreich als Fotografin verdingt. Obwohl beide in wunderschöner 16mm-Körnung daherkommen: von Perrys lustvoll räudigem "The Color Wheel" (ironischerweiße in Schwarz-Weiß) zu den gedeckten Farben von "Listen Up Philip" ist es ein weiter Weg. Nicht zuletzt Schwartzmans grundsympathisches Nerdtum trägt dazu bei, die ätzende Sensibilität des Buchs (voller Rothsätze und -referenzen) zu verniedlichen. Dass "Listen Up Philip" trotzdem ein interessanter Film ist, verdankt sich Elizabeth Moss als Ashley.
In der allmählich sich verselbständigenden Plotlinie der Fotografin findet der Film einen Gegenpol zu den Seins- und Sprechweisen der männlichen Literaten. Wo Ike, bei einer Konfrontation mit seiner entfremdeten Tochter (auch toll: Krysten Ritter), im unsubtilen Schriftstellersprech über "the innate ineffability of human disappointment" schwadroniert, braucht Ashley wenig Worte, um alles zu sagen (vorgeblich über die schlecht gelaunte Katze, die sie sich nach der Trennung von Philip angeschafft hat): "He"s kind of an asshole, actually."
Mit unerwarteter Heftigkeit ist Park Jungbums "Alive" in den Wettbewerb eingeschlagen. Ein undurchsichtiger, körperlich dafür umso wuchtigerer Realismus waltet in diesem Film, der viele verständnisrelevante Details bewusst ausspart. Am Ende wird die Welt von "Alive" wiedererkennbare Züge angenommen haben: Gelegenheitsarbeiter im karg-gebirgigen Umland der südkoreanischen Hauptstadt auf der einen, die Bosse auf der anderen Seite. Der Weg zu dieser Milieubeschreibung - und zum finalen Kraftakt lumpenproletarischer Solidarität - ist alles andere als vorgezeichnet. Sehr langsam nur gelangt der Arbeiter Jungchul zu einem anderen Verständnis seiner Situation. Die "Bekehrung" - der unter die katholische Bevölkerung Südkoreas sich mischende Film wimmelt von christologischen Metaphern - ereilt ihn aber nicht allmählich, sondern blitzartig wie die Gnade bei Bresson oder bei den Dardennes. Von daher sind die torkelnden drei Stunden Laufzeit eigentlich nur ein Vorspiel zu der Epiphanie, mit der "Alive" schließt. In dem Maß, in dem die erzählerischen (und oft auch räumlichen) Zusammenhänge dieser Welt sich entziehen, ist man auf ihre Physis verwiesen, auf Selbstverstümmelung, schwere Arbeit, Panikattacken, ein intensives Theatervorsprechen und, als wiederkehrendes Bewegungsmotiv: Gerangel, Prügeleien und andere Streithändel bei vollem Körpereinsatz.
Bevor Jungchul eine Figur ist, ist er ein sturer Körper. In einer Szene rennt er, so oft er auch zurückgeworfen wird, wieder und wieder gegen eine Gruppe von Angreifern an. Neben solchen muscle memories bleiben von dem Film vor allem die kurzen Exkursionen in die Wohnräume der Ausbeuter in Erinnerung: Reptilien im Terrarium.
Ein veritabler Architekturfilm ist Eugène Greens "La sapienza", in dem es um den richtigen Gebrauch des Raums geht. Oft wähnt man sich in einem Manifest der Gegenmoderne: Rationalität, statistische Quantifizierung und Urbanismus kriegen alle ihr Fett ab. Am Ende sucht Green dann doch die Versöhnung der Gegensätze, von Licht und Dunkel, Anschauung und Vernunft. Der Schlüssel dazu liegt im Filmtitel. "La sapienza", die Weisheit, soll einen anderen Zugang zur Welt eröffnen als Verstand oder Gefühl es in Besonderung vermögen. Dankenswerterweise auch für die Ungläubigen: Ein angehender Architekturstudent erklärt sein Modell einer Idealstadt, deren Mitte ein ökumenischer Tempel bildet. Durch den Tempeldom strömt das Licht der Weisheit. Was aber ist mit den Atheisten? "Auch sie spüren die Präsenz", antwortet der junge Mann.

Eugène Green: La Sapienza
Und er hat recht: Obwohl vieles an "La sapienza" die Grenze zum Unerträglichen streift - seine verallgemeinerte Anglophobie zum Beispiel - kann man sich dem leichten Charme des Films nirgends entziehen. Das ist umso erstaunlicher, als an der Oberfläche wenig Leichtes ist: Die Figuren agieren durch die Bank wie freundliche Zombies oder Bresson-Modelle, alle tragen sie zudem, Greens Barocktheaterherkunft entsprechend, schwere allegorische Fracht. Trotzdem ist "La sapienza" ein beschwingter, fast schwebender Film, der es auch Ungläubigen ermöglicht, die Präsenz zu spüren.
Gleich zwei Argentinier waren im Wettbewerb vertreten: der junge Filmemacher Matías Piñeiro und der etwas ältere Martín Rejtman. Piñeiros "La princesa de Francia" erweitert und vertieft die poetischen Prinzipien seines ähnlich gelagerten Vorgängers "Viola", der 2013 auf der Berlinale zu sehen war [Link zur Kritik]. Beide Filme arbeiten sich an Shakespeariana als Folie für einen komplizierten Beziehungsreigen ab, und beide wählen als erzählerische Form die Theaterprobe. Auch das Schauspielerensemble ist zu weiten Teilen deckungsgleich. "La princesa de Francia" ist Zugabe und Wiederaufnahme der Probehandlungen aus "Viola", ohne an die Intensität des ersten Versuchs heranzureichen. Immer noch werden Gegenstände herumgereicht, Herzensbindungen umgestellt und Shakespeare-Dialoge reiteriert.
Aber während die Wiederholungsstruktur in "Viola" einen ekstatischen Fluchtpunkt hatte, dreht die Theatermaschine von "La princesa" gleichförmig am Rad. Mindestens so verspielt, aber wesentlich interessanter ist Rejtmans "Dos disparos". Die Prämisse, wie sie der Festivalkatalog vermerkt, klingt verdächtig nach Arthouse-Seelenforschung, aber das ist eine falsche Fährte. Ein Teenager findet eine Pistole und schießt sich ohne ersichtliches Motiv zwei Löcher in den noch unausgewachsenen Körper. Keiner der beiden Treffer ist tödlich. Stattdessen setzen sie eine Kettenreaktion in Gang, die indes wenig mit Figurenpsychologie (und noch weniger mit narrativer Kausalität) zu tun hat. Rejtman interessiert sich nicht für die Gründe der unergründlichen Tat und nur bedingt für ihre Folgen. Vor allem ist sie ihm ein Anlass, Unterbrechungen und unvorhergesehene Abzweigungen in den normalen Lauf der Dinge einzufügen: Mal folgt er dem verhinderten Selbstmörder, mal dessen Bruder. Dem Schwarm des Bruders. Des Schwarms Exfreund. Oder der Mutter bei einem Trip an die Küste, der uns über das letzte Drittel des Films wie selbstverständlich aus der Stadt und über das bis dahin etablierte Personal hinausführen wird.
Bei allen Abwegen und Schlenkern vermittelt "Dos disparos" doch einen Eindruck großer Präzision. Das hat nicht nur mit der abgezirkelten Mise-en-scène zu tun, sondern auch mit dem hintergründigen Rhythmus, der all das Ungleichartige mit metronomischer Regelmäßigkeit durchpulst. Von diesem Rhythmus, von diesem Film lässt man sich gerne überallhin tragen.
In der Sektion "Fuori concorso" (also außer Konkurrenz), konnten alle, die bereit waren, eine Stunde um die wenigen verfügbaren Plätze anzustehen, Jean-Luc Godards ersten 3D-Film sehen. 3D-Effekte sind nicht das einzige Novum in "Adieu au langage"; Godards Bild-Ideen-Montage scheint rundum verjüngt. Eine ungezähmte Vielfalt von Auflösungen, Kompositionen und Bearbeitungsphasen des Bilds lässt er aufeinanderprallen. Derart viele und schroffe Kanten hatte sein Vorgänger, der vergleichsweise gewählt sich ausdrückende "Film Socialisme", nicht. Viel nackte Haut ist außerdem zu sehen. Zwei Männer und ein Hund beim geräuschvollen Defäkieren. Ein deutscher Anzugträger, der herumbrüllt und Leute erschießt. Tonkanäle fallen aus oder überschlagen sich, der bei der digitalen Filmproduktion anfallende noise ist sehr präsent (zum Beispiel weiß ich jetzt, welche sonderbaren Interferenzen entstehen, wenn man mit einer 3D-Kamera einen Fernsehbildschirm abfilmt).

Jean-Luc Godard: Adieu au Language
Zweimal gehen das linke und das rechte Auge getrennte Wege: Mit solchen kopfschmerzinduzierenden Doppelungen/Entzweiungen (die man analytisch zerlegen kann, indem man abwechselnd das linke und das rechte Auge schließt) macht Godard, immer noch radikaler Neuerer der filmischen Grammatik, kurzerhand das Schuss-Gegenschuss-Verfahren obsolet. Und dann ist da noch, als Totemtier und Refrain dieses erstaunlich rüden Films, Roxy der Hund, den Godard immer wieder einschmuggelt. Ein agileres Alterswerk kenne ich nicht, weshalb schon vor der absolut notwendigen Zweitsichtung feststeht: Das Warten hat sich gelohnt.
Aus der Menge der "Cineasten der Gegenwart" - so heißt in Locarno die Nebensektion für Erstlings- und Zweitfilme - stachen zwei Arbeiten hervor: "Songs From the North" und "Buzzard". Ersterer, ein Essay- und Collagefilm der aus Südkorea gebürtigen Filmemacherin Soon-mi Yoo, erhielt die Auszeichnung für das beste Erstlingswerk. Yoo versammelt Ausschnitte aus nordkoreanischen Filmen, Theateraufführungen und anderes Archivmaterial zu einer Innenansicht der Diktatur. Eintauchend in die Welt der Propaganda - und ohne ihr als Korrektiv historische Tatsachen entgegenzustellen (mit einer, die Verwicklung der USA betreffenden Ausnahme) - fragt Yoo weniger nach der Wirklichkeit des Landes als nach dem nordkoreanischen Gefühl: Welche Affekte halten diese letzte Trutzburg des kalten Kriegs zusammen? Zwischen das vorgefundene Material montiert Yoo illegitime Wackelbilder von ihrem Nordkorea-Trip.
Aber auch hier gilt ihr Interesse zuvorderst den Selbstdarstellungen des Landes, dem Selbstverständnis seiner Bewohner: Menschen, die beim Gedenken an den ewigen Präsidenten der Volksrepublik Kim Il-sung in Tränen ausbrechen. Ewig plärrende Lautsprecher. Ein elektrifizierter Vergnügungspark in der elektrisch unterversorgten Hauptstadt. Yoo stellt rhetorische Fragen und kommt darum erst gar nicht in die Verlegenheit, nach Antworten suchen zu müssen. Manchmal, wenn das Bildmaterial selbst beredt genug ist, geht das Konzept auf. Im Ganzen aber bleibt "Songs From the North" hinter seinen oft bestechenden Bestandteilen zurück.
Joel Potrykus" "Buzzard" ist ein ganz anderes Tier. Der abschließende Teil dessen, was der amerikanische Regisseur aus Michigan seine animal trilogy nennt (nach "Coyote" und "Ape"), kreist um Marty Jackitansky, einen Metal-Fan, Horror-Nerd und Bank-Praktikanten frei von Skrupel, Empathie oder vorausschauendem Denken. Was im harmlosen Bürosetting beginnt, nimmt in der Isolation eines Partykellers Fahrt auf und entlädt sich schließlich in einem sonderbar passiven Amoklauf auf den mean streets von Detroit. Aber was ist das eigentlich für eine Energie, die durch diese lose Reihe von Orten geht? Keine im starken Wortsinn destruktive: Marty handelt nie (oder nur sehr niederschwellig) auf eigene Initiative. Ohne äußeren Anlass - ohne Gelegenheit - ist Marty lethargisch, auf die kleinste Bedrohung reagiert er wie ein in die Enge getriebenes Tier. Potrykus erheischt kein Verständnis für seine verständnislose Kreatur. Antriebslos und getrieben zugleich ist sie da, uns vor den Kopf zu stoßen. Bei der Preisverleihung ging "Buzzard" leer aus.
Verlässlicher als alles Gegenwartskino wusste bei der diesjährigen 67. Ausgabe des Filmfestivals von Locarno die historische Retrospektive zu begeistern, dem mittlerweile über hundert Jahre alten italienischen Filmstudio Titanus gewidmet. Das jeweils am Anfang eingeblendete pop-klassizistische Logo des Familienunternehmens - vor allem in der farbigen Variante sieht es aus wie eine Matthew-Barney-Vignette - fungiert als anschauliche Klammer für den überaus facettenreichen Output des Familienunternehmens. So etwas wie ein house style, der die Melodramen, Komödien, Abenteuer- und Autorenfilme von Titanus einte, ließ sich indes nur bedingt ausmachen.
Thematische, motivische Linien, wie etwa die Modernisierung Italiens in der Nachkriegszeit oder das Verhältnis zwischen Nord und Süd, gibt es wohl. Sehr weit tragen derart vage Koordinaten aber nicht. Oft sind Spurenelemente des Neorealismus auch und gerade in den Genrefilmen nachweisbar, die sich enthusiastisch auf die umgebende Welt öffnen. Es wurde viel alfresco und mit unerprobten Darstellern gedreht, aber auch Studiofilme streben überall ins Offene. Ein Aufsatz im Katalog zur Retro zitiert Komödienroutinier Dino Risi: "Neo-realism is not a genre, it is an outlook on reality. We were not outside Neo-realism. We were outside of official Neo-realism, that was about to become Mannerism."
Nikolaus Perneczky

Lav Diaz: From What Is Before
"Orapronobis" war, als filmische Intervention in laufende Vorgänge, von einer fiebrigen Dringlichkeit. Der Geschichtsfilm "From What Is Before" hat seine intensiven Momente, dazwischen aber nimmt sich Diaz, wie es seine Art ist, viel Zeit: für Arbeitsvorgänge, religiöse Verrichtungen, Mahlzeiten, Leerlauf, vor allem aber für das gemessene Durchschreiten weiter Landschaften - für die ereignisleeren Passagen zwischen den prägnanten Augenblicken. Parallel zum erst unmerklichen, dann aber rasch eskalierenden Einbruch der Historie in die enthobene Zeitrechnung der Dorfgemeinschaft verschiebt sich auch die Erzählweise. Wo anfangs nur Andeutungen und Rätsel waren - wer hat die massakrierten Rinder auf dem Gewissen? - macht sich später das fast didaktische Idiom einer Geschichtsstunde breit.
Wie die größere Geschichte der Philippinen die vielen kleinen Dorfgeschichten mit sich reißt, das ist der große Bogen, den "From What Is Before" aufspannt. Stets aber wird dieser Bogen durchkreuzt von Diaz" Ästhetik der Dauer: Jede der minutenlangen Einstellungen lädt dazu ein, sich in ihr zu verlieren, sodass die konkrete Erfahrung von Dauer das imaginäre (nicht anschaulich gegebene) Ganze - des Films, der Nation, der Geschichte - beständig infrage stellt.
Die Auszeichnung für die beste Regie, auch sie eine gute Wahl, ging an Pedro Costa für "Cavalo Dinheiro". Ventura, eine wiederkehrende Zentralfigur im Werk des Regisseurs, findet sich in einem Krankenhaus wieder. Halbnackt streift er durch dunkle Korridore, während der Verputz von den Wänden blättert. Erst meint man, die Zeit stünde still in dieser Anstalt, tatsächlich ist sie aus den Fugen geraten: Die teils biografischen, teils zeitgeschichtlichen Bruchstücke, die sich in der Begegnung mit anderen Patienten - oder sind es Insassen? - aktualisieren, datieren zurück auf Venturas Jugend auf Kap Verde und die frühen Jahre in Lissabon, wo er, der andere Sorgen hat, kein rechtes Verhältnis findet zu entscheidenden Umwälzungen wie der Nelkenrevolution.
In einem Aufzug steckengeblieben, wird Ventura von einem portugiesischen Soldaten, einem Kämpfer gegen die Diktatur, heimgesucht, der ihn dazu drängt, sich zur guten Sache zu bekennen. Der Soldat, reglos und von einer bronzenen Tönung überzogen, sieht aus wie einer jener Straßenkünstler, denen man in europäischen Großstädten seit einigen Jahren überall begegnet. Bewegen kann er sich nur dann, wenn die Kamera nicht hinsieht; seine Rede, ein halb entkörperlichtes voice-over, tönt wie aus einer anderen Welt. Den Gegenpol zu dieser allegorischen Gestalt bildet eine namentlich genannte Frau, die ihren Mann betreffende Polizeiprotokolle verliest. Ihr weinendes Gesicht in Großaufnahme suggeriert eine persönliche Lesart von Geschichte. In engen Grenzen gefangen, entfaltet "Cavalo Dinheiro" einen großen Formen- und Erfindungsreichtum - wenn es nur gelingt, sich auf die karge Schönheit und voraussetzungsreiche Mythologie des Films einzulassen.
"Listen Up Philip", Alex Ross Perrys dritter, mit dem Spezialpreis der Jury prämierter Langfilm, widmet sich einem jungen Mann an der Schwelle zu literarischem Ruhm, der nicht zufällig Vorname und Konfession mit dem Great American Novelist Philip Roth teilt. Jason Schwartzman gegenüber, der diesem eigentlich unerträglichen Narzissten das irritierend gefällige Gesicht leiht, steht Jonathan Pryce als alternder Schriftsteller Ike Zimmermann, noch so ein Roth-Wiedergänger, dessen Romane aus der Blütezeit der 1970er und achtziger Jahre Titel wie "Madness & Women" oder "Ample Profanity" tragen. Davon abgesehen erfährt man wenig Bestimmtes über diese Bücher, aber ihre Coverdesigns, kleine Pastiche-Meisterwerke, strahlen einen sofort wiedererkennbaren vergangenen Glanz aus, den auch die alles umgebende halblaute Ironie nicht vollständig verdunkeln kann.

Alex Ross Perry: Listen Up, Philip
Etwas Nostalgisches hat "Listen Up Philip" durchwegs, dem beißenden Tonfall zuwider, mit dem Perry den endgültigen Rückzug seines Protagonisten in die Egomanie abwickelt. So ausgesucht wie die Buchumschläge ist hier alles: Philips Brillengläser, die Inneneinrichtung von Ikes neuenglischer Schreibklause, die Garderobe von Philips Freundin Ashley, die sich sehr erfolgreich als Fotografin verdingt. Obwohl beide in wunderschöner 16mm-Körnung daherkommen: von Perrys lustvoll räudigem "The Color Wheel" (ironischerweiße in Schwarz-Weiß) zu den gedeckten Farben von "Listen Up Philip" ist es ein weiter Weg. Nicht zuletzt Schwartzmans grundsympathisches Nerdtum trägt dazu bei, die ätzende Sensibilität des Buchs (voller Rothsätze und -referenzen) zu verniedlichen. Dass "Listen Up Philip" trotzdem ein interessanter Film ist, verdankt sich Elizabeth Moss als Ashley.
In der allmählich sich verselbständigenden Plotlinie der Fotografin findet der Film einen Gegenpol zu den Seins- und Sprechweisen der männlichen Literaten. Wo Ike, bei einer Konfrontation mit seiner entfremdeten Tochter (auch toll: Krysten Ritter), im unsubtilen Schriftstellersprech über "the innate ineffability of human disappointment" schwadroniert, braucht Ashley wenig Worte, um alles zu sagen (vorgeblich über die schlecht gelaunte Katze, die sie sich nach der Trennung von Philip angeschafft hat): "He"s kind of an asshole, actually."
Mit unerwarteter Heftigkeit ist Park Jungbums "Alive" in den Wettbewerb eingeschlagen. Ein undurchsichtiger, körperlich dafür umso wuchtigerer Realismus waltet in diesem Film, der viele verständnisrelevante Details bewusst ausspart. Am Ende wird die Welt von "Alive" wiedererkennbare Züge angenommen haben: Gelegenheitsarbeiter im karg-gebirgigen Umland der südkoreanischen Hauptstadt auf der einen, die Bosse auf der anderen Seite. Der Weg zu dieser Milieubeschreibung - und zum finalen Kraftakt lumpenproletarischer Solidarität - ist alles andere als vorgezeichnet. Sehr langsam nur gelangt der Arbeiter Jungchul zu einem anderen Verständnis seiner Situation. Die "Bekehrung" - der unter die katholische Bevölkerung Südkoreas sich mischende Film wimmelt von christologischen Metaphern - ereilt ihn aber nicht allmählich, sondern blitzartig wie die Gnade bei Bresson oder bei den Dardennes. Von daher sind die torkelnden drei Stunden Laufzeit eigentlich nur ein Vorspiel zu der Epiphanie, mit der "Alive" schließt. In dem Maß, in dem die erzählerischen (und oft auch räumlichen) Zusammenhänge dieser Welt sich entziehen, ist man auf ihre Physis verwiesen, auf Selbstverstümmelung, schwere Arbeit, Panikattacken, ein intensives Theatervorsprechen und, als wiederkehrendes Bewegungsmotiv: Gerangel, Prügeleien und andere Streithändel bei vollem Körpereinsatz.
Bevor Jungchul eine Figur ist, ist er ein sturer Körper. In einer Szene rennt er, so oft er auch zurückgeworfen wird, wieder und wieder gegen eine Gruppe von Angreifern an. Neben solchen muscle memories bleiben von dem Film vor allem die kurzen Exkursionen in die Wohnräume der Ausbeuter in Erinnerung: Reptilien im Terrarium.
Ein veritabler Architekturfilm ist Eugène Greens "La sapienza", in dem es um den richtigen Gebrauch des Raums geht. Oft wähnt man sich in einem Manifest der Gegenmoderne: Rationalität, statistische Quantifizierung und Urbanismus kriegen alle ihr Fett ab. Am Ende sucht Green dann doch die Versöhnung der Gegensätze, von Licht und Dunkel, Anschauung und Vernunft. Der Schlüssel dazu liegt im Filmtitel. "La sapienza", die Weisheit, soll einen anderen Zugang zur Welt eröffnen als Verstand oder Gefühl es in Besonderung vermögen. Dankenswerterweise auch für die Ungläubigen: Ein angehender Architekturstudent erklärt sein Modell einer Idealstadt, deren Mitte ein ökumenischer Tempel bildet. Durch den Tempeldom strömt das Licht der Weisheit. Was aber ist mit den Atheisten? "Auch sie spüren die Präsenz", antwortet der junge Mann.

Eugène Green: La Sapienza
Und er hat recht: Obwohl vieles an "La sapienza" die Grenze zum Unerträglichen streift - seine verallgemeinerte Anglophobie zum Beispiel - kann man sich dem leichten Charme des Films nirgends entziehen. Das ist umso erstaunlicher, als an der Oberfläche wenig Leichtes ist: Die Figuren agieren durch die Bank wie freundliche Zombies oder Bresson-Modelle, alle tragen sie zudem, Greens Barocktheaterherkunft entsprechend, schwere allegorische Fracht. Trotzdem ist "La sapienza" ein beschwingter, fast schwebender Film, der es auch Ungläubigen ermöglicht, die Präsenz zu spüren.
Gleich zwei Argentinier waren im Wettbewerb vertreten: der junge Filmemacher Matías Piñeiro und der etwas ältere Martín Rejtman. Piñeiros "La princesa de Francia" erweitert und vertieft die poetischen Prinzipien seines ähnlich gelagerten Vorgängers "Viola", der 2013 auf der Berlinale zu sehen war [Link zur Kritik]. Beide Filme arbeiten sich an Shakespeariana als Folie für einen komplizierten Beziehungsreigen ab, und beide wählen als erzählerische Form die Theaterprobe. Auch das Schauspielerensemble ist zu weiten Teilen deckungsgleich. "La princesa de Francia" ist Zugabe und Wiederaufnahme der Probehandlungen aus "Viola", ohne an die Intensität des ersten Versuchs heranzureichen. Immer noch werden Gegenstände herumgereicht, Herzensbindungen umgestellt und Shakespeare-Dialoge reiteriert.
Aber während die Wiederholungsstruktur in "Viola" einen ekstatischen Fluchtpunkt hatte, dreht die Theatermaschine von "La princesa" gleichförmig am Rad. Mindestens so verspielt, aber wesentlich interessanter ist Rejtmans "Dos disparos". Die Prämisse, wie sie der Festivalkatalog vermerkt, klingt verdächtig nach Arthouse-Seelenforschung, aber das ist eine falsche Fährte. Ein Teenager findet eine Pistole und schießt sich ohne ersichtliches Motiv zwei Löcher in den noch unausgewachsenen Körper. Keiner der beiden Treffer ist tödlich. Stattdessen setzen sie eine Kettenreaktion in Gang, die indes wenig mit Figurenpsychologie (und noch weniger mit narrativer Kausalität) zu tun hat. Rejtman interessiert sich nicht für die Gründe der unergründlichen Tat und nur bedingt für ihre Folgen. Vor allem ist sie ihm ein Anlass, Unterbrechungen und unvorhergesehene Abzweigungen in den normalen Lauf der Dinge einzufügen: Mal folgt er dem verhinderten Selbstmörder, mal dessen Bruder. Dem Schwarm des Bruders. Des Schwarms Exfreund. Oder der Mutter bei einem Trip an die Küste, der uns über das letzte Drittel des Films wie selbstverständlich aus der Stadt und über das bis dahin etablierte Personal hinausführen wird.
Bei allen Abwegen und Schlenkern vermittelt "Dos disparos" doch einen Eindruck großer Präzision. Das hat nicht nur mit der abgezirkelten Mise-en-scène zu tun, sondern auch mit dem hintergründigen Rhythmus, der all das Ungleichartige mit metronomischer Regelmäßigkeit durchpulst. Von diesem Rhythmus, von diesem Film lässt man sich gerne überallhin tragen.
In der Sektion "Fuori concorso" (also außer Konkurrenz), konnten alle, die bereit waren, eine Stunde um die wenigen verfügbaren Plätze anzustehen, Jean-Luc Godards ersten 3D-Film sehen. 3D-Effekte sind nicht das einzige Novum in "Adieu au langage"; Godards Bild-Ideen-Montage scheint rundum verjüngt. Eine ungezähmte Vielfalt von Auflösungen, Kompositionen und Bearbeitungsphasen des Bilds lässt er aufeinanderprallen. Derart viele und schroffe Kanten hatte sein Vorgänger, der vergleichsweise gewählt sich ausdrückende "Film Socialisme", nicht. Viel nackte Haut ist außerdem zu sehen. Zwei Männer und ein Hund beim geräuschvollen Defäkieren. Ein deutscher Anzugträger, der herumbrüllt und Leute erschießt. Tonkanäle fallen aus oder überschlagen sich, der bei der digitalen Filmproduktion anfallende noise ist sehr präsent (zum Beispiel weiß ich jetzt, welche sonderbaren Interferenzen entstehen, wenn man mit einer 3D-Kamera einen Fernsehbildschirm abfilmt).

Jean-Luc Godard: Adieu au Language
Zweimal gehen das linke und das rechte Auge getrennte Wege: Mit solchen kopfschmerzinduzierenden Doppelungen/Entzweiungen (die man analytisch zerlegen kann, indem man abwechselnd das linke und das rechte Auge schließt) macht Godard, immer noch radikaler Neuerer der filmischen Grammatik, kurzerhand das Schuss-Gegenschuss-Verfahren obsolet. Und dann ist da noch, als Totemtier und Refrain dieses erstaunlich rüden Films, Roxy der Hund, den Godard immer wieder einschmuggelt. Ein agileres Alterswerk kenne ich nicht, weshalb schon vor der absolut notwendigen Zweitsichtung feststeht: Das Warten hat sich gelohnt.
Aus der Menge der "Cineasten der Gegenwart" - so heißt in Locarno die Nebensektion für Erstlings- und Zweitfilme - stachen zwei Arbeiten hervor: "Songs From the North" und "Buzzard". Ersterer, ein Essay- und Collagefilm der aus Südkorea gebürtigen Filmemacherin Soon-mi Yoo, erhielt die Auszeichnung für das beste Erstlingswerk. Yoo versammelt Ausschnitte aus nordkoreanischen Filmen, Theateraufführungen und anderes Archivmaterial zu einer Innenansicht der Diktatur. Eintauchend in die Welt der Propaganda - und ohne ihr als Korrektiv historische Tatsachen entgegenzustellen (mit einer, die Verwicklung der USA betreffenden Ausnahme) - fragt Yoo weniger nach der Wirklichkeit des Landes als nach dem nordkoreanischen Gefühl: Welche Affekte halten diese letzte Trutzburg des kalten Kriegs zusammen? Zwischen das vorgefundene Material montiert Yoo illegitime Wackelbilder von ihrem Nordkorea-Trip.
Aber auch hier gilt ihr Interesse zuvorderst den Selbstdarstellungen des Landes, dem Selbstverständnis seiner Bewohner: Menschen, die beim Gedenken an den ewigen Präsidenten der Volksrepublik Kim Il-sung in Tränen ausbrechen. Ewig plärrende Lautsprecher. Ein elektrifizierter Vergnügungspark in der elektrisch unterversorgten Hauptstadt. Yoo stellt rhetorische Fragen und kommt darum erst gar nicht in die Verlegenheit, nach Antworten suchen zu müssen. Manchmal, wenn das Bildmaterial selbst beredt genug ist, geht das Konzept auf. Im Ganzen aber bleibt "Songs From the North" hinter seinen oft bestechenden Bestandteilen zurück.
Joel Potrykus" "Buzzard" ist ein ganz anderes Tier. Der abschließende Teil dessen, was der amerikanische Regisseur aus Michigan seine animal trilogy nennt (nach "Coyote" und "Ape"), kreist um Marty Jackitansky, einen Metal-Fan, Horror-Nerd und Bank-Praktikanten frei von Skrupel, Empathie oder vorausschauendem Denken. Was im harmlosen Bürosetting beginnt, nimmt in der Isolation eines Partykellers Fahrt auf und entlädt sich schließlich in einem sonderbar passiven Amoklauf auf den mean streets von Detroit. Aber was ist das eigentlich für eine Energie, die durch diese lose Reihe von Orten geht? Keine im starken Wortsinn destruktive: Marty handelt nie (oder nur sehr niederschwellig) auf eigene Initiative. Ohne äußeren Anlass - ohne Gelegenheit - ist Marty lethargisch, auf die kleinste Bedrohung reagiert er wie ein in die Enge getriebenes Tier. Potrykus erheischt kein Verständnis für seine verständnislose Kreatur. Antriebslos und getrieben zugleich ist sie da, uns vor den Kopf zu stoßen. Bei der Preisverleihung ging "Buzzard" leer aus.
Verlässlicher als alles Gegenwartskino wusste bei der diesjährigen 67. Ausgabe des Filmfestivals von Locarno die historische Retrospektive zu begeistern, dem mittlerweile über hundert Jahre alten italienischen Filmstudio Titanus gewidmet. Das jeweils am Anfang eingeblendete pop-klassizistische Logo des Familienunternehmens - vor allem in der farbigen Variante sieht es aus wie eine Matthew-Barney-Vignette - fungiert als anschauliche Klammer für den überaus facettenreichen Output des Familienunternehmens. So etwas wie ein house style, der die Melodramen, Komödien, Abenteuer- und Autorenfilme von Titanus einte, ließ sich indes nur bedingt ausmachen.
Thematische, motivische Linien, wie etwa die Modernisierung Italiens in der Nachkriegszeit oder das Verhältnis zwischen Nord und Süd, gibt es wohl. Sehr weit tragen derart vage Koordinaten aber nicht. Oft sind Spurenelemente des Neorealismus auch und gerade in den Genrefilmen nachweisbar, die sich enthusiastisch auf die umgebende Welt öffnen. Es wurde viel alfresco und mit unerprobten Darstellern gedreht, aber auch Studiofilme streben überall ins Offene. Ein Aufsatz im Katalog zur Retro zitiert Komödienroutinier Dino Risi: "Neo-realism is not a genre, it is an outlook on reality. We were not outside Neo-realism. We were outside of official Neo-realism, that was about to become Mannerism."
Nikolaus Perneczky
Kommentieren