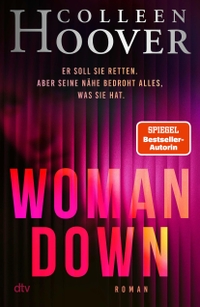Im Kino
Meta für Blöde
Die Filmkolumne. Von Thomas Groh, Jochen Werner
05.09.2013. In seiner neuen Zerstörungsorgie "White House Down" zelebriert Roland Emmerich linken Patriotismus und scheitert dabei so schwungvoll, dass es schon wieder Spaß macht. James Marshs IRA-Drama "Shadow Dancer" krankt an einer unterkomplexen Protagonistin und dem Zwang zum Auserzählen.
Führung durchs Weiße Haus. Den Tunnel, erfahren wir, den Kennedy genutzt haben soll, um zum heimlichen Stelldichein mit der Monroe zu gelangen, gibt es nicht (natürlich erfahren wir später: es gibt ihn doch!). Wohl aber gibt es, aber wir erfahren nicht wo, den geheimen Tunnel zur obersten Kommandozentrale der Nuklear-Arsenale der USA (und natürlich erfahren wir später doch, wie man dorthin gelangt). Ganz sicher aber gibt es den Teil des Weißen Hauses, der in "Independence Day" Mitte der 90er unter Alienbeschuss dramatisch in die Luft ging - das verkündet uns der Besucherführer im Weißen Haus, der damit von dem einen, diesem, Roland-Emmerich-Film auf den anderen Roland-Emmerich-Film referenziert. Meta für Blöde - aber so hinreißend beknackt und darin entwaffnend ehrlich, dass es schon wieder Freude macht, diesem Schwachsinn zuzusehen.
Eine ganze Weile lang erfahren wir nicht, dass der Bruch und Krach, der schon wenig später durchs Weiße Haus fegen wird - markige Söldner aus dem Comicheft für Zehnjährige, ein debil-deliranter Hacker, mit dem Emmerich vielleicht ein bisschen von der Figur des jecken Wahnsinnigen Marke Ledgers Joker für sich haben will, vielleicht aber auch nicht -, jedenfalls erfahren wir lange Zeit lang nicht, was es mit diesem Coup d'état auf sich hat. Dass es rechte Falken aus Konservatismus und Waffenlobby sein sollen, die für etwas Penunze und Status Quo den Staatsapparat und gleich noch den Globus dazu abfackeln wollen, ist dann auch schon wieder ein Filetstück für Blöde - und auf eine Weise von hinten durch den Rücken ins Auge getroffen, dass es schon wieder Spaß macht.

Schwachsinnig ist auch der Held der Geschichte, John Cale (Channing Tatum), der hier in der Rolle nicht nur von Bruce Willis in "Stirb Langsam", sondern auch von Gerald Butler im gerade erst im Kino gewesenen Weißes-Haus-Reißer "Olympus has Fallen" (unsere Kritik) steckt, also in der Rolle des rechten Kämpfers, der sich zur rechten Zeit am rechten Ort befindet, und dabei allerdings von allen dreien die schlechteste Figur macht. Dafür darf er mit dem Präsidenten (Jamie Foxx), eine dito auf schwachsinnig getrimmte Obama-Karikatur in Sneakers, durch Aufzugschächte robben, vor allem aber vor der Weltöffentlichkeit den Garten des Weißen Hauses verwüsten. Eine Tochter hat er auch, sogar im Weißen Haus dabei, weshalb sie den Söldnern als Geißel in die Hände fällt und damit für human-interest-Spannung sorgt. Schwachsinnig ist diese wiederum gar nicht, was vielleich auch deswegen keine Freude macht, sondern nervt: Als Lisa-Simpson-artige Patriotin von links und demokratische Idealistin ist sie zwar noch weit von jeder Wahlberechtigung entfernt, käst aber zu allem und jedem Altkluges und Naseweises aus sich heraus, kullert versonnen mit Mädchenaugen, wenn sie des Präsidenten in personam ansichtig wird und unterhält zudem noch einen YouTube-Channel, der im Laufe des Films noch eine gewichtige Rolle spielen wird. Zum Ende hin darf sie Old Glory schwenkend in Zeitlupe aufs Feld stürmen, was dann völlig schräg ins Kraut schießt.
Kurz und gut: War der thematisch nahe Rechtsaußen-Thriller "Olympus Has Fallen" noch kerniges Genrehandwerk aus der zweiten Reihe, steht im Linksaußen-Pendant so ziemlich alles quer vernagelt zueinander, gerade so, als hätte Roland Emmerich Tim Burtons "Mars Attacks" geremaket, aber dabei die Aliens vergessen. Man weiß nicht, was man mehr bestaunen soll: Die verzweifelte Unfähigkeit, die Ikonografie des traditionell eher rechts mit dem Herz schlagenden US-Patriotismus von linker Seite aus zu okkupieren? Die fast schon bösartige Chuzpe, Obama unentwegt die Eselsmütze aufzusetzen, ihn aber doch eigentlich ziemlich super zu finden? Die rustikale Uneleganz, mit der Emmerich hier nach dem Motto "viel hilft viel" seine Action inszeniert? Das mangelnde Gespür für heutige Medienwelten, selbst wenn Emmerich einen ganzen quer verschalteten Medienpark ins Bild setzt? Der Bierernst, mit dem hier höchst Albernes in Szene gesetzt wird? Man weiß es nicht. Nur: In "White House Down" blüht der Schwach- und Wahnsinn unter viel Gerumpel und Gepumpel, man kann förmlich dabei zusehen, wie Versatzstück und Kalkül einander auf dem Reißbrett begegnen, umgarnen, aneinander scheitern und zu Bruch gehen. Es gelingt das wenigste, doch darin entwickelt "White House Down" faszinierende Bravour. Wer Qualität im eigentlichen Sinne für sein Geld nicht erwartet, kommt immerhin auf seine Kosten: Unterhaltungskino, das blendend unterhält. In gewissem - und wirklich nur in gewissem - Sinne also: Als Film höchst erfolgreich in seinem Tun.
Thomas Groh
+++

Eine Sequenz am Anfang von "Shadow Dancer" ist stark: eine junge Frau in einer Londoner U-Bahn. Still im Lärmen und Drängen um sie herum, die Stimme der elektronischen Bandansage: "Mind the gap. Mind the gap. Mind the gap." Die junge Frau steigt aus, bleibt auf dem Bahnsteig stehen. Menschen bewegen sich um sie herum, aber zu viele von ihnen stehen still. Bewegen sich erst, als sie zu gehen, dann zu laufen beginnt. Sie stellt ihre Handtasche auf einer Treppe ab, flüchtet sich in einen Tunnel. Aus der Ferne eine Stimme, die alle Passagiere zum Verlassen des Bahnhofs auffordert. Terroralarm. Die Flüchtende lässt sich nicht beirren, sucht sich weiter ihren Weg durch die nachtschwarzen, nur schwach beleuchteten Tunnel. Ans Tageslicht. Doch dort warten sie bereits, um sie aufzugreifen.
Diese Sequenz ist vollkommen filmisch: Handlungen, Blicke, Objekte. Bilder. Das Sonnenlicht und der Wind im Haar der jungen Frau. Das Tiefblau ihrer Jacke. Immer wieder: ihre Tasche. Ihre suchenden, furchtsamen, zielstrebigen, immer etwas traurigen Augen. Die Entscheidungen, die sie trifft, um ihren Verfolgern zu entkommen: schnell, beinahe automatisch. Ohne eine Sekunde zu zögern. "Shadow Dancer" hätte ein großartiger Film sein können, wenn er nur ein bisschen mehr so wäre wie diese Sequenz. Aber das ist er leider nicht, und auch diese Sequenz kommt nicht ohne die aus, die vor ihr steht.
Schon von den ersten Bildern an ist alles in der Figur dieser schönen, traurigen Terroristin immer schon auserzählt, zu Ende erklärt. Zwanzig Jahre vor der geschilderten Londoner Sequenz, 1973 in Belfast, setzt der Prolog von "Shadow Dancer" ein: ein Mädchen, das nicht selbst ausgehen will, um Zigaretten für den Vater zu kaufen, das stattdessen den jüngeren Bruder schickt. Der von marodierenden Massen auf den Straßen kurzerhand erschossen wird. Ein bitterer Blick des Vaters, eine Tür, die sich schließt. Auf ein Leben ohne Terror.

Genau so funktioniert leider "Shadow Dancer" insgesamt, für jede Wirkung gibt es eine Ursache, und das Eine führt in gerader Linie zum Anderen. James Marsh, der 2009 einen Oscar für seinen Dokumentarfilm "Man on Wire" gewann, inszeniert sein Terrorismusdrama als einen kreuzlangweiligen Problemfilm, der sich zwar gelegentlich gar nicht so erfolglos um visuelle Intensitäten bemüht - nicht nur anfangs, auch später finden sich durchaus kraftvolle, echte Kino-Bilder -, der aber in seinem braven und behäbigen Erzählduktus nie einlösen kann, was er formal versprechen möchte.
Das liegt in erster Linie daran, dass es der Inszenierung an Konzentration mangelt. Über weite Strecken möchte "Shadow Dancer" vor allem Charakterstudie sein, aber der Charakter, den es zu studieren gälte, ist viel zu durchsichtig angelegt. Das Tun von Collette (Andrea Riseborough) folgt stets klaren Motivationen: in den Terrorismus getrieben durch den Tod des Bruders, von ihren verbleibenden Brüdern, den fanatischen IRA-Kämpfern Gerry und Connor, in der Organisation gehalten, und zum Wohle ihres eigenen entfremdeten Sohnes in die Spitzeltätigkeit gedrängt. Collette ist keine psychologisch komplexe Figur, die es zu ergründen gälte, sondern eine austauschbare Funktionsträgerin, benutzt von Regisseur Marsh, um an ihr das Wesen der terroristischen Gewaltspirale durchzudeklinieren - ohne dabei dem irrationalen, unerklärbaren Rest jenen Raum zu lassen, der ihm darin zukommt.
Völlig verloren, mitunter wie aus einem anderen Film gefallen, wirkt dabei die Figur des MI5-Agenten Mac, der Collette zunächst anwirbt - und sie schließlich davor zu retten versucht, von den eigenen Vorgesetzten skrupellos geopfert zu werden. Clive Owen spielt diese Figur wie den aufrechten Helden eines Spionagethrillers, steht damit aber ziemlich allein auf ziemlich verlorenem Posten, denn für eine generische Spannungsdramaturgie interessiert sich "Shadow Dancer" wenig. Auch diese Variation auf den Stoff, der auf einer Romanvorlage von Tom Bradby basiert, hätte man vielleicht lieber gesehen als die einigermaßen halbgare, die nach der Premiere im Berlinale-Wettbewerb 2012 mit mehr als eineinhalbjähriger Verspätung nachgereicht wird. Was vielleicht gar nicht mehr hätte sein müssen, denn eigentlich gibt es keinen Grund, sich in diesen ziemlich langweiligen und wenig aufschlussreichen 100 Minuten nicht einfach einen besseren Film anzuschauen.
Jochen Werner
White House Down - USA 2013 - Regie: Roland Emmerich - Darsteller: Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke, Richard Jenkins, Joey King, James Woods - Laufzeit: 131 Minuten.
Shadow Dancer - GB 2012 - Regie: James Marsh - Darsteller: Andrea Riseborough, Clive Owen, Maria Laird, Ben Smyth, Brid Brennan, Cathal Maguire - Laufzeit: 101 Minuten.
Kommentieren