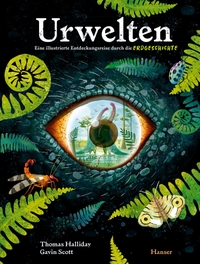Im Kino
Nähe als Utopie
Die Filmkolumne. Von Michael Kienzl
01.01.2025. Daniel Craig verfällt in Luca Guadagninos "Queer" einem jungen, mysteriösen G.I. mit drahtigem Körper. Gelegentlich droht der Film, zu steril und verkopft zu werden - aber glücklicherweise triumphiert in den entscheidenden Momenten dennoch stets die Buchstäblichkeit des Körpers.
Im mexikanischen Exil lebt der abgehalfterte Amerikaner Lee (Daniel Craig) in den Tag hinein. Meist betrinkt er sich allein und über den Tresen gebeugt in einer spärlich besuchten Bar oder stellt jungen, hübschen Männern nach. Das Treiben des verschrobenen Mittfünfzigers bewegt sich irgendwo zwischen lustgetrieben und selbstzerstörerisch. Als sich Lee einmal mit seinem nicht minder exzentrischen Landsmann Joe (Jason Schwartzman) über potenzielle Bettbekanntschaften unterhält, nutzen sie das Wort queer. Nicht im heutigen, auf korrekte Weise sämtliche nicht-heterosexuelle Gruppierungen miteinbeziehenden Sinn, sondern als Synonym für schwul - nur eben im 50er-Jahre-Kontext. Das Randständige, Perverse, in die Mehrheitsgesellschaft nicht Integrierbare schwingt dabei noch mit. Für Lee und Joe besteht die Schwierigkeit bei der Partnerwahl darin, den richtigen Grad an Queerness zu finden. Manche sind es zu wenig, nämlich schlicht heterosexuell, andere zu viel. So wie die zickigen Tunten, die blasiert am Tresen stehen und von Lee, der sich selbst wiederum gar nicht als queer versteht, nur mit einem abfälligen Blick registriert werden.
Ein für Lee äußerst faszinierendes Mysterium in puncto Queerness ist der junge, unnahbare G.I. Eugene (Drew Starkey): schmales ebenmäßiges Gesicht, zurückgegeltes, akkurat gescheiteltes Haar und ein drahtiger Körper, um den sich die weit geschnittene, pastellfarbene Kleidung schmiegt. Eugene wirkt ein bisschen nerdig und schnöselig, schwebt in seiner eigenen Sphäre, ist aber auch immer wieder auf charmante Art zugewandt. Was er wirklich denkt und fühlt, bleibt ein Geheimnis. Luca Guadagninos Adaption von William S. Burroughs' "Queer" - einer Art Fortsetzung seines autobiografischen Romans "Junkie" - handelt von der Sehnsucht nach dem Unerreichbaren, von Sucht und Besessenheit. Verkörpert wird das unstillbare Verlangen einerseits von Lees Drogensucht, andererseits von seiner zunehmenden Fixierung auf den attraktiven Homme Fatale.
Kaum hat Lee mit dem jungen G.I. Sex gehabt, wirkt dieser beim nächsten Treffen schon wieder kühl und abweisend. Je verzweifelter Lee sich Eugene zu nähern versucht, desto weiter rückt sein Objekt der Begierde in die Ferne. Als sich die beiden im Kino Jean Cocteaus "Orphée" ansehen und der Titelheld darin durch einen Spiegel in die Unterwelt steigt, nutzt Guadagnino einen altmodischen Doppelbelichtungs-Effekt. Wie ein Geist tritt Lee aus seinem Körper, um Eugene zu streicheln, während die beiden Männer in Wahrheit nur regungslos nebeneinander sitzen. Auf vielfältige Weise bleibt Nähe in "Queer" eine Utopie.

"Ich bin nicht queer, ich bin körperlos" lautet ein mehrmals ausgesprochener Satz. Guadagnino schickt uns mit ihm nicht in ein identitätspolitisches Labyrinth, sondern nutzt ihn als Fundament für eine bittersüße Geschichte über Selbstverlust und unerwiderte Zuneigung. Nicht nur die Natur des Menschen bleibt ungreifbar, sondern auch zwischenmenschliche Beziehungen. Was im Film vielleicht manchmal zu abstrakt gedacht ist, wird durchs nuancierte Schauspiel zu Fleisch und Blut. Besonders Daniel Craig als abgewrackter Schmierbolzen, der seine Knarre stets sichtbar am Hosenbund trägt, ist eine Schau. Eugenes Anwesenheit führt bei ihm zu körperlicher Entgleisung. Aus Verlegenheit verfällt er wie ein verliebter Teenager in unbeholfenen Slapstick.
Dass Lees Sehnsucht nach Liebe ungestillt bleibt, hat auch damit zu tun, dass er nicht zu wissen scheint, was das eigentlich ist. Seine Zuneigung drückt sich darin aus, dass er Eugene kontrollieren und besitzen will. Als Lee eine Reise in den südamerikanischen Dschungel plant, um die sagenumwobene Droge Yage zu probieren, will er den jungen Mann als Begleiter. Der Deal: Lee kümmert sich um das Finanzielle, dafür ist Eugene ab und zu "nett zu ihm". Droge und Liebhaber ähneln sich nicht nur aufgrund ihres Suchtpotenzials und des Wechsels zwischen Euphorie und kalter Ernüchterung; das eine soll auch das andere entschlüsseln. Die telepathischen Fähigkeiten, die man Yage nachsagt, will Lee nutzen, um Eugene zu verstehen. Doch selbst als sie im Rausch zum psychedelischen CGI-Knäuel werden, bringt das keine Erlösung. Körperlos sein bedeutet letztlich auch, zu verschwinden.
Nachdem sich Luca Guadagnino zuletzt mit seinem sexuell aufgeladenen Tennis-Melodram "Challengers" von den geschmäcklerischen Manierismen früherer Filme befreit hatte, kommen im Nachfolger wieder einige seiner schlechteren Angewohnheiten zum Tragen. Der überwiegend im traditionsreichen italienischen Filmstudio Cinecittà gedrehte Film kokettiert mit seinem künstlichen Look. Mexiko City wirkt wie eine leblose Kulisse und auch dem Dschungel versucht "Queer" jeden Anflug von Authentizität auszutreiben. Selbst die drogengeschwängerten Visionen wirken seltsam aufgeräumt. Zu den unglücklichen Entscheidungen zählen außerdem die anachronistischen Pop-Songs von Nirvana, Prince und New Order. Ihr Einsatz entwickelt sich nicht schlüssig aus der Geschichte, sie bleiben aufgepfropfte Fremdkörper. Guadagninos Scheu, sein Material stärker zu formen, führt mitunter zu einer komischen Distanz zum eigenen Film. Manche klug oder originell gemeinte Idee stellt er wie in einem Schaukasten aus.
Glücklicherweise schlagen zwei Herzen in der Brust des Films. Meist ist "Queer" zu emotional und sinnlich, um den kunstsinnigen Tendenzen allzu viel Raum zur Entfaltung zu geben. Unterschwellige Erregung belebt das sterile Setting. Wo der Film droht, zu verkopft zu werden, tritt die Buchstäblichkeit des Körpers auf den Plan: der Geschmack von Kotze oder die Spermapfütze auf dem nackten Bauch. Über der Studiokulisse liegt die Traurigkeit einer schwülen Nacht. Die Ambivalenzen treten auch auf dem Soundtrack hervor. Als Gegenpol zu den melancholischen Popsongs haben Trent Reznor und Atticut Ross eine zurückgenommene, schwerelos schöne, teilweise an Howard Shore erinnernde Musik komponiert. Toll sind auch die Kostüme des britischen Modedesigners Jonathan W. Anderson - aktuell unter anderem Kreativdirektor bei der Luxusmarke Loewe -, die einen sexy kolonialen Vintage-Look heraufbeschwören, der elegant, aber nie zu adrett wirkt.
Vielleicht hat es auch mit dem Drehbuch von "Challengers"-Autor Justin Kuritzke zu tun, dass "Queer" häufig die richtigen Prioritäten setzt. Nicht jede Idee zündet - der küchenpsychologische Meta-Kniff, Lee zu nutzen, um den Autor Burroughs zum alten Mann mit gebrochenem Herzen zu sentimentalisieren, zum Beispiel nicht -, aber meist werden solche überambitionierten Einfälle von der ständigen Spannung zwischen Nähe und Distanz zurückgedrängt. Auch wenn man zunächst meint, Drew Starkey stünde im Schatten Daniel Craigs, bereichert seine Darbietung - gewissermaßen eine einzige Verkörperung des Begriffs "cocktease" - den Film ungemein. Immer wieder bricht er die scheinbar undurchdringbare Fassade mit einem offenen Blick, einem aufrichtigen Lächeln oder einer zarten Berührung, nur um sich im nächsten Augenblick wieder dem hilflosen Werben zu entziehen. Vielleicht liegt das Geheimnis von "Queer" darin, dass Guadagnino - dessen Inszenierung manchmal ähnlich kontrollsüchtig wirkt wie Lees romantische Avancen - dem Mysterium Eugenes selbst hoffnungslos verfällt.
Michael Kienzl
Queer - Italien 2024 - Regie: Luca Guadagnino - Darsteller: Daniel Craig, Drew Starkey, Jason Schwartzman, Colin Bates, Daan de Wit, Henrique Zaga - Laufzeit: 136 Minuten.
Kommentieren